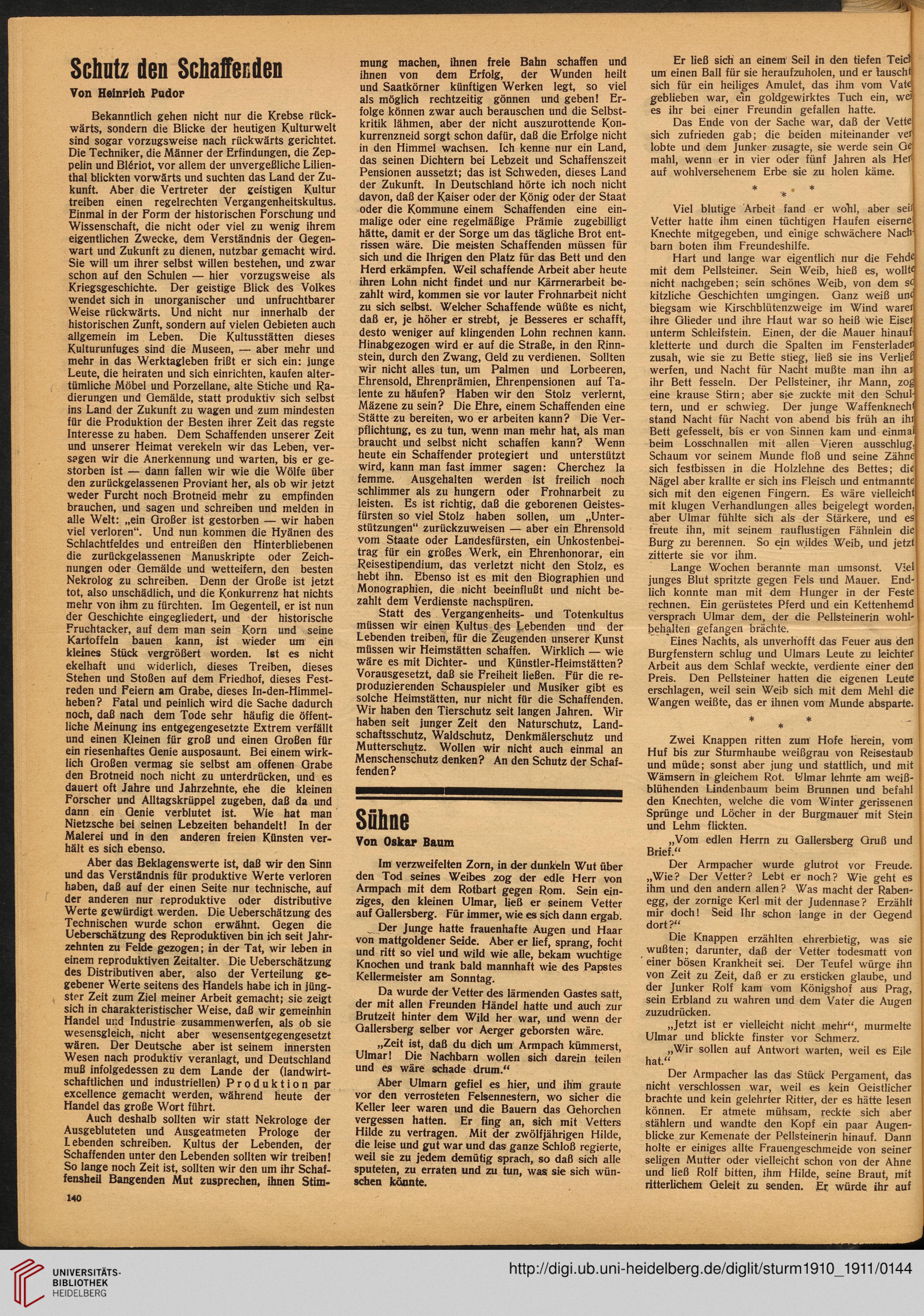Schutz den Schaffecden
Von Heinrich Pudor
Bekanntlich gehen nicht nur die Krebse riick-
wärts, sondern die Blicke der heutigen Kulturwelt
sind sogar vorzugsweise nach rückwärts gerichtet.
Die Techniker, die Männer der Erfindungen, die Zep-
pelin und B16riot, vor allem der unvergeßliche Lilien-
thal blickten vorwärts und suchten das Land der Zu-
kunft. Aber die Vertreter der geistigen Kultur
treiben einen regelrechten Vergangenheitskultus.
Einmal in der Form der historischen Forschung und
Wissenschaft, die nicht oder viel zu wenig ihrem
eigentlichen Zwecke, dem Verständnis der Qegen-
wart und Zukunft zu dienen, nutzbar gemacht wird.
Sie will um ihrer selbst willen bestehen, und zwar
schon auf den Schulen — hier vorzugsweise als
Kriegsgeschichte. Der geistige Blick des Volkes
wendet sich in unorganischer und unfruchtbarer
Weise rückwärts. Und nicht nur innerhalb der
historischen Zunft, sondern auf vielen Qebieten auch
allgemein im Leben. Die Kultusstätten dieses
Kulturunfuges sind die Museen, — aber mehr und
mehr in das Werktagleben frißt er sich ein: junge
Leute, die heiraten und sich einrichten, kaufen alter-
tümliche Möbel und Porzellane, alte Stiche und Ra-
dierungen und Qemälde, statt produktiv sich selbst
ins Land der Zukunft zu wagen und zum mindesten
für die Produktion der Besten ihrer Zeit das regste
Interesse zu haben. Dem Schaffenden unserer Zeit
und unserer Heimat verekeln wir das Leben, ver-
sagen wir die Anerkennung und warten, bis er ge-
storben ist — dann fallen wir wie die Wölfe über
den zurückgelassenen Proviant her, als ob wir jetzt
weder Furcht noch Brotneid mehr zu empfinden
brauchen, und sagen und schreiben und melden in
alle Welt: „ein Qroßer ist gestorben — wir haben
viei verloren“. Und nun kommen die Hyänen des
Schlachtfeldes und entreißen den Hinterbliebenen
die zurückgelassenen Manuskripte oder Zeich-
nungen oder Qemälde und wetteifern, den besten
Nekrolog zu schreiben. Denn der Qroße ist jetzt
tot, also unschädlich, und die Konkurrenz hat nichts
mehr von ihm zu fürchten. Im Qegenteil, er ist nun
der Geschichte eingegliedert, und der historische
Fruchtacker, auf dem man sein Korn und seine
Kartoffeln bauen kann, ist wieder um ein
kleines Stück vergrößert worden. Ist es nicht
ekelhaft und widerlich, dieses Treiben, dieses
Stehen und Stoßen auf dem Friedhof, dieses Fest-
reden und Feiern am Qrabe, dieses In-den-Himmel-
heben? Fatal und peinlich wird die Sache dadurch
noch, daß nach dem Tode sehr häufig die öffent-
liche Meinung ins entgegengesetzte Extrem verfällt
und einen Kleinen für groß und einen Qroßen für
ein riesenhaftes Qenie ausposaunt. Bei einem wirk-
lich Qroßen vermag sie selbst am offenen Qrabe
den Brotneid noch nicht zu unterdrücken, und es
dauert oft Jahre und Jahrzehnte, ehe die kleinen
Forscher und Alltagskrüppel zugeben, daß da und
dann ein Qenie verblutet ist. Wie hat man
Nietzsche bei seinen Lebzeiten behandelt! In der
Malerei und in den anderen freien Künsten ver-
hält es sich ebenso.
Aber das Beklagenswerte ist, daß wir den Sinn
und das Verständnis für produktive Werte verloren
haben, daß auf der einen Seite nur technische, auf
der anderen nur reproduktive oder distributive
Werte gewürdigt werden. Die Ueberschätzung des
Technischen wurde schon erwähnt. Qegen die
Ueberschätzung des Reproduktiven bin ich seit Jahr-
zehnten zu Felde gezogen; in der Tat, wir Ieben in
eir.em reproduktiven Zeitaiter. Die Ueberschätzung
des Distributiven aber, also der Verteilung ge-
gebener Werte seitens des Handels habe ich in jüng-
ster Zeit zum Ziel meiner Arbeit gemacht; sie zeigt
sich in charakteristischer Weise, daß wir gemeinhin
Handel und Industrie zusammenwerfen, als ob sie
wesensgleich, nicht aber wesensentgegengesetzt
wären. Der Deutsche aber ist seinem innersten
Wesen nach produktiv veranlagt, und Deutschland
muß infolgedessen zu dem Lande der (Iandwirt-
schaftlichen und industriellen) Produktion par
excellence gemacht werden, während heute der
Handel das große Wort führt.
Auch deshalb sollten wir statt Nekrologe der
Ausgebluteten und Ausgeatmeten Prologe der
Lebenden schreiben. Kultus der Lebenden, der
Schaffenden unter den Lebenden sollten wir treiben!
So lange noch Zeit ist, soliten wir den um ihr Schaf-
fensheil Bangenden Mut zusprechen, ihnen Stim-
mung machen, ihnen freie Bahn schaffen und
ihnen von dem Erfolg, der Wunden heilt
und Saatkörner künftigen Werken legt, so viel
als möglich rechtzeitig gönnen und geben! Er-
folge können zwar auch berauschen und die Selbst-
kritik lähmen, aber der nicht auszurottende Kon-
kurrenzneid sorgt schon dafür, daß die Erfolge nicht
in den Himmel wachsen. Ich kenne nur ein Land,
das seinen Dichtern bei Lebzeit und Schaffenszeit
Pensionen aussetzt; das ist Schweden, dieses Land
der Zukunft. In Deutschland hörte ich noch nicht
davon, daß der Kaiser oder der König oder der Staat
oder die Kommune einem Schaffenden eine ein-
malige oder eine regelmäßige Prämie zugebilligt
hätte, damit er der Sorge um das tägliche Brot ent-
rissen wäre. Die meisten Schaffenden müssen für
sich und die Ihrigen den Platz für das Bett und den
Herd erkämpfen. Weil schaffende Arbeit aber heute
ihren Lohn nicht findet und nur Kärrnerarbeit be-
zahlt wird, kommen sie vor lauter Frohnarbeit nicht
zu sich selbst. Welcher Schaffende wüßte es nicht,
daß er, je höher er strebt, je Besseres er schafft,
desto weniger auf klingenden Lohn rechnen kann.
Hinabgezogen wird er auf die Straße, in den Rinn-
stein, durch den Zwang, Qeld zu verdienen. Sollten
wir nicht alles tun, um Palmen und Lorbeeren,
Ehrensold, Ehrenprämien, Ehrenpensionen auf Ta-
lente zu häufen? Haben wir den Stolz verlernt,
Mäzene zu sein? Die Ehre, einem Schaffenden eine
Stätte zu bereiten, wo er arbeiten kann? Die Ver-
pflichtung, es zu tun, wenn man mehr hat, als man
braucht und selbst nicht schaffen kann? Wenn
heute ein Schaffender protegiert und unterstützt
wird, kann man fast immer sagen: Cherchez la
femme. Ausgehalten werden ist freilich noch
schlimmer als zu hungern oder Frohnarbeit zu
leisten. Es ist richtig, daß die geborenen Qeistes-
fürsten so viel Stolz haben sollen, um „Unter-
stützungen“ zurückzuweisen — aber ein Ehrensold
vom Staate oder Landesfürsten, ein Unkostenbei-
trag für ein großes Werk, ein Ehrenhonorar, ein
Reisestipendium, das verletzt nicht den Stolz, es
hebt ihn. Ebenso ist es mit den Biographien und
Monographien, die nicht beeinflußt und nicht be-
zahlt dem Verdienste nachspüren.
Statt des Vergangenheits- und Totenkultus
müssen wir einen Kultus des Lebenden und der
Lebenden treiben, für die Zeugenden unserer Kunst
müssen wir Heimstätten schaffen. Wirklich — wie
wäre es mit Dichter- und Künstler-Heimstätten?
Vorausgesetzt, daß sie Freiheit ließen. Für die re-
produzierenden Schauspieler und Musiker gibt es
solche Heimstätten, nur nicht für die Schaffenden.
Wir haben den Tierschutz seit langen Jahren. Wir
haben seit junger Zeit den Naturschutz, Land-
schaftsschutz, Waldschutz, Denkmälerschutz und
Mutterschutz. Wollen wir nicht auch einmal an
Menschenschutz denken? An den Schutz der Schaf-
fenden?
Sühne
Von Oskar Baum
Im verzweifelten Zom, in der dunkeln Wut über
den Tod seines Weibes zog der edle Herr von
Armpach mit dem Rotbart gegen Rom. Sein ein-
ziges, den kleinen Ulmar, ließ er seinem Vetter
auf Qallersberg. Für immer, wie es sich dann ergab.
_ Der Junge hatte frauenhafte Augen und Haar
von mattgoldener Seide. Aber er lief, sprang, focht
und ritt so viel und wild wie alle, bekam wuchtige
Knochen und trank bald mannhaft wie des Papstes
Kellermeister am Sonntag.
Da wurde der Vetter des lärmenden Qastes satt,
der mit allen Freunden Händel hatte und auch zur
Brutzeit hinter dem Wild her war, und wenn der
Gallersberg selber vor Aerger geborsten wäre.
„Zeit ist, daß du dich um Armpach kümmerst,
Ulmar! Die Nachbarn wollen sich darein teilen
und es wäre schade dmm.“
Aber Ulmarn gefiel es hier, und ihm graute
vor den verrosteten Felsennestem, wo sicher die
Keller leer waren und die Bauern das Gehorchen
vergessen hatten. Er fing an, sich mit Vetters
Hilde zu vertragen. Mit der zwölfjährigen Hilde,
die leise und gut war und das ganze Schloß regierte,
weil sie zu jedem demütig sprach, so daß sich alle
sputeten, zu erraten und zu tun, was sie sich wün-
schen könnte.
Er ließ sich an einem Seil in den tiefen Teid
um einen Ball für sie heraufzuholen, und er tauschi
sich für ein heiliges Amulet, das ihm vom Vate
geblieben war, ein goldgewirktes Tuch ein, wö
es ihr bei einer Freundin gefallen hatte.
Das Ende von der Sache war, daß der Vette
sich zufrieden gab; die beiden miteinander vef
lobte und dem Junker zusagte, sie werde sein Qe
mahl, wenn er in vier oder fünf Jahren als Hef 1
auf wohlversehenem Erbe sie zu holen käme.
* *
%
Viel blutige Arbeit fand er wohl, aber seilj
Vetter hatte ihm einen tüchtigen Haufen eisemel
Knechte mitgegeben, und einige schwächere Nach'
barn boten ihm Freundeshilfe.
Hart und lange war eigentlich nur die Fehdd
mit dem Pellsteiner. Sein Weib, hieß es, wollW
nicht nachgeben; sein schönes Weib, von dem sC
kitzliche Geschichten umgingen. Ganz weiß und
biegsam wie Kirschblütenzweige im Wind waref
ihre Glieder und ihre Haut war so heiß wie Eisef
unterm Schleifstein. Einen, der die Mauer hinauf
kletterte und durch die Spalten im Fensterladef
zusah, wie sie zu Bette stieg, ließ sie ins Verlief
werfen, und Nacht für Nacht mußte man ihn ar
ihr Bett fesseln. Der Pellsteiner, ihr Mann, zo£
eine krause Stirn; aber sie zuckte mit den Schul-
tern, und er schwieg. Der junge Waffenknechl
stand Nacht für Nacht von abend bis früh an ihi
Bett gefesselt, bis er von Sinnen kam und einmal
beim Losschnallen mit allen Vieren ausschlug,
Schaum vor seinem Munde floß und seine Zähne
sich festbissen in die Holzlehne des Bettes; die
Nägel aber krallte er sich ins Fleisch und entmannte
sich mit den eigenen Fingern. Es wäre vielleicht
mit klugen Verhandlungen alles beigelegt worden, j
aber Ulmar fühlte sich als der Stärkere, und es
freute ihn, mit seinem raufhistigen Fähnlein die
Burg zu berennen. So ein wildes Weib, und jetzt
zitterte sie vor ihm.
Lange Wochen berannte man umsonst. Vielj
junges Blut spritzte gegen Fels und Mauer. End-
lich konnte man mit dem Hunger in der Feste
rechnen. Ein gerüstetes Pferd und ein Kettenhemd
versprach Ulmar dem, der die Pellsteinerin wohl-
behalten gefangen brächte.
Eines Nachts, als unverhofft das Feuer aUs defl i
Burgfenstern schlug und Ulmars Leute zu leichtef
Arbeit aus dem Schlaf weckte, verdiente einer defl
Preis. Den Pellsteiner hatten die eigenen Leute
erschlagen, weil sein Weib sich mit dem Mehl die
Wangen weißte, das er ihnen vom Munde absparte.
* * - I
*
Zwei Knappen ritten zum Hofe herein, vom
Huf bis zur Sturmhaube weißgrau von Reisestaub
und müde; sonst aber jung und stattlich, und mit i
Wämsern in gleichem Rot. Ulmar lehnte am weiß-
blühenden Lindenbaum beim Brunnen und befahl
den Knechten, welche die vom Winter gerissenefl
Sprünge und Löcher in der Burgmauer mit Stein
und Lehm flickten.
„Vom edlen Herrn zu Gallersberg Gruß und
Brief.“
Der Armpacher wurde glutrot vor Freude.
„Wie? Der Vetter? Lebt er noch? Wie geht es
ihm und den andern allen ? Was macht der Raben-
egg, der zornige Kerl mit der Judennase? Erzählt
mir doch! Seid Ihr schon lange in der Gegend
dort ?“
Die Knappen erzählten ehrerbietig, was sie
wußten; darunter, daß der Vetter todesmatt von
einer bösen Krankheit sei. Der Teufel würge ihn
von Zeit zu Zeit, daß er zu ersticken glaube, und
der Junker Rolf kam vom Königshof aus Prag,
sein Erbland zu wahren und dem Vater die Augen
zuzudrücken.
„Jetzt ist er vielleicht nicht mehr“, murmelte
Ulmar und blickte finster vor Schmerz.
„Wir sollen auf Antwort warten, weil es Eile
hat.“
Der Armpacher las das Stück Pergament, das
nicht verschlossen war, weil es kein Geistlicher
brachte und kein gelehrter Ritter, der es hätte lesen
können. Er atmete mühsam, reckte sich aber
stählern und wandte den Kopf ein paar Augen-
blicke zur Kemenate der Pellsteinerin hinauf. Dann
holte er einiges allte Frauengeschmeide von seiner
seligen Mutter oder vielleicht schon von der Ahne
und Iieß Rolf bitten, ihm Hilde, seine Braut, mit
ritterlichem Geleit zu senden. Er würde ihr auf
140
Von Heinrich Pudor
Bekanntlich gehen nicht nur die Krebse riick-
wärts, sondern die Blicke der heutigen Kulturwelt
sind sogar vorzugsweise nach rückwärts gerichtet.
Die Techniker, die Männer der Erfindungen, die Zep-
pelin und B16riot, vor allem der unvergeßliche Lilien-
thal blickten vorwärts und suchten das Land der Zu-
kunft. Aber die Vertreter der geistigen Kultur
treiben einen regelrechten Vergangenheitskultus.
Einmal in der Form der historischen Forschung und
Wissenschaft, die nicht oder viel zu wenig ihrem
eigentlichen Zwecke, dem Verständnis der Qegen-
wart und Zukunft zu dienen, nutzbar gemacht wird.
Sie will um ihrer selbst willen bestehen, und zwar
schon auf den Schulen — hier vorzugsweise als
Kriegsgeschichte. Der geistige Blick des Volkes
wendet sich in unorganischer und unfruchtbarer
Weise rückwärts. Und nicht nur innerhalb der
historischen Zunft, sondern auf vielen Qebieten auch
allgemein im Leben. Die Kultusstätten dieses
Kulturunfuges sind die Museen, — aber mehr und
mehr in das Werktagleben frißt er sich ein: junge
Leute, die heiraten und sich einrichten, kaufen alter-
tümliche Möbel und Porzellane, alte Stiche und Ra-
dierungen und Qemälde, statt produktiv sich selbst
ins Land der Zukunft zu wagen und zum mindesten
für die Produktion der Besten ihrer Zeit das regste
Interesse zu haben. Dem Schaffenden unserer Zeit
und unserer Heimat verekeln wir das Leben, ver-
sagen wir die Anerkennung und warten, bis er ge-
storben ist — dann fallen wir wie die Wölfe über
den zurückgelassenen Proviant her, als ob wir jetzt
weder Furcht noch Brotneid mehr zu empfinden
brauchen, und sagen und schreiben und melden in
alle Welt: „ein Qroßer ist gestorben — wir haben
viei verloren“. Und nun kommen die Hyänen des
Schlachtfeldes und entreißen den Hinterbliebenen
die zurückgelassenen Manuskripte oder Zeich-
nungen oder Qemälde und wetteifern, den besten
Nekrolog zu schreiben. Denn der Qroße ist jetzt
tot, also unschädlich, und die Konkurrenz hat nichts
mehr von ihm zu fürchten. Im Qegenteil, er ist nun
der Geschichte eingegliedert, und der historische
Fruchtacker, auf dem man sein Korn und seine
Kartoffeln bauen kann, ist wieder um ein
kleines Stück vergrößert worden. Ist es nicht
ekelhaft und widerlich, dieses Treiben, dieses
Stehen und Stoßen auf dem Friedhof, dieses Fest-
reden und Feiern am Qrabe, dieses In-den-Himmel-
heben? Fatal und peinlich wird die Sache dadurch
noch, daß nach dem Tode sehr häufig die öffent-
liche Meinung ins entgegengesetzte Extrem verfällt
und einen Kleinen für groß und einen Qroßen für
ein riesenhaftes Qenie ausposaunt. Bei einem wirk-
lich Qroßen vermag sie selbst am offenen Qrabe
den Brotneid noch nicht zu unterdrücken, und es
dauert oft Jahre und Jahrzehnte, ehe die kleinen
Forscher und Alltagskrüppel zugeben, daß da und
dann ein Qenie verblutet ist. Wie hat man
Nietzsche bei seinen Lebzeiten behandelt! In der
Malerei und in den anderen freien Künsten ver-
hält es sich ebenso.
Aber das Beklagenswerte ist, daß wir den Sinn
und das Verständnis für produktive Werte verloren
haben, daß auf der einen Seite nur technische, auf
der anderen nur reproduktive oder distributive
Werte gewürdigt werden. Die Ueberschätzung des
Technischen wurde schon erwähnt. Qegen die
Ueberschätzung des Reproduktiven bin ich seit Jahr-
zehnten zu Felde gezogen; in der Tat, wir Ieben in
eir.em reproduktiven Zeitaiter. Die Ueberschätzung
des Distributiven aber, also der Verteilung ge-
gebener Werte seitens des Handels habe ich in jüng-
ster Zeit zum Ziel meiner Arbeit gemacht; sie zeigt
sich in charakteristischer Weise, daß wir gemeinhin
Handel und Industrie zusammenwerfen, als ob sie
wesensgleich, nicht aber wesensentgegengesetzt
wären. Der Deutsche aber ist seinem innersten
Wesen nach produktiv veranlagt, und Deutschland
muß infolgedessen zu dem Lande der (Iandwirt-
schaftlichen und industriellen) Produktion par
excellence gemacht werden, während heute der
Handel das große Wort führt.
Auch deshalb sollten wir statt Nekrologe der
Ausgebluteten und Ausgeatmeten Prologe der
Lebenden schreiben. Kultus der Lebenden, der
Schaffenden unter den Lebenden sollten wir treiben!
So lange noch Zeit ist, soliten wir den um ihr Schaf-
fensheil Bangenden Mut zusprechen, ihnen Stim-
mung machen, ihnen freie Bahn schaffen und
ihnen von dem Erfolg, der Wunden heilt
und Saatkörner künftigen Werken legt, so viel
als möglich rechtzeitig gönnen und geben! Er-
folge können zwar auch berauschen und die Selbst-
kritik lähmen, aber der nicht auszurottende Kon-
kurrenzneid sorgt schon dafür, daß die Erfolge nicht
in den Himmel wachsen. Ich kenne nur ein Land,
das seinen Dichtern bei Lebzeit und Schaffenszeit
Pensionen aussetzt; das ist Schweden, dieses Land
der Zukunft. In Deutschland hörte ich noch nicht
davon, daß der Kaiser oder der König oder der Staat
oder die Kommune einem Schaffenden eine ein-
malige oder eine regelmäßige Prämie zugebilligt
hätte, damit er der Sorge um das tägliche Brot ent-
rissen wäre. Die meisten Schaffenden müssen für
sich und die Ihrigen den Platz für das Bett und den
Herd erkämpfen. Weil schaffende Arbeit aber heute
ihren Lohn nicht findet und nur Kärrnerarbeit be-
zahlt wird, kommen sie vor lauter Frohnarbeit nicht
zu sich selbst. Welcher Schaffende wüßte es nicht,
daß er, je höher er strebt, je Besseres er schafft,
desto weniger auf klingenden Lohn rechnen kann.
Hinabgezogen wird er auf die Straße, in den Rinn-
stein, durch den Zwang, Qeld zu verdienen. Sollten
wir nicht alles tun, um Palmen und Lorbeeren,
Ehrensold, Ehrenprämien, Ehrenpensionen auf Ta-
lente zu häufen? Haben wir den Stolz verlernt,
Mäzene zu sein? Die Ehre, einem Schaffenden eine
Stätte zu bereiten, wo er arbeiten kann? Die Ver-
pflichtung, es zu tun, wenn man mehr hat, als man
braucht und selbst nicht schaffen kann? Wenn
heute ein Schaffender protegiert und unterstützt
wird, kann man fast immer sagen: Cherchez la
femme. Ausgehalten werden ist freilich noch
schlimmer als zu hungern oder Frohnarbeit zu
leisten. Es ist richtig, daß die geborenen Qeistes-
fürsten so viel Stolz haben sollen, um „Unter-
stützungen“ zurückzuweisen — aber ein Ehrensold
vom Staate oder Landesfürsten, ein Unkostenbei-
trag für ein großes Werk, ein Ehrenhonorar, ein
Reisestipendium, das verletzt nicht den Stolz, es
hebt ihn. Ebenso ist es mit den Biographien und
Monographien, die nicht beeinflußt und nicht be-
zahlt dem Verdienste nachspüren.
Statt des Vergangenheits- und Totenkultus
müssen wir einen Kultus des Lebenden und der
Lebenden treiben, für die Zeugenden unserer Kunst
müssen wir Heimstätten schaffen. Wirklich — wie
wäre es mit Dichter- und Künstler-Heimstätten?
Vorausgesetzt, daß sie Freiheit ließen. Für die re-
produzierenden Schauspieler und Musiker gibt es
solche Heimstätten, nur nicht für die Schaffenden.
Wir haben den Tierschutz seit langen Jahren. Wir
haben seit junger Zeit den Naturschutz, Land-
schaftsschutz, Waldschutz, Denkmälerschutz und
Mutterschutz. Wollen wir nicht auch einmal an
Menschenschutz denken? An den Schutz der Schaf-
fenden?
Sühne
Von Oskar Baum
Im verzweifelten Zom, in der dunkeln Wut über
den Tod seines Weibes zog der edle Herr von
Armpach mit dem Rotbart gegen Rom. Sein ein-
ziges, den kleinen Ulmar, ließ er seinem Vetter
auf Qallersberg. Für immer, wie es sich dann ergab.
_ Der Junge hatte frauenhafte Augen und Haar
von mattgoldener Seide. Aber er lief, sprang, focht
und ritt so viel und wild wie alle, bekam wuchtige
Knochen und trank bald mannhaft wie des Papstes
Kellermeister am Sonntag.
Da wurde der Vetter des lärmenden Qastes satt,
der mit allen Freunden Händel hatte und auch zur
Brutzeit hinter dem Wild her war, und wenn der
Gallersberg selber vor Aerger geborsten wäre.
„Zeit ist, daß du dich um Armpach kümmerst,
Ulmar! Die Nachbarn wollen sich darein teilen
und es wäre schade dmm.“
Aber Ulmarn gefiel es hier, und ihm graute
vor den verrosteten Felsennestem, wo sicher die
Keller leer waren und die Bauern das Gehorchen
vergessen hatten. Er fing an, sich mit Vetters
Hilde zu vertragen. Mit der zwölfjährigen Hilde,
die leise und gut war und das ganze Schloß regierte,
weil sie zu jedem demütig sprach, so daß sich alle
sputeten, zu erraten und zu tun, was sie sich wün-
schen könnte.
Er ließ sich an einem Seil in den tiefen Teid
um einen Ball für sie heraufzuholen, und er tauschi
sich für ein heiliges Amulet, das ihm vom Vate
geblieben war, ein goldgewirktes Tuch ein, wö
es ihr bei einer Freundin gefallen hatte.
Das Ende von der Sache war, daß der Vette
sich zufrieden gab; die beiden miteinander vef
lobte und dem Junker zusagte, sie werde sein Qe
mahl, wenn er in vier oder fünf Jahren als Hef 1
auf wohlversehenem Erbe sie zu holen käme.
* *
%
Viel blutige Arbeit fand er wohl, aber seilj
Vetter hatte ihm einen tüchtigen Haufen eisemel
Knechte mitgegeben, und einige schwächere Nach'
barn boten ihm Freundeshilfe.
Hart und lange war eigentlich nur die Fehdd
mit dem Pellsteiner. Sein Weib, hieß es, wollW
nicht nachgeben; sein schönes Weib, von dem sC
kitzliche Geschichten umgingen. Ganz weiß und
biegsam wie Kirschblütenzweige im Wind waref
ihre Glieder und ihre Haut war so heiß wie Eisef
unterm Schleifstein. Einen, der die Mauer hinauf
kletterte und durch die Spalten im Fensterladef
zusah, wie sie zu Bette stieg, ließ sie ins Verlief
werfen, und Nacht für Nacht mußte man ihn ar
ihr Bett fesseln. Der Pellsteiner, ihr Mann, zo£
eine krause Stirn; aber sie zuckte mit den Schul-
tern, und er schwieg. Der junge Waffenknechl
stand Nacht für Nacht von abend bis früh an ihi
Bett gefesselt, bis er von Sinnen kam und einmal
beim Losschnallen mit allen Vieren ausschlug,
Schaum vor seinem Munde floß und seine Zähne
sich festbissen in die Holzlehne des Bettes; die
Nägel aber krallte er sich ins Fleisch und entmannte
sich mit den eigenen Fingern. Es wäre vielleicht
mit klugen Verhandlungen alles beigelegt worden, j
aber Ulmar fühlte sich als der Stärkere, und es
freute ihn, mit seinem raufhistigen Fähnlein die
Burg zu berennen. So ein wildes Weib, und jetzt
zitterte sie vor ihm.
Lange Wochen berannte man umsonst. Vielj
junges Blut spritzte gegen Fels und Mauer. End-
lich konnte man mit dem Hunger in der Feste
rechnen. Ein gerüstetes Pferd und ein Kettenhemd
versprach Ulmar dem, der die Pellsteinerin wohl-
behalten gefangen brächte.
Eines Nachts, als unverhofft das Feuer aUs defl i
Burgfenstern schlug und Ulmars Leute zu leichtef
Arbeit aus dem Schlaf weckte, verdiente einer defl
Preis. Den Pellsteiner hatten die eigenen Leute
erschlagen, weil sein Weib sich mit dem Mehl die
Wangen weißte, das er ihnen vom Munde absparte.
* * - I
*
Zwei Knappen ritten zum Hofe herein, vom
Huf bis zur Sturmhaube weißgrau von Reisestaub
und müde; sonst aber jung und stattlich, und mit i
Wämsern in gleichem Rot. Ulmar lehnte am weiß-
blühenden Lindenbaum beim Brunnen und befahl
den Knechten, welche die vom Winter gerissenefl
Sprünge und Löcher in der Burgmauer mit Stein
und Lehm flickten.
„Vom edlen Herrn zu Gallersberg Gruß und
Brief.“
Der Armpacher wurde glutrot vor Freude.
„Wie? Der Vetter? Lebt er noch? Wie geht es
ihm und den andern allen ? Was macht der Raben-
egg, der zornige Kerl mit der Judennase? Erzählt
mir doch! Seid Ihr schon lange in der Gegend
dort ?“
Die Knappen erzählten ehrerbietig, was sie
wußten; darunter, daß der Vetter todesmatt von
einer bösen Krankheit sei. Der Teufel würge ihn
von Zeit zu Zeit, daß er zu ersticken glaube, und
der Junker Rolf kam vom Königshof aus Prag,
sein Erbland zu wahren und dem Vater die Augen
zuzudrücken.
„Jetzt ist er vielleicht nicht mehr“, murmelte
Ulmar und blickte finster vor Schmerz.
„Wir sollen auf Antwort warten, weil es Eile
hat.“
Der Armpacher las das Stück Pergament, das
nicht verschlossen war, weil es kein Geistlicher
brachte und kein gelehrter Ritter, der es hätte lesen
können. Er atmete mühsam, reckte sich aber
stählern und wandte den Kopf ein paar Augen-
blicke zur Kemenate der Pellsteinerin hinauf. Dann
holte er einiges allte Frauengeschmeide von seiner
seligen Mutter oder vielleicht schon von der Ahne
und Iieß Rolf bitten, ihm Hilde, seine Braut, mit
ritterlichem Geleit zu senden. Er würde ihr auf
140