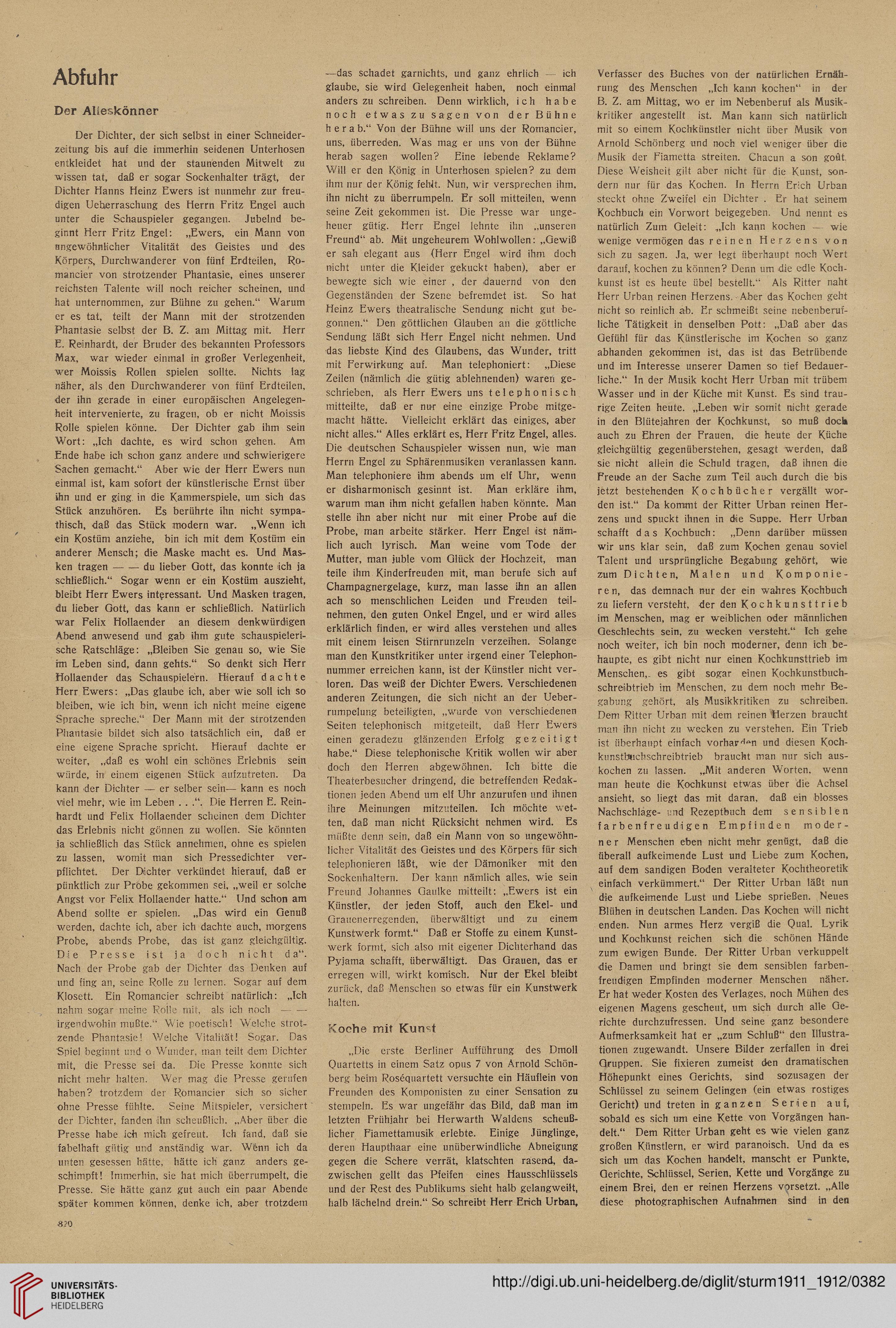Abfuhr
Der AUeskönner
Der Dichter, der sich selbst in einer Schneider-
zeitung bis auf die immerhin seidenen Unterhosen
entkleidet hat und der staunenden Mitwelt zu
wissen tat, daß er sogar Sockenhalter trägt, der
Dichter Hanns Heinz Ewers ist nunmehr zur freu-
digen Ueherraschung des Herrn Fritz Engei auch
unter die Schauspieler gegangen. Jubelnd be-
ginnt Herr Fritz Engel: „Ewers, ein Mann von
nngewöhnlicher Vitalität des Geistes und des
Körpers, Durchwanderer von fünf Erdteilen, Ro-
mancier von strotzender Phantasie, eines unserer
reichsten Talente will noch reicher scheinen, und
hat unternommen, zur Bühne zu gehen.“ Warum
er es tat, teilt der Mann mit der strotzenden
Phantasie selbst der B. Z. am Mittag mit. Herr
E. Reinhardt, der Bruder des bekannten Professors
Max, war wieder einmal in großer Veriegenheit,
wer Moissis Rollen spielen sollte. Nichts lag
näher, als den Durchwanderer von fiinf Erdteilen,
der ihn gerade in einer europäischen Angelegen-
heit intervenierte, zu fragen, ob er nicht Moissis
Rolle spieien könne. Der Dichter gab ihm sein
Wort: „Ich dachte, es wird schon gehen. Am
Ende habe ich schon ganz andere und schwierigere
Sachen gemacht.“ Aber wie der Herr Ewers nun
einmal ist, kam sofort der künstierische Ernst über
ihn und er ging in die Kammerspiele, uin sich das
Stück anzuhören. Es berührte ihn nicht sympa-
thisch, daß das Stück modern war. „Wenn ich
ein Kostüm anziehe, bin ich mit dem Kostüm ein
anderer Mensch; die Maske macht es. Und Mas-
ken tragen — — du iieber Gott, das konnte ich ja
schließlich.“ Sogar wenn er ein Kostüm auszieht,
bleibt Herr Ewers int^ressant. Und Masken tragen,
du lieber Gott, das kann er schließlich. Natüriich
war Felix Hollaender an diesem denkwürdigen
Abend anwesend und gab ihm gute schauspieleri-
sche Ratschläge: „Bleiben Sie genau so, wie Sie
im Leben sind, dann gehts.“ So denkt sich Herr
Hollaender das Schauspielern. Hierauf dachte
Herr Ewers: „Das glaube ich, aber wie soli ich so
bleiben, wie ich bin, wenn ich nicht meine eigene
Sprache spreche.“ Der Mann mit der strotzenden
Phantasie bildet sich also tatsächlich ein, daß er
eine eigene Sprache spricht. Hierauf dachte er
weiter, „daß es wohl ein schönes Erlebnis sein
wiirde, in einem eigenen Stück aufzutreten. Da
kann der Dichter — er selber sein— kann es noch
viiel mehr, wie itn Leben . . .“. Die Herren E. Rein-
hardt und Felix Hoilaender scheinen dem Dichter
das Erlebnis nicht gönnen zu wollen. Sie könnten
ja schließlich das Stück annehmen, ohne es spielen
zu lassen, womit man sich Pressedichter ver-
pflichtet. Der Dichter verkündet hierauf, daß er
pünktlich zur Pröbe gekommen sei, „weil er solche
Angst vor Felix Hollaender hatte.“ Und schon am
Abend sollte er spielen. „Das wird ein Genuß
werden, dachte ich, aber ich dachte auch, morgens
Probe, abends Probe, das ist ganz gieichgiiltig.
Die Presse ist ia doch nicht d a“.
Nach der Probe gab der Dichter das Deuken auf
und fing an, seine Rolle zu lernen. Sogar auf dem
Kiosett. Ein Romancier schreibt natürlich: „Ich
nahm sogar meine Rolle mit, als ich noch-
irgendwohin mußte.“ Wie poetisch! Welche strot-
zende Phantasie! V/elche Vitalität! Sogar. Das
Sniel beginnt und o Wunder, man teilt dem Dichter
mit, die Presse sei da. Die Presse konnte sich
nicht mehr halten. Wer mag die Presse gerufen
haben? trotzdem der Romancier sich so sicher
ohne Presse fühlte. Seine Mitspieier, versichert
der Dichter, fanden ihn scheußlich. „Aber über dic
Presse habe ich mich gefreut. Ich fand, daß sie
fabelhaft giitig und anständig war. W6nn ich da
unten gesessen hätte, hätte ich ganz anders ge-
schimpft! Immerhin, sie hat mich überrumpelt, die
Presse. Sie hätte ganz gut auch ein paar Abende
später kommen können, denke ich, aber trotzdem
—das schadet garnichts, und ganz ehrlich — ich
glaube, sie wird Gelegenheit haben, noch einmal
anders zu schreiben. Denn wirklich, i c h h a b e
noch etwas zu sagen von der Bühne
h e r a b.“ Von der Bühne wili uns der Romanoier,
uns, iiberreden. Was mag er uns von der Bühne
herab sagen wollen? Eine lebende Reklame?
Will er den König in Unterhosen spielen? zu dem
ihm nur der König fehit. Nun, wir versprechen ihm,
ihn nicht zu überrumpeln. Er soll mitteilen, wenn
seine Zeit gekommen ist. Die Presse war unge-
heuer gütig. Herr Engel lehnte ihn „unseren
Freund“ ab. Mit ungeheurem Wohlwollen: „Gewiß
er sah elegant aus (Herr Engel wird ihm doch
nicht unter die Kleider gekuckt haben), aber er
bewegte sich v/ie einer , der dauernd von den
Gegenständen der Szene befrerndet ist. So hat
Heinz Ewers theatralische Sendung nicht gut be-
gonnen.“ Den göttlichen Glauben an die göttliche
Sendung läßt sich Herr Engel nicht nehmen. Und
das liebste Kind des Glaubens, das Wunder, tritt
mit Ferwirkung auf. Man telephoniert: „Diese
Zeilen (nämlich die gütig abiehnenden) wareri ge-
schrieben, als Herr Ewers uns telephonisch
mitteilte, daß er nur eine einzige Probe mitge-
macht hätte. Vielleicht erklärt das einiges, aber
nicht alles.“ Alles erklärt es, Herr Fritz Engel, alles.
Die deutschen Schauspieler wissen nun, wie man
Herrn Engel zu Sphärenmusiken veranlassen kann.
Man telephoniere ihm abends um elf Uhr, wenn
er disharmonisch gesinnt ist. Man erkläre ihm,
warum man ihm nicht gefallen haben könnte. Man
stelle ihn aber nicht nur mit einer Probe auf die
Probe, man arbeite stärker. Herr Engel ist näm-
lich auch lyrisch. Man weine vom Tode der
Mutter, man juble vom Glück der Hochzeit, man
teile ihm Kinderfreuden mit, man berufe sich auf
Champagnergelage, kurz, man lasse ihn an ailen
ach so menschlichen Leiden und Freuden teil-
nehmen, den guten Onkel Engel, und er wird alles
erklärlich finden, er wird alles verstehen und alles
mit einem leisen Stirnrunzein verzeihen. Solange
man den Kunstkritiker unter irgend einer Telephon-
nummer erreichen kann, ist der Künstler nicht ver-
loren. Das weiß der Dichter Ewers. Verschiedenen
anderen Zeitungen, die sich nicht an der Ueber-
rumpelung beteiiigten, „wurde von verschiedenen
Seiten teiephonisch mitgeteilt, daß Herr Ewers
einen geradezu glänzenden Erfoig g e z e i t i g t
habe.“ Diese telephonische Kritik wolien wir aber
doch den Herren abgewöhnen. Ich bitte die
Theaterbesucher dringend, die betreffenden Redak-
tior.en jeden Abend um elf Uhr anzurufen und ihnen
ihre Meinungen mitzuteilen. Ich möchte wet-
ten, daß man nicht Rücksicht nehmen wird. Es
miißte denn sein, daß ein Mann von so ungewöhn-
licher Vitalität des Geistes und des Körpers für sich
telephonieren läßt, wie der Dämoniker mit den
Sockenhaltern. Der kann nämlich alles, wie sein
Freund Johannes Gaulke mitteilt: „Ewers ist ein
Künstler, der jeden Stoff, auch den Ekel- und
Grauenerregenden, überwältigt und zu einem
Kunstwerk formt.“ Daß er Stoffe zu einem Kunst-
werk formt, sich also mit eigener Dichterhand das
Pyjama schafft, überwältigt. Das Grauen, das er
erregen wili, wirkt komisch. Nur der Ekel bleibt
zurück, daß A'ienschcn so etwas für ein Kunstwerk
Iialten.
Koche rnit Kunst
„Die erste Berliner Aufführung des Dmoll
Quartetts in einem Satz opus 7 von Arnold Schön-
berg beim Rosequartett versuchte ein Häuflein von
Freunden des Komponisten zu einer Sensation zu
stempeln. Es war ungefähr das Bild, daß man im
letzten Friihjahr bei Herwarth Waldens scheuß-
licher Fiamettamusik erlebte. Einige Jünglinge,
deren Haupthaar eine unüberwindliche Abneigung
gegen die Schere verrät, klatschten rasend, da-
zwischen gellt das Pfeifen eines Hausschlüssels
und der Rest des Publikums sieht halb gelangweiit,
halb lächelnd drein.“ So schreibt Herr Erich Urban,
Verfasser des Buches von der natürlichen Ernäh-
rung des Menschen „Ich kann kochen“ in der
B. Z. am Mittag, wo er im Nebenberuf als Musik-
kritiker angestellt ist. Man kann sich natürlich
mit so einem Kochkiinstler nicht über Musik von
Arnoid Schönberg und noch viei weniger iiber die
Musik der Fiametta streiten. Chacun a son goüt.
Diese Weisheit gilt aber nicht für die Kunst, son-
dern nur für das Kochen. In Herrn Erich Urban
steckt ohne Zweifel ein Dichter . Er hat seinem
Kochbuch ein Vorwort beigegeben. Und nennt es
natürlich Zum Geieit: ,,Ich kann kochen — wie
wenige vermögen das reinen Herzens von
sich zu sagen. Ja, wer legt überhaupt noch Wert
darauf, kochen zu können? Denn um die odle Koch-
kunst ist es heute übel besteilt.“ Ais Ritter naht
Herr Urban reinen Herzens. Aber das Kochen geht
nicht so reinlich ab. Er schmeißt seine nebenberuf-
liche Tätigkeit in denselben Pott: „Daß aber das
Gefühl fiir das Künstlerische im Kochen so ganz
abhanden gekommen ist, das ist das Betrübende
und im Interesse unserer Damen so tief Bedauer-
lichc.“ In der Musik kocht Herr Urban mit trübem
Wasser und in der Küche mit Kunst. Es sind trau-
rige Zeiten heute. „Leben wir somit niicht gerade
in den Biütejahren der Kochkunst, so muß docli
auch zu Ehren der Frauen, die heute der Küche
gleichgiiltig gegenüberstehen, gesagt werden, daß
sie nicht allein die Schuld tragen, daß ihnen diie
Frende an der Sache zum Teil auch durch die bis
jetzt bestehenden Kochbücher vergällt wor-
den ist.“ Da kommt der Ritter Urban reinen Her-
zens und spuckt ihnen in die Suppe. Herr Urban
schafft d a s Kochbuch: „Denn darüber müssen
wir uns klar sein, daß zum Kochen genau soviel
Taient und ursprüngliche Begabung gehört, wie
zum Dichten, Malen und Komponie-
r e n, das demnach nur der ein wahres Kochbuch
zu liefern versteht, der den Kochkunsttrieb
im Menschen, mag er weiblichen oder männlichen
Geschlechts sein, zu wecken versteht.“ Ich gehe
noch weiter, ich bin noch moderner, denn ich be-
haupte, es gibt nicht nur einen Kochkunsttrieb im
Menschen,. es gibt sogar einen Kochkunstbuch-
schreibtrieb im Menschen, zu dem noch mehr Be-
gabung gehört, als Musikkritiken zu schreiben.
Dem Rittcr Urban mit dem reinen Herzen braucht
man ihn nicht zu wecken zu verstehen. Ein Trieb
ist iiberhaupt einfach vorhaHmi und diesen Koch-
kunstbnchschreibtrieb braucht man nur sich aus-
kochen zu lassen. „Mit anderen Worten, wenn
man heute die Kochkunst etwas über die Achsel
ansieht, so liegt das mit daran, daß ein blosses
Nachschlage- und Rezeptbuch dem s e n s i b 1 e n
farbenfreudigen Empfinden moder-
n e r Menschen eben nicht mehr genügt, daß die
überall aufkeimende Lust und Liebe zum Kochen,
auf dem sandigen Boden veralteter Kochtheoretik
einfach verkümmert.“ Der Ritter Urban läßt nun
die aufkeimende Lust und Liebe sprießen. Neues
Bliihen in deutschen Landen. Das Kochen will nicht
enden. Nun armes Herz vergiß die Qual. Lyrik
und Kochkunst reichen sich die schönen Hände
zum ewigen Bunde. Der Ritter Urban verkuppelt
die Damen und bringt sie dem sensiblen farben-
fretidigen Empfinden moderner Menschen näher.
Er hat weder Kosten des Verlages, noch Mühen des
eigenen Magens gescheut, um sich durch alle Ge-
richte durchzufressen. Und seine ganz besondere
Aufmerksamkeit hat er „zum Schluß“ den Illustra-
tionen zugewandt. Unsere Biider zerfallen in drei
Gruppen. Sie fixieren zumeist den dramatischen
Höhepunkt eines Gerichts, sind sozusagen der
Schliissel zu seinem Gelingen (ein etwas rostiges
Gericht) und treten inganzen Serien auf,
sobald es sich um eine Kette von Vorgängen han-
delt.“ Dem Ritter Urban geht es wie vielen ganz
großen Künstlern, er wird paranoisch. Und da es
sich um das Kochen handelt, manscht er Punkte,
Gerichte. Schliissel, Serien, Kette und Vorgänge zu
einem Brei, den er reinen Herzens vorsetzt. „Alle
diese photographischen Aufnahmen sind in den
Der AUeskönner
Der Dichter, der sich selbst in einer Schneider-
zeitung bis auf die immerhin seidenen Unterhosen
entkleidet hat und der staunenden Mitwelt zu
wissen tat, daß er sogar Sockenhalter trägt, der
Dichter Hanns Heinz Ewers ist nunmehr zur freu-
digen Ueherraschung des Herrn Fritz Engei auch
unter die Schauspieler gegangen. Jubelnd be-
ginnt Herr Fritz Engel: „Ewers, ein Mann von
nngewöhnlicher Vitalität des Geistes und des
Körpers, Durchwanderer von fünf Erdteilen, Ro-
mancier von strotzender Phantasie, eines unserer
reichsten Talente will noch reicher scheinen, und
hat unternommen, zur Bühne zu gehen.“ Warum
er es tat, teilt der Mann mit der strotzenden
Phantasie selbst der B. Z. am Mittag mit. Herr
E. Reinhardt, der Bruder des bekannten Professors
Max, war wieder einmal in großer Veriegenheit,
wer Moissis Rollen spielen sollte. Nichts lag
näher, als den Durchwanderer von fiinf Erdteilen,
der ihn gerade in einer europäischen Angelegen-
heit intervenierte, zu fragen, ob er nicht Moissis
Rolle spieien könne. Der Dichter gab ihm sein
Wort: „Ich dachte, es wird schon gehen. Am
Ende habe ich schon ganz andere und schwierigere
Sachen gemacht.“ Aber wie der Herr Ewers nun
einmal ist, kam sofort der künstierische Ernst über
ihn und er ging in die Kammerspiele, uin sich das
Stück anzuhören. Es berührte ihn nicht sympa-
thisch, daß das Stück modern war. „Wenn ich
ein Kostüm anziehe, bin ich mit dem Kostüm ein
anderer Mensch; die Maske macht es. Und Mas-
ken tragen — — du iieber Gott, das konnte ich ja
schließlich.“ Sogar wenn er ein Kostüm auszieht,
bleibt Herr Ewers int^ressant. Und Masken tragen,
du lieber Gott, das kann er schließlich. Natüriich
war Felix Hollaender an diesem denkwürdigen
Abend anwesend und gab ihm gute schauspieleri-
sche Ratschläge: „Bleiben Sie genau so, wie Sie
im Leben sind, dann gehts.“ So denkt sich Herr
Hollaender das Schauspielern. Hierauf dachte
Herr Ewers: „Das glaube ich, aber wie soli ich so
bleiben, wie ich bin, wenn ich nicht meine eigene
Sprache spreche.“ Der Mann mit der strotzenden
Phantasie bildet sich also tatsächlich ein, daß er
eine eigene Sprache spricht. Hierauf dachte er
weiter, „daß es wohl ein schönes Erlebnis sein
wiirde, in einem eigenen Stück aufzutreten. Da
kann der Dichter — er selber sein— kann es noch
viiel mehr, wie itn Leben . . .“. Die Herren E. Rein-
hardt und Felix Hoilaender scheinen dem Dichter
das Erlebnis nicht gönnen zu wollen. Sie könnten
ja schließlich das Stück annehmen, ohne es spielen
zu lassen, womit man sich Pressedichter ver-
pflichtet. Der Dichter verkündet hierauf, daß er
pünktlich zur Pröbe gekommen sei, „weil er solche
Angst vor Felix Hollaender hatte.“ Und schon am
Abend sollte er spielen. „Das wird ein Genuß
werden, dachte ich, aber ich dachte auch, morgens
Probe, abends Probe, das ist ganz gieichgiiltig.
Die Presse ist ia doch nicht d a“.
Nach der Probe gab der Dichter das Deuken auf
und fing an, seine Rolle zu lernen. Sogar auf dem
Kiosett. Ein Romancier schreibt natürlich: „Ich
nahm sogar meine Rolle mit, als ich noch-
irgendwohin mußte.“ Wie poetisch! Welche strot-
zende Phantasie! V/elche Vitalität! Sogar. Das
Sniel beginnt und o Wunder, man teilt dem Dichter
mit, die Presse sei da. Die Presse konnte sich
nicht mehr halten. Wer mag die Presse gerufen
haben? trotzdem der Romancier sich so sicher
ohne Presse fühlte. Seine Mitspieier, versichert
der Dichter, fanden ihn scheußlich. „Aber über dic
Presse habe ich mich gefreut. Ich fand, daß sie
fabelhaft giitig und anständig war. W6nn ich da
unten gesessen hätte, hätte ich ganz anders ge-
schimpft! Immerhin, sie hat mich überrumpelt, die
Presse. Sie hätte ganz gut auch ein paar Abende
später kommen können, denke ich, aber trotzdem
—das schadet garnichts, und ganz ehrlich — ich
glaube, sie wird Gelegenheit haben, noch einmal
anders zu schreiben. Denn wirklich, i c h h a b e
noch etwas zu sagen von der Bühne
h e r a b.“ Von der Bühne wili uns der Romanoier,
uns, iiberreden. Was mag er uns von der Bühne
herab sagen wollen? Eine lebende Reklame?
Will er den König in Unterhosen spielen? zu dem
ihm nur der König fehit. Nun, wir versprechen ihm,
ihn nicht zu überrumpeln. Er soll mitteilen, wenn
seine Zeit gekommen ist. Die Presse war unge-
heuer gütig. Herr Engel lehnte ihn „unseren
Freund“ ab. Mit ungeheurem Wohlwollen: „Gewiß
er sah elegant aus (Herr Engel wird ihm doch
nicht unter die Kleider gekuckt haben), aber er
bewegte sich v/ie einer , der dauernd von den
Gegenständen der Szene befrerndet ist. So hat
Heinz Ewers theatralische Sendung nicht gut be-
gonnen.“ Den göttlichen Glauben an die göttliche
Sendung läßt sich Herr Engel nicht nehmen. Und
das liebste Kind des Glaubens, das Wunder, tritt
mit Ferwirkung auf. Man telephoniert: „Diese
Zeilen (nämlich die gütig abiehnenden) wareri ge-
schrieben, als Herr Ewers uns telephonisch
mitteilte, daß er nur eine einzige Probe mitge-
macht hätte. Vielleicht erklärt das einiges, aber
nicht alles.“ Alles erklärt es, Herr Fritz Engel, alles.
Die deutschen Schauspieler wissen nun, wie man
Herrn Engel zu Sphärenmusiken veranlassen kann.
Man telephoniere ihm abends um elf Uhr, wenn
er disharmonisch gesinnt ist. Man erkläre ihm,
warum man ihm nicht gefallen haben könnte. Man
stelle ihn aber nicht nur mit einer Probe auf die
Probe, man arbeite stärker. Herr Engel ist näm-
lich auch lyrisch. Man weine vom Tode der
Mutter, man juble vom Glück der Hochzeit, man
teile ihm Kinderfreuden mit, man berufe sich auf
Champagnergelage, kurz, man lasse ihn an ailen
ach so menschlichen Leiden und Freuden teil-
nehmen, den guten Onkel Engel, und er wird alles
erklärlich finden, er wird alles verstehen und alles
mit einem leisen Stirnrunzein verzeihen. Solange
man den Kunstkritiker unter irgend einer Telephon-
nummer erreichen kann, ist der Künstler nicht ver-
loren. Das weiß der Dichter Ewers. Verschiedenen
anderen Zeitungen, die sich nicht an der Ueber-
rumpelung beteiiigten, „wurde von verschiedenen
Seiten teiephonisch mitgeteilt, daß Herr Ewers
einen geradezu glänzenden Erfoig g e z e i t i g t
habe.“ Diese telephonische Kritik wolien wir aber
doch den Herren abgewöhnen. Ich bitte die
Theaterbesucher dringend, die betreffenden Redak-
tior.en jeden Abend um elf Uhr anzurufen und ihnen
ihre Meinungen mitzuteilen. Ich möchte wet-
ten, daß man nicht Rücksicht nehmen wird. Es
miißte denn sein, daß ein Mann von so ungewöhn-
licher Vitalität des Geistes und des Körpers für sich
telephonieren läßt, wie der Dämoniker mit den
Sockenhaltern. Der kann nämlich alles, wie sein
Freund Johannes Gaulke mitteilt: „Ewers ist ein
Künstler, der jeden Stoff, auch den Ekel- und
Grauenerregenden, überwältigt und zu einem
Kunstwerk formt.“ Daß er Stoffe zu einem Kunst-
werk formt, sich also mit eigener Dichterhand das
Pyjama schafft, überwältigt. Das Grauen, das er
erregen wili, wirkt komisch. Nur der Ekel bleibt
zurück, daß A'ienschcn so etwas für ein Kunstwerk
Iialten.
Koche rnit Kunst
„Die erste Berliner Aufführung des Dmoll
Quartetts in einem Satz opus 7 von Arnold Schön-
berg beim Rosequartett versuchte ein Häuflein von
Freunden des Komponisten zu einer Sensation zu
stempeln. Es war ungefähr das Bild, daß man im
letzten Friihjahr bei Herwarth Waldens scheuß-
licher Fiamettamusik erlebte. Einige Jünglinge,
deren Haupthaar eine unüberwindliche Abneigung
gegen die Schere verrät, klatschten rasend, da-
zwischen gellt das Pfeifen eines Hausschlüssels
und der Rest des Publikums sieht halb gelangweiit,
halb lächelnd drein.“ So schreibt Herr Erich Urban,
Verfasser des Buches von der natürlichen Ernäh-
rung des Menschen „Ich kann kochen“ in der
B. Z. am Mittag, wo er im Nebenberuf als Musik-
kritiker angestellt ist. Man kann sich natürlich
mit so einem Kochkiinstler nicht über Musik von
Arnoid Schönberg und noch viei weniger iiber die
Musik der Fiametta streiten. Chacun a son goüt.
Diese Weisheit gilt aber nicht für die Kunst, son-
dern nur für das Kochen. In Herrn Erich Urban
steckt ohne Zweifel ein Dichter . Er hat seinem
Kochbuch ein Vorwort beigegeben. Und nennt es
natürlich Zum Geieit: ,,Ich kann kochen — wie
wenige vermögen das reinen Herzens von
sich zu sagen. Ja, wer legt überhaupt noch Wert
darauf, kochen zu können? Denn um die odle Koch-
kunst ist es heute übel besteilt.“ Ais Ritter naht
Herr Urban reinen Herzens. Aber das Kochen geht
nicht so reinlich ab. Er schmeißt seine nebenberuf-
liche Tätigkeit in denselben Pott: „Daß aber das
Gefühl fiir das Künstlerische im Kochen so ganz
abhanden gekommen ist, das ist das Betrübende
und im Interesse unserer Damen so tief Bedauer-
lichc.“ In der Musik kocht Herr Urban mit trübem
Wasser und in der Küche mit Kunst. Es sind trau-
rige Zeiten heute. „Leben wir somit niicht gerade
in den Biütejahren der Kochkunst, so muß docli
auch zu Ehren der Frauen, die heute der Küche
gleichgiiltig gegenüberstehen, gesagt werden, daß
sie nicht allein die Schuld tragen, daß ihnen diie
Frende an der Sache zum Teil auch durch die bis
jetzt bestehenden Kochbücher vergällt wor-
den ist.“ Da kommt der Ritter Urban reinen Her-
zens und spuckt ihnen in die Suppe. Herr Urban
schafft d a s Kochbuch: „Denn darüber müssen
wir uns klar sein, daß zum Kochen genau soviel
Taient und ursprüngliche Begabung gehört, wie
zum Dichten, Malen und Komponie-
r e n, das demnach nur der ein wahres Kochbuch
zu liefern versteht, der den Kochkunsttrieb
im Menschen, mag er weiblichen oder männlichen
Geschlechts sein, zu wecken versteht.“ Ich gehe
noch weiter, ich bin noch moderner, denn ich be-
haupte, es gibt nicht nur einen Kochkunsttrieb im
Menschen,. es gibt sogar einen Kochkunstbuch-
schreibtrieb im Menschen, zu dem noch mehr Be-
gabung gehört, als Musikkritiken zu schreiben.
Dem Rittcr Urban mit dem reinen Herzen braucht
man ihn nicht zu wecken zu verstehen. Ein Trieb
ist iiberhaupt einfach vorhaHmi und diesen Koch-
kunstbnchschreibtrieb braucht man nur sich aus-
kochen zu lassen. „Mit anderen Worten, wenn
man heute die Kochkunst etwas über die Achsel
ansieht, so liegt das mit daran, daß ein blosses
Nachschlage- und Rezeptbuch dem s e n s i b 1 e n
farbenfreudigen Empfinden moder-
n e r Menschen eben nicht mehr genügt, daß die
überall aufkeimende Lust und Liebe zum Kochen,
auf dem sandigen Boden veralteter Kochtheoretik
einfach verkümmert.“ Der Ritter Urban läßt nun
die aufkeimende Lust und Liebe sprießen. Neues
Bliihen in deutschen Landen. Das Kochen will nicht
enden. Nun armes Herz vergiß die Qual. Lyrik
und Kochkunst reichen sich die schönen Hände
zum ewigen Bunde. Der Ritter Urban verkuppelt
die Damen und bringt sie dem sensiblen farben-
fretidigen Empfinden moderner Menschen näher.
Er hat weder Kosten des Verlages, noch Mühen des
eigenen Magens gescheut, um sich durch alle Ge-
richte durchzufressen. Und seine ganz besondere
Aufmerksamkeit hat er „zum Schluß“ den Illustra-
tionen zugewandt. Unsere Biider zerfallen in drei
Gruppen. Sie fixieren zumeist den dramatischen
Höhepunkt eines Gerichts, sind sozusagen der
Schliissel zu seinem Gelingen (ein etwas rostiges
Gericht) und treten inganzen Serien auf,
sobald es sich um eine Kette von Vorgängen han-
delt.“ Dem Ritter Urban geht es wie vielen ganz
großen Künstlern, er wird paranoisch. Und da es
sich um das Kochen handelt, manscht er Punkte,
Gerichte. Schliissel, Serien, Kette und Vorgänge zu
einem Brei, den er reinen Herzens vorsetzt. „Alle
diese photographischen Aufnahmen sind in den