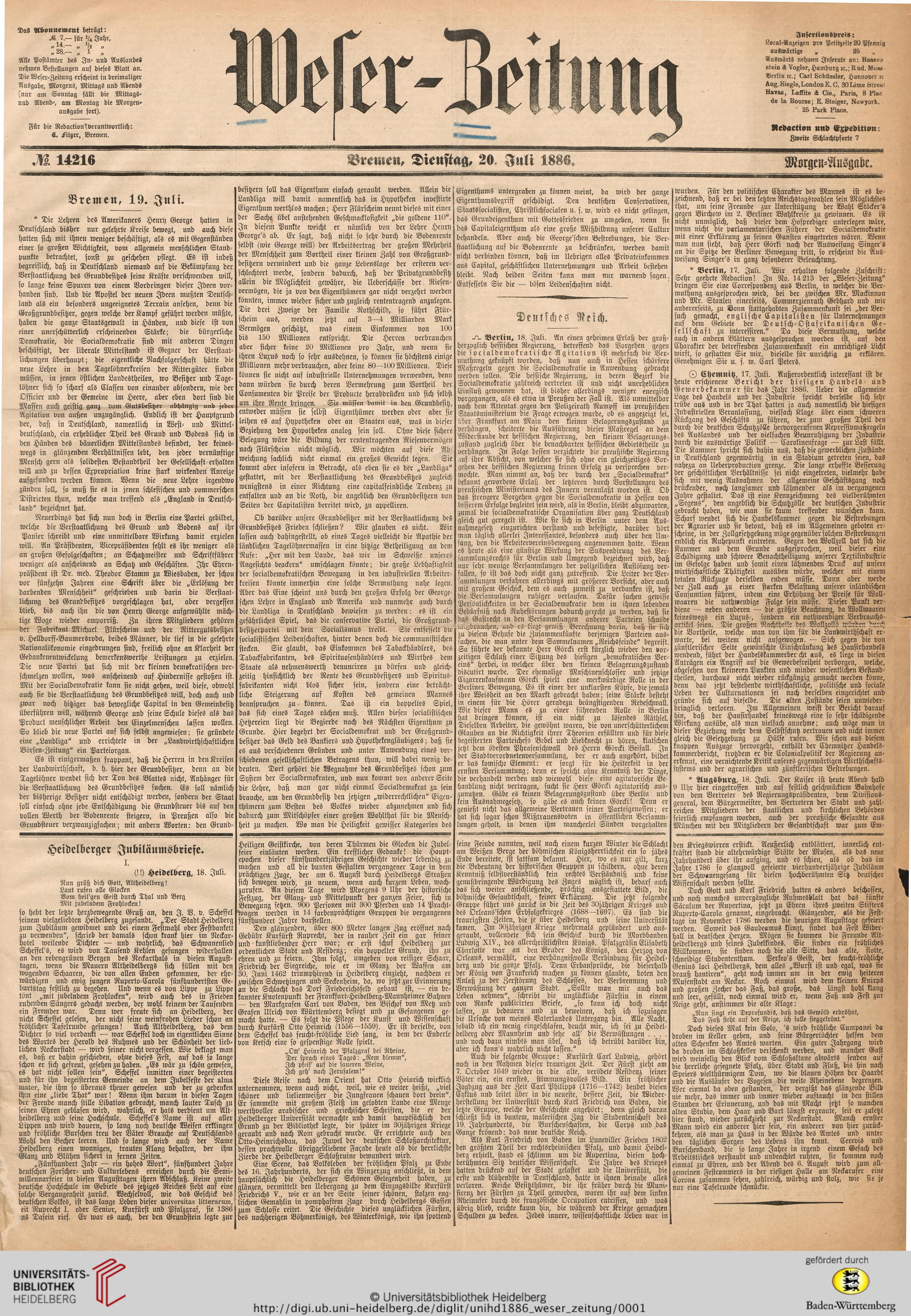DaS Abonnernent beträgt:
^ für ^4 Jahr,
^ " 'i "
,, 2o. ,, ^ ,,
Alle Postämter des Jn- und AuslandeS
nehmen Bestellungen auf dicfes Blatt an.
Die Weser-Zeitung erfcheint in dreimaliger
Ausgabe, Morgens, Mittags und Abends
snur am Sonntag fällt die Mittags-
und Abend-, am Montag die Morgen-
ausgabe fort).
Für die Redaction'verantwortlich:
L. Fitger, Bremen.
>»>1I»I»»»»^»WWM»»W»WWW»»WWW
M 14216
«W»»»W»»»»W^W»W»»»I»»»»W»»^»
Jnsertionspreis:
Local-Bnzeigen pro Petitzeile 20 Pfennig
auswärtige » 25 ,
Auswärts nehmen Jnferate an: ksaeos
stoin L Vogler, Hamburg rc>: kncl. l8v»s
Berlin rc.; llarl Loküselsr, Hannover rc
Ln^. 8iez!s,b.ouäoo L. 6. 30Iäme «rrss'
üavss, I.sll,te L 6ie., ksris, 8 tllsa
äs I» konrse; C. Ltsigsr, bisvxork.
25 ksrk klave.
Redaetton und Sxpeditton:
Zweite Schlachtpforte 7
Morgen-Ausgabe.
Bremen, 19. Juli.
* Die Lehren des Amerikaners Henry George hatten in
Deutschland bisher nur gelehrte Kreise bewegt, und auch diese
hatten sich mit ihnen weniger beschäftigt, als es mit Gegenständen
einer so großen Wichtigkeit, vom allgemein menschlichen Stand-
punkte betrachtet, sonst zu geschehen Pflegt. Es ist indeß
begreiflich, daß in Deutschland niemand auf die Bekümpfung der
Verstaatlichung des Grundbesitzes seine Kräfte verschwenden will,
so lange keine Spuren von einem Vordringen dieser Jdeen vor-
handen sind. Und die Apostel der neuen Jdeen mußten Deutsch-
land als ein besonders ungeeignetes Terrain ansehen, denn die
Großgrundbesitzer, gegen welche der Kampf geführt werden müßte,
haben die ganze Staatsgewalt in Händen, und diese ist von
einer unerschütterlich erscheinenden Stärke; die bürgerliche
Demokratie, die Socialdemokratie sind mit anderen Dingen
heschäftigt, der liberale Mittelstand ist Gegner der Verstaat-
lichungen überhaupt; die eigentliche Nachfolgerschaft hätte die
neue Lehre in den Tagelöhnerkreisen der Rittergüter finden
müssen, in jenen östlichen Landestheilen, wo Besitzer und Tage-
löhner sich so scharf als Classen von einander absondern, wie der
Officier und der Gemeine im Heere, aber eben dort sind die
Massen ÜUch geistig ganz vom Gutsbesitzer abhängig und jeder
Agitation von außen unzugänglich. Endlich ist der Hauptgrund
der, daß in Deutschland, namentlich in West- und Mittel-
deutschland, ein erheblicher Theil des Grund und Bodens sich in
den Händen des bäuerlichen Mittelstandes befindet, der keines-
wegs in glänzenden Verhältnissen lebt, den jeder vernünftige
Mensch gern als solidesten Bestandtheil der Gesellschaft erhalten
will und zu dessen Expropriation keine stark wirkenden Anreize
aufgefunden werden können. Wenn die neue Lehre irgendwo
zünden soll, so muß sie es in jenen schlesischen und pommerschen
Districten thun, welche man treffend als „England in Deutsch-
land" bezeichnet hat.
Neuerdings hat sich nun doch in Berlin eine Partei gebildet,
welche die Verstaatlichung des Grund und Bodens auf ihr
Panier schreibt und eine unmittelbare Wirkung damit erziclen
will. An Präsidentcn, Vicepräsidenten fehlt es ihr weniger als
an großen Gefolgeschaften; an Schatzmeister und Schriftführer
weniger als anscheinend an Schatz und Geschäften. Jhr Ehren-
präsident ist Dr. med. Theodor Stamm zu Wiesbaden, der schon
vor fünfzehn Jahren eine Schrift über die „Erlösung der
darbenden Menschheit" geschrieben und darin die Berstaat-
lichung des Grundbesitzes vorgeschlagen hat, aber vergessen
blieb, bis auch ihn die von Henry George aufgewühlte mäch-
tige Woge wieder emporriß. Zu ihren Mitgliedern gehören
der Fabrikant Michael Flürscheim und der Rittergutsbesitzer
v. Helldorff-Baumersroda, beides Männer, die tief in die gelehrte
Nationalökonomie eingedrungen sind, freilich ohne an Klarheit der
Gedankenentwickelung bemerkenswerthe Leistungen zu erzielen.
Die neue Partei hat sich mit der kleinen demokratischen ver-
schmelzen wollen, was anscheinend auf Hindernisse gestoßen ist.
Mit der Socialdemokratie kann sie nicht gehen, weil diese, obwohl
auch sie die Verstaatlichung des Grundbesitzes will, doch auch und
zwar noch hitziger das bewegliche Capital in den Gemeinbesitz
überführen will, während George und seine Schule dieses als das
Product menschlicher Arbeit den Einzelmenschen lassen wollen.
So blieb die neue Partei auf sich selbst angewiesen; sie gründete
eine „Landliga" und errichtete in der „Landwirthschaftlichen
Börsen-Zeitung" ein Parteiorgan.
Es ist einigermaßen frappant, daß die Herren in den Kreisen
der Landwirthschaft, d. h. hier der Grundbesitzer, denn an die
Tagelöhner wendet sich der Ton des Blattes nicht, Anhänger für
die Verstaatlichung des Grundbesitzes suchen. Es soll nämlich
der bisherige Besitzer nicht entschädigt werden, sondern der Staat
soll einfach ohne jede Entschädigung die Grundsteuer bis auf den
vollen Werth der Bodenrente steigern, in Preußen also die
Grundsteuer verzwanzigfachen; mit andern Worten: den Grund-
Heidelberger Jubilänmsbriefe.
i.
(!!) Heidelberg, 18. Juli.
Nun grüß dich Gott, Altheidelberg!
Laut rusen alle Glocken
Vom heil'gen Geist durch Thal und Berg
Mit jubelndem Frohlocken!
so hebt der letzte herzbewegende Gruß an, den I. V. v. Scheffel
seinem vielgeliebten Heidelberg zugesandt. „Der Stadt Heidelberg
zum Jubiläum gewidmet und bei einem Festmahl oder Festbankett
zu verwenden", schrieb der damals schon krank hier im Neckar-
hotel weilende Dichter — und wahrlich, das Schwanenlied
Scheffel's, cs wird von Tausend Kehlen gesungen widerhallen
an den rebengrünen Bergen des Neckarthals in diesen August-
tagen, wenn die Mauern Altheidelbergs sich füllen mit den
wogenden Schaaren, die von allen Enden gekommen, der ehr-
würdigen und ewig jungen Ruperto-Carola fünfhundertsten Ge-
burtstag festlich zu begehen. Und wenn es von Lippe zu Lippe
tönt „mit jubelndem Frohlocken", wird auch des in Frieden
ruhenden Sängers gedacht werden, der wohl keinem der Tausenden
ein Fremder war. Denn wer freute sich au Heidelberg, der
nicht Scheffel gelesen, der nicht seine weinsrohen Lieder schon an
fröhlicher Tafelrunde gesungen! Auch Altheidelberg, das dem
Dichter so viel verdankt — war Scheffel doch im eigentlichen Sinne
des Wortes der Herold des Ruhmes und der Schönheit der lieb-
lichen Neckarstadt — wird seiner nicht vergessen. Wie beklagt man
es, daß er dahin geschieden, ohue dieses Fest, auf das so lange
schon er sich gefreut, gesehen zu haben. „Es wär zu schön gewesen,
es hat nicht sollen sein", Scheffel inmitten einer begeisterten
und für ihn begeisterten Gemeinde an dem Jubelfeste der alma
mator, die ihm so überaus theuer gewesen und der zu gedenken
ih.n eine „liebe That" war! Wenn ihm darum in diesen Tagen
dec Freude manch stille Libation gebracht, manch lauter Tusch zu
seinen Ehren geblasen wird, wahrlich, er hats verdient um Alt-
heidelberg und seine Hochschule. Scheffel's Name ist auf aller
Lippen und wird dauern, so lang noch deutsche Weisen erklingen
und fröhliche Burschen treu der Väter Brauche auf Deutschlands
Wohl den Becher leeren. Und so lange wird auch der Name
Heidelberg einen wonnigen, trauten Klang behalten, der ihm
Glanz und Blühen sichert in fernen Zeiten.
„Fünfhundert Jahr — ein hohes Wort", fünfhundert Jahre
deutschen Forscher- und Culturlebens erreichen durch die Semi-
millennarfeier in diesen Augusttagen ihren Abschluß. Keine zweite
deutsche Hochschule im Gebiete des jetziges Reiches sieht auf eine
solche Vergangenheit zurück. Wechselvoll, wie das Geschick des
deutschen Volkes, ist das lange Leben dieser umvorsitas littsrarum,
eit Ruprecht I. oder Senior, Kurfürst und Pfalzgraf, sie 1386
ns Dasein rief. Er war es auch, der den Grundstein legte zur
besitzern soll das Eigenthum einfach geraubt werden. Allein die
Landliga will damit namentlich das in Hypotheken investirte
Eigenthum werthlos machen; Herr Flürscheim nennt dieses mit einer
der Sache übel anstehendeü Geschmacklosigkeit „die goldene 110".
Jn diesem Punkte weicht er nämlich von der Lehre Henry
George's ab. Er sagt, daß nicht so sehr durch die Bodenrente
selbst (wie George will) der Arbeitsertrag der großen Mehrheit
der Menschheit zum Vortheil einer kleinen Zahl von Großgrund-
besitzern vcrmindert und die ganze Lebenslage der ersteren ver-
schlechtert werde, sondern dadurch, daß der Privatgrundbesitz
allein die Möglichkeit gewähre, die Ueberschüsse der Riesen-
vermögen, die ja von den Eigenthümern gar nicht verzehrt werden
könnten, immer wieder sicher und zugleich rententragend anzulegen.
Die drei Zweige der Familie Rothschild, so führt Flür-
scheim aus, werden jetzt auf 3—4 Milliarden Mark
Vermögen geschätzt, was einem Einkommen von 100
bis 150 Millionen entspricht. Die Herren verbrauchen
aber sicher keine 20 Millionen pro Jahr, und wenn sie
ihren Luxus noch so sehr ausdehnen, so können sie höchstens einige
Millionen mehr verbrauchen, aber keine 80—100 Millionen. Diese
können sie nicht auf industrielle Unternehmungen verwenden, denn
dann würden sie durch deren Vermehrung zum Vortheil der
Consumenten die Preise der Producte herabdrücken und sich selbst
um ihre Rente bringen. Sie müssen damit in den Grundbesitz,
entweder müssen sie selbst Eigenthümer werden oder aber sie
leihen cs auf Hypotheken oder an Staaten aus, was in dieser
Beziehung den Hypotheken analog sein soll. Ohne diese sichere
Belegung wäre die Bildung der rententragenden Riesenvermögen
nach Flürscheim nicht möglich. Wir möchten auf diese Ab
weichung sachlich nicht einmal ein großes Gewicht legen. Sie
kommt aber insofern in Betracht, als eben sie es der „Landliga"
gestattet, mit der Verstaatlichung des Grundbesitzes zugleich
wenigstens in einer Richtung eine capitalfeindliche Tendenz zu
entfalten und an die Noth, die angeblich den Grundbesitzern von
Seiten der Capitalisten bereitet wird, zu appelliren.
Ob darüber unsere Grundbesitzer mit der Verstaatlichung des
Grundbesitzes Frieden schließen? Wir glauben es nicht. Wir
lassen auch dahingestellt, ob eines Tages vielleicht die Apathie der
ländlichen Tagelöhnermassen in eine hitzige Betheiligung an dem
Rufe: „Her mit dem Lande, das wir im Schweiße unseres
Angesichts beackern" umschlagen könnte; die große Lebhaftigkeit
der socialdemokratischen Bewegung in den industriellen Arbeiter-
kreisen könnte immerhin eine solche Vermuthung nahe legcn.
Aber das Eine scheint uns durch den großen Erfolg der George-
schen Lehre in England und Amerika und nunmehr auch durch
die Landliga in Deutschland bewiesen zu werden: es ist ein
gefährliches Spiel, das die conservative Partei, die Großgrund-
besitzerpartei mit dem Socialismus treibt. Sie entfessetl die
socialistischen Leidenschaften, hinter denen doch die communistischen
stecken. Sie glaubt, das Einkommen des Tabackhändlers, des
Tabackfabrikanten, des Spirituosenhändlers und Wirthes dem
Staate als nehmenswerth denunciren zu dürfen und gleich-
zeitig hinsichtlich der Rente des Grundbesitzers und Spiritus-
fabrikanten nicht blos sicher sein, sondern eine beträcht-
liche Steigerung auf Kosten des gemeinen Mannes
beanspruchen zu können. Das ist ein doppeltes Spiel,
das sich eines Tages rächen muß. Allen diesen socialistischen
Hetzereien liegt die Begierde nach des Nächsten Eigenthum zu
Grunde. Hier begehrt der Socialdemokrat und der Großgrund-
besitzer das Geld des Bankiers und Hypothekengläubigers; daß sie
es aus verschiedenen Gründen und unter Anwendung eines ver-
schiedenen gesellschaftlichen Betragens thun, will dabei wenig be-
deuten. Dort gehört die Wegnahme des Grundbesitzcs schon zum
System der Socialdemokraten, und nun kommt von anderer Seite
die Lehre, daß man gar nicht einmal Socialdemokrat zu sein
brauche, um den Grundbesitz den jetzigen „widerrechtlichen" Eigen-
thümern zum Besten des Volkes wieder abzunehmen und sich
dadurch zum Mitschöpfer einer großen Wohlthat für die Mensch-
heit zu machen. Wo man die Heiligkeit gewisser Kategorien des
Heiligen Geistkirche, von deren Thürmen die Glocken die Jubel-
feier einläuten werden. Ein trefflicher Gedanke! die Haupt-
epochen dieser fünfhundertjährigen Geschichte wieder lebendig zu
machen und all die bunten Gestalten vergangener Tage in dem
prächtigen Zuge, der am 6. August durch Heidelbergs Straßen
sich bewegen wird, zu neuem, wenn auch kurzem Leben, wach-
zurufen. An diesem Tage wird Morgens 9 Uhr der historische
Festzug, der Glanz- und Mittelpunkt der ganzen Feier, sich in
Bewegung setzen. 900 Personen mit 300 Pferden und 14 Pracht-
wagen werden in 14 farbenprächtigen Gruppen die vergangenen
fünfhundert Jahre darstellen.
Den glänzenden, über 800 Meter langen Zug eröffnet nach
Gebühr Kurfürst Ruprccht, der in rauher Zeit em gar feiner
und kunstliebender Herr war; er erst schuf Heidelberg zur
ordentlichen Stadt und Residenz; ein doppelter Grund, ihn zn
ehren und zu feiern. Jhm folgt, umgeben von reisiger Schaar,
Friedrich der Siegrciche, wie er im Glanz der Waffen am
30. Juni 1462 triumphirend in Heidelberg einzieht, nachdem er
zwischen Schwetzingen und Seckenheim, da, wo jetzt zur Erinnerung
an die Schlacht das Dorf Friederichsfeld gebaut ist, — ein be-
kannter Knotenpunkt der Frankfurt-Heidelberg-Mannheimer Bahnen
— den Markgrafen Carl von Baden, den Bischof von Metz und
Grafen Ulrich von Württemberg besiegt und zu Gefangenen ge-
macht hatte. — Es folgt die Pflege der Kunst und Wissenschaft
durch Kurfürst Otto Heinrich (1556—1559). Er ist derselbe, von
dem Scheffel das feucht-fröhliche Lied sang, in dem der Enderle
von Ketsch eine so gespenstige Rolle spielt.
„Ott' Heinrich der Pfalzgraf bei Rheine,
Der sprach eines Tages: „Rem blemm",
Jch pfeif' auf die saueren Weine,
Jch geh' nach Jerusalem!"
Diese Reise nach dem Orient hat Otto Heinrich wirklich
unternommen, wenn auch nicht, weil, wie es weiter heißt, „viel
schöner und lielienweißer die Jungfrauen schauen dort drein".
Er sammelte mit großem Fleiß im gelobten Lande cine Menge
werthvoller arabischer und griechischer Schriften, die er der
Heidelberger Universität vermachte und damit hauptsächlich den
Grund zu der Bibliothek lcgte, die später im 30jährigen Kriege
geraubt und nach Rom gebracht wurde. Er errichtete auch den
Otto-Heinrichsbau, das Juwel der deutschen Schloßarchitektur,
deffen prachtvvlle übriggebliebene Faxade heute als die herrlichste
Zierde der Heidelberger Schloßruine bewundert wird.
Eine Scene, das Volksleben der fröhlichen Pfalz zu Ende
des 16. Jahrhunderts, der sich ein Winzerzug anschließt, in dem
hauptsächlich die Heidelberger Schönen Gelegenheit haben, zu
glänzen, vermittelt den Uebergang zu dem Einzugsbilde Kurfürst
Friedrichs V., wie er an der Seite seiner schönen, stolzen eng-
lischen Gemahlin in pomphaftem Zuge durch Heidelbergs Gassen
zum Schlosse reitet. Die Geschichte dieses unglücklichen Fürsten,
des nachherigen Böhmerkönigs, des Winterkönigs, wie ihn spottend
Eigenthums untergraben zu können meint, da wird der ganze
Eigenthumsbegriff geschädigt. Den deutschen Conservativen,
Staatssocialisten, Christlichsocialen u. s. w. wird es nicht gelingen,
das Grundeigenthum mit Gottesfrieden zu umgeben, wenn sie
das Capitaleigenthum als eine große Mißbildung unserer Cultur
behandeln. Aber auch die George'schen Bestrebungen, die Ver-
staatlichung auf die Bodenrente zu bcschränken, werden damit
nicht verbinden können, daß im Uebrigen alles Privateinkommen
aus Capital, geschäftlichen Unternehmungen und Arbeit bestehen
bleibt. Nach beiden Seiten kann man nur warnend sagen.
Entfesseln Sie die — bösen Leidenschaften nicht.
DenlscheS Neich.
ui. Bevlin, 18. Juli. An einen geheimen Erlaß der groß-
herzoglich hessischen Regierung, betreffend das Vorgehen gegen
die socialdemokratis che Agitation ist mehrfach die Ver-
muthung geknüpft worden, daß nun anch in Hessen schärfere
Maßregeln gegen die Socialdemokratie in Anwendnng gebracht
werden sollen. Die hessische Regierung, in deren Bezirk die
Socialdemokratie zahlreich vertreten ist und nicht unerheblichen
Einfluß gewonnen hat, ist bisher allerdings weniger energisch
vorgegangen, als es etwa in Preußen der Fall ist. Als unmittelbar
nach dem Attentat gegen dcn Polizeirath Rumpff im preußischen
Staatsministerium die Frage erwogen wurde, ob es angezeigt sei,
über Frankfurt am Main den kleinen Belagerungszustand zu
verhängen, scheiterte die Ausführung dieser Maßregel an dem
Widerstande der hessischen Regiernng, den kleinen Belagerungs-
zustand zugleich über die benachbarten hessischen Gebietstheile zu
verhängen. JN Folge dessen verzichtete die Preußische Regierung
auf ihre Absicht, von welcher sie sich ohne ein gleichzeitiges Vor-
geheu der hessischen Regierung keinen Erfolg zu versprechen ver-
mochte. Man nimmt an, daß der durch den „Socialdemokrat"
bekannt gewordene Erlaß der letzteren durch Vorstellungen des
preußischen Ministeriums des Jnnern veranlaßt worden ist. Ob
das strengere Vorgehen gegen die Socialdemokratie in Hessen von
besserem Erfolge begleitet sein wird, als in Berlin, bleibt abzuwarten,
zumal die socialdemokratische Organisation über ganz Deutschland
gleich gut geregelt ist. Wie sie sich in Berlin unter dem Aus-
nahmegesetz einzurichten verstand und befestigte, darüber hört
man täglich allerlei Jnteressantes, besonders auch über den Um-
fang, den die Arbeitervereinsbewegung angenommen hatte. Wcnn
es heute als cine günstige Wirkung der Suspendirung des Ver-
sammlungsrechts für Berlin und Umgegend bezeichnet wird, daß
nur sehr weuige Äersammlungen der polizeilichen Auflösung ver-
fallen, so ist das doch nicht ganz zutreffend. Die Lciter der Ver-
sammlnngen verfahren allerdings mit größerer Vorsicht, aber auch
mit großem Geschick, dem es a'uch zumeist zu verdanken ist, daß
die Versammlungen ruhiger verlaufen. Dafür suchen gewisse
Persönlichkeiten in der Socialdemokratie dem in ihnen lcbenden
Bcdürfniß nach Ruhestörungen dadurch gerecht zu werden, daß sie
das Gastrecht in den Versammlungen anöerer Parteien schnöde
i.i.ßbrauchen, uud es licgt gewiß Bercchnung darin, daß sie sich
zu diesem Behuse die Zusammenkünfte derjenigen Parteien aus-
suchen, die man unter dem Sammelnamen „Reichsfeinde" begreift.
So führte der bekannte Herr Görcki erst kürzlich wieder den vor-
zeitigen Schluß einer Sitzung des hiesigen „demokratischen Ver-
eins" herbei, in welcher über den kleinen BelagerungSzustand
discutirt wurde. Dcr ehemalige Maschinenschlosser und jetzige
Cigarrenkaufmann Görcki spielt eine merkwürdige Rolle in der
Berliner Bewegung. Es ist einer der unklarstcn Köpfe, die jemals
ihre Weisheit an den Markt gebracht haben; seine Stärke besteht
in einem sür 'die Hörer geradezu beängstigenden Redeschwall.
Wie dieser Mann es zu einer führenden Rolle in Berlin
hat bringen können, ist ein nicht zu lösendes Räthsel.
Dieselben Arbeiter, die gewöhnt waren, die von unerschütterlichem
Glanben an die Richtigkeit ihrer Theorieu erfüllten und sür diese
begeisterten Parteichefs Bebel und Liebknecht zu hören, klatschen
jetzt dem ödesten Phrasenschwall des Herrn Görcki Beifall. Jn
der Stadtverordnetenversammluug, der er auch angehört, bildet
er das komische Element: er sorgt für die Heiterkeit in der
ernsten Versammtung; denn er spricht ohne Kenntniß der Dinge,
die verhandelt werden und wiewohl diese eine agitatorische Be-
handlung nicht vertragen, sucht sie Herr Görcki agitatorisch aus-
zunutzen. Gäbe es keinen Belagerungszustand über Berlin und
kein Ausnahmegesetz, so gäbe es auch keinen Görcki! Denn er
genießt nicht das allgemeine Vertrauen seiner Parteigenossen; er
hat sich sogar schon Mißtrauensvoten in öffentlichen Versamm-
lungen geholt, in denen ihm mancherlei Sünden vorgehalten
seine Feinde nannten, weil nach einem kurzen Winter die Schlacht
am Weißen Berge der böhmischen Königsherrlichkeit ein so jähes
Ende bereitete, ist sattsam bekannt. Hier, wo es nur gilt, kurz
die Bedeutung der historischen Gruppen zu schildern, ohne deren
Kenntniß selbstverständlich kein rechtes Verständniß und keine
genußbringende Würdigung des Zuges möglich ist, bedarf auch
das sich weiter anschließende, Prächtig ausgestattete Bild, die
böhmische Gesandtschaft, > keiner Erklärung. Die jetzt folgende
Gruppe führt uns zurück in die Zeit des 30jährigen Krieges und
des Orleans'schen Erbfolgekrieges (1688—1697). Es sind die
traurigsten Zeiten, die je über Heidelberg und seine Universität
kameni Jm 30jährigen Kriege mehrmals geplündert und aus-
geraubt, vollendete sich sein Geschick durch die Mordbanden
Ludwig XIV., des allerchristlichsten Königs. Pfalzgräffn Elisabeth
Charlotte war an den Äruder des Königs, den Herzog von
Orleans, vermählt, einc verhängnißvolle Verbindung für Heidel-
berg und die ganze Pfalz. Denn Erbansprüche, die dieserhalb
der König von Frankreich machen zu können glaubte, boten den
Anlaß zu der Zerstörung des Schlosses, der Berbrennnng und
Verwüstung der ganzen Stadt. „Sollte man mir au'ch das
Leben nehmen", schreibt die unglückliche Fürstin in einem
von Ranke publicirten Briefe, „so kann ich doch nicht
lassen, zu bedauern und zu beweinen, daß ich sozusagen
die Ursache von meines Vaterlandes Untergang bin. Alle Nacht,
sobald ich ein wenig eingeschlafen, deucht mir, ich sei zu Heidel-
delberg oder Mannheim und sehe all' die Verwüstungen ....
und uoch dazu nimbts man ühel, daß ich betrübt darüber bin,
aber ich kann's wahrlich nicht lassen."
Auch die folgende Grnppe: Kurfürst Carl Ludwig, aehört
noch in den Rahmen dieser traurigen Zeit. Der Fürst zieht am
7. October 1649 wieder in die alte, verödete Residenz seiner
Väter ein, ein ernstes, stimmungsvolles Bild. Ein fröhlicher
Jagdzug aus der Zeit Carl Philipps (1716—1742) bendet diesen
Cyklus und leitet über in die neueste, bessere Zeit, die Wieder-
herstellung der Universität durch Karl Friedrich von Baden, die
letzte Gruppe, welche der Geschichte angehört; denn gleich daran
schließt sich in buntem, malerischen Zug die Studentenschaft des
19. Jahrhunderts, die Burschenschaften, die Corps und das
Ganze krönend: das neuc deutsche Reich.
Als Karl Friedrich von Äaden im Luneviller Frieden 1802
den größten Theil der rechtsrheinischen Pfalz, und damit Heidel-
berg erhielt, stand es schlimm um die Rupertina, diesen hoch-
berühmten Sitz deutscher Wissenschaft. Die Jahre des Krieges
hatten drückend auf der Stadt gelastet und die Universität, die
erste und blühendste in Deutschland, hatte in ihnen beinahe alles
verloren. Reiche Besitzthümer, die ihr früher durch die Muni-
ficenz der Fürsten zu Theil geworden, waren ihr aus dem linken
Rheinufer durch die französische Occupation entrissen, und was
übrig blieb, reichte kaum hin, die während der Kriege gemachten
Schulden zu decken. Jedes innere, wissenschaftliche Leben war in
wurden. Für den Politischen Charakter des Mannes ist es be-
zeichnend, daß er bei den letzten Reichstagswahlen sein Möglichstes
that, um seine Freunde zur Unterstütz'ung der Wahl Stöcker's
gegen Virchow im 2. Berliner Wahlkreise zu gewinnen. Es ist
nicht unmöglich, daß dieser dem Hofprediger unterlegen wäre,
wenn nicht die parlamentarischen Führer der Socialdemokratie
mit einer Erklärung zu seinen Gunsten eingetreten wären. Wenn
man nun sieht, daß Herr Görki nach der Ausweisung Singer's
an die Spitze dcr Berliner Bewegung tritt, so erscheint die Aus-
weisung Singer's in ganz besonderer Beleuchtung.
* Berlin, 17. Juli. Wir erhalten folgcnde Zuschrift:
Sehr geehrte Äedaction! Jn No. 14 213 der „Weser-Zeitung"
bringen Sie eine Correspondenz aus Berlin, in welcher die Ver-
muthung ausgesprochen wird, bei der zwischen Mr. Mackinnon
und Mr. Stanley einerseits, Commerzienrath Gebhard und mir
andererseits, zu Bonn stattgehabten Zusammenkunft sei „der Ver-
such gemacht, englischeCapitalisten für Unternehmungen
auf dem Gebiete der Deutsch-Ostafrikanischen Ge-
sellschaft zu interessiren." Da diese Vermuthung, welche
auch in andern Blättern ausgesprochen worden ist, auf den
Charakter der betreffenden Zusammenkunft ein unrichtiges Licht
wirft, so gestatten Sie mir, dieselbe für unrichtig zu erklären.
Genehmigen Sie u. s. w. Carl Peters.
(-) Chemnitz, 17. Juli. Außerordentlich interessant ist de
heute erschienene Bericht der hiesigen Handels- und
Gewerbekammer für das Jahr 1886. Neber die allgemeine
Lage des Handels und der Jndustrie spricht derselbe sich sehr
trübe aus und in der That hatten ja auch namentlich die hiesigen
Jndustriellen Veranlassung, vielfach Klage über einen schweren
Rückgang des Geschäfts zu führen, der zum großen Theil den
durch die deutschen Schutzzölle hervorgerufenen Repressivmaßregeln
des Auslandes und der vielfachen Beunruhigung der Jndustrie
durch die auswärtige Politik — Carolinenfrage — zur Last fällt.
Die Kammer spricht sich dahin aus, daß die gewerblichen Zustände
in Deutschland gegenwärtig in ein Stadium getreten seien, das
nahezu an Ueberproduction grenze. Die lange erhoffte Besserung
der geschäftlichen Verhältnisse sei nicht eingetreten, vielmehr habe
sich mit wenig Ausnahmen der allgemeine Geschäftsgang noch
drückender, nöch langsamer und lähmender als im vergangenen
Jahre gestaltet. Das ist eine Kennzeichnung des vielberühmten
„Segens", den angeblich die Schutzzölle der deutschen Jndustrie
gebracht haben, wie man sie kaum treffendcr wünschcn kann.
Scharf wendet sich die Handelskammer aegen die Bestrebungen
der Agrarier nnd sie betont, daß es im Allgemeinen geboten er-
scheine, in der Zollgesetzgebung möge gegenübersolchen Bestrebungsn
cndlich ein Ruhepunkt e'intreten. Gegen dcn Wollzoll hat sich die
Kammer aus dem Grunde ausgesprochen, weil dieser cine
Schädigung und schwere Benachtheiligung unserer Textilindustrie
im Gefolge haben und somit einen lähmenden Druck auf unsere
wirthschaftliche Thätigkeit ausüben würde, welcher mit einem
totalen Rückzuge derselben enden müffe. Dann aber werde
der Zoll auch zu einer starken Belastung unserer inländischen
Consumtion führen, indem eine Erhöhung der Preisc für Woll-
waaren die nothwendige Folge sein müsse. Dieser Punkt ver-
diene — ncben andcren — die größte Beachtung, da Wollwaarcn
keineswegs ein Luxus-, sondern ein nothwendiger Verbrauchs-
artikel seien. Die großen Nachtheile deS Wollzolls Würdsn dnrch
die Vortheile, welche man von ihm für die Landwirthschaft er-
warte, bei weitem nicht ausgewogcn. — Sich gegen die von
zünftlerischer Seite gewünschte Einschränkung des Hausirhandels
wendend, führt der Handelskammerber cht aus, es liege in diesen
Anträgen ein Angriff auf die Gewerbefreiheit verborgen, welche,
abgesehen von kleincren Punkten und minder wesentlichen Bestand-
theilen, durchaus nicht wieder rückgängig gemacht werden könne,
denn das jetzt bestehende wirthschaftliche, politische und sociale
Leben der Cülturnationen sei nach derselben eingerichtet und
gründe sich auf dieselbe. Die alten Zustände seicn unwieder-
bringlich verloren. Jm Allgemeinen wcist der Bericht darauf
hin, daß der Hausirhandcl keineswegs eine so sehr schädigende
Wirkung ausübe, als man vielfach annehme; auch möge man in
dieser Beziehung mehr dem Selbstschutz vertrauen und nicht immer
gleich die Gesetzgebung zu Hülfe rufen. Wie schon aus diesem
knappen Auszuge hervorgeht, enthält der Chemnitzer Handels-
kammerbericht, trotzdem er dic Colonialpolitik der Regierung an-
erkennt, eine vernichtende Kritik unseres gegenwärtigen Äirthschafts-
systems und der agrarischen und zünftlerischen Bestrebungen.
* Augsburg, 18. Juli. Der Kaiser ist heute Abend halb
9 Uhr hier eingetroffen und auf festlich geschmücktem Bahnhofe
von dem Vertreter des Regierungsprüsidenten, dem Divisions-
general, dem Bürgermeister, den Vertretern der Stadt und zahl
reichen Mitgliedern der staatlichen und kirchlichen Behörden
feierlich empfangen worden, auch der preußische Gesandte aus
München mit den Mitgliedern der Gesandtschaft war zum Em-
den Kriegswirren erstickt. Aeußerlich entblättert, innerlich ent-
kräftet stand die altehrwürdige Stätte der Musen, als das neue
Jahrhundert über ihr aufging, und es schien, als ob das im
Jahre 1786 so glanzvoll gefeierte vierhundertjährige Jubiläum
der Schwauengesang für diesen hochberühmten Sitz deutscher
Wissenschaft werden sollte.
Dvch Gott und Karl Friedrich hatten es anders beschossen,
und noch manches unvergängliche Rnhmesblatt hat das fünfte
Säculum der Rupertina, jetzt zu Ehren ihres zweiten Stifters
Ruperto-Carola genannt, eingebracht. Glänzender, als die Fest-
tage im November 1786 werden die heurigen Augusttage gefeiert
werden. Soweit das Gaudeamus klingt, sindet das Fest Wider-
hall in deutschen Herzen. Mögen sie kommen die Freunde Alt-
heidelbergs und seines Jubelkindes. Sie finden ein fröhliches
Willkomiiien, sie finden noch die alte Sitte, das alte, flotte,
schneidige Studententhum. Perkeo's Geist, der feucht-fröhliche
Genius loci Heidelbergs, dem alles „Wurst ist und egal, was sie
drauß hantiren", geht noch immer um in der ewig heiteren
Musenstadt am Neckar. Noch einmal wird dem kleinen Knirps
und großen Zecher das Faß, das große, das längst hohl klang
und leer, gefüllt, noch einmal wird er, wenn Faß und Fest zur
Neige geht, anstimmen die alte Klage:
„Nmi singt e-n Deprofmidis, daß daS Gewölb erdröhnt,
Das Faß steht auf der Neige, ich falle sieggekrönt."
Doch dieses Mal kein Solo, 's wird fröhliche Cumpanei da
droben im Keller geben, und feine Bürgertöchter helscn dem
alten Schenken des Amtes warten. Ein guter Jahrgang wird
da droben im Schloßkeller verschenkt werden, und mancher Gast
wird weinselig den Blick vom Schloßaltane abwärts senden auf
die herrliche gesegnete Pfalz, über Stadt und Fluß, bis hin nach
Speiers vielthürmigem Dom, wo die blauen Höhen dcr Haardt
und die Ausläufer der Vogesen die weite Rheinebene begrenzen.
Wer einmal da oben gestanden, der vergißt das glänzende Bild
nie mehr, das immer und immer wicder auftaucht in den stillen
Stunden der Erinnerung, und das mit Macht jetzt so manchen
alten Studio, dem Haar und Bart längst eraraute, seit er zuletzt
hier stand, wieder zurückzieht zur Neckarstadt. Manch ernster
Mann wird ein anderer hier sein, ein anderer von hier zurück-
kehren, als man zu Haus in der Würde des Amtes und unter
den täglichen Sorgen des Lebens ihn kennt. Cerevis und
Burschenband, die so langc Jahre in irgend einem Gefach des
Arbeitstisches verstaubt und unbeachtet rnhten, sie kommen noch
einmal zu Ehren, und der Abend des 6. August wird zum all-
gemeinen Festcommers in der riesigen Halle am Neckarufer eine
Corona zusammen sehen, zahlreich, würdig und stolz, wie sie je
nur eine Tafelrunde schmückte.
^ für ^4 Jahr,
^ " 'i "
,, 2o. ,, ^ ,,
Alle Postämter des Jn- und AuslandeS
nehmen Bestellungen auf dicfes Blatt an.
Die Weser-Zeitung erfcheint in dreimaliger
Ausgabe, Morgens, Mittags und Abends
snur am Sonntag fällt die Mittags-
und Abend-, am Montag die Morgen-
ausgabe fort).
Für die Redaction'verantwortlich:
L. Fitger, Bremen.
>»>1I»I»»»»^»WWM»»W»WWW»»WWW
M 14216
«W»»»W»»»»W^W»W»»»I»»»»W»»^»
Jnsertionspreis:
Local-Bnzeigen pro Petitzeile 20 Pfennig
auswärtige » 25 ,
Auswärts nehmen Jnferate an: ksaeos
stoin L Vogler, Hamburg rc>: kncl. l8v»s
Berlin rc.; llarl Loküselsr, Hannover rc
Ln^. 8iez!s,b.ouäoo L. 6. 30Iäme «rrss'
üavss, I.sll,te L 6ie., ksris, 8 tllsa
äs I» konrse; C. Ltsigsr, bisvxork.
25 ksrk klave.
Redaetton und Sxpeditton:
Zweite Schlachtpforte 7
Morgen-Ausgabe.
Bremen, 19. Juli.
* Die Lehren des Amerikaners Henry George hatten in
Deutschland bisher nur gelehrte Kreise bewegt, und auch diese
hatten sich mit ihnen weniger beschäftigt, als es mit Gegenständen
einer so großen Wichtigkeit, vom allgemein menschlichen Stand-
punkte betrachtet, sonst zu geschehen Pflegt. Es ist indeß
begreiflich, daß in Deutschland niemand auf die Bekümpfung der
Verstaatlichung des Grundbesitzes seine Kräfte verschwenden will,
so lange keine Spuren von einem Vordringen dieser Jdeen vor-
handen sind. Und die Apostel der neuen Jdeen mußten Deutsch-
land als ein besonders ungeeignetes Terrain ansehen, denn die
Großgrundbesitzer, gegen welche der Kampf geführt werden müßte,
haben die ganze Staatsgewalt in Händen, und diese ist von
einer unerschütterlich erscheinenden Stärke; die bürgerliche
Demokratie, die Socialdemokratie sind mit anderen Dingen
heschäftigt, der liberale Mittelstand ist Gegner der Verstaat-
lichungen überhaupt; die eigentliche Nachfolgerschaft hätte die
neue Lehre in den Tagelöhnerkreisen der Rittergüter finden
müssen, in jenen östlichen Landestheilen, wo Besitzer und Tage-
löhner sich so scharf als Classen von einander absondern, wie der
Officier und der Gemeine im Heere, aber eben dort sind die
Massen ÜUch geistig ganz vom Gutsbesitzer abhängig und jeder
Agitation von außen unzugänglich. Endlich ist der Hauptgrund
der, daß in Deutschland, namentlich in West- und Mittel-
deutschland, ein erheblicher Theil des Grund und Bodens sich in
den Händen des bäuerlichen Mittelstandes befindet, der keines-
wegs in glänzenden Verhältnissen lebt, den jeder vernünftige
Mensch gern als solidesten Bestandtheil der Gesellschaft erhalten
will und zu dessen Expropriation keine stark wirkenden Anreize
aufgefunden werden können. Wenn die neue Lehre irgendwo
zünden soll, so muß sie es in jenen schlesischen und pommerschen
Districten thun, welche man treffend als „England in Deutsch-
land" bezeichnet hat.
Neuerdings hat sich nun doch in Berlin eine Partei gebildet,
welche die Verstaatlichung des Grund und Bodens auf ihr
Panier schreibt und eine unmittelbare Wirkung damit erziclen
will. An Präsidentcn, Vicepräsidenten fehlt es ihr weniger als
an großen Gefolgeschaften; an Schatzmeister und Schriftführer
weniger als anscheinend an Schatz und Geschäften. Jhr Ehren-
präsident ist Dr. med. Theodor Stamm zu Wiesbaden, der schon
vor fünfzehn Jahren eine Schrift über die „Erlösung der
darbenden Menschheit" geschrieben und darin die Berstaat-
lichung des Grundbesitzes vorgeschlagen hat, aber vergessen
blieb, bis auch ihn die von Henry George aufgewühlte mäch-
tige Woge wieder emporriß. Zu ihren Mitgliedern gehören
der Fabrikant Michael Flürscheim und der Rittergutsbesitzer
v. Helldorff-Baumersroda, beides Männer, die tief in die gelehrte
Nationalökonomie eingedrungen sind, freilich ohne an Klarheit der
Gedankenentwickelung bemerkenswerthe Leistungen zu erzielen.
Die neue Partei hat sich mit der kleinen demokratischen ver-
schmelzen wollen, was anscheinend auf Hindernisse gestoßen ist.
Mit der Socialdemokratie kann sie nicht gehen, weil diese, obwohl
auch sie die Verstaatlichung des Grundbesitzes will, doch auch und
zwar noch hitziger das bewegliche Capital in den Gemeinbesitz
überführen will, während George und seine Schule dieses als das
Product menschlicher Arbeit den Einzelmenschen lassen wollen.
So blieb die neue Partei auf sich selbst angewiesen; sie gründete
eine „Landliga" und errichtete in der „Landwirthschaftlichen
Börsen-Zeitung" ein Parteiorgan.
Es ist einigermaßen frappant, daß die Herren in den Kreisen
der Landwirthschaft, d. h. hier der Grundbesitzer, denn an die
Tagelöhner wendet sich der Ton des Blattes nicht, Anhänger für
die Verstaatlichung des Grundbesitzes suchen. Es soll nämlich
der bisherige Besitzer nicht entschädigt werden, sondern der Staat
soll einfach ohne jede Entschädigung die Grundsteuer bis auf den
vollen Werth der Bodenrente steigern, in Preußen also die
Grundsteuer verzwanzigfachen; mit andern Worten: den Grund-
Heidelberger Jubilänmsbriefe.
i.
(!!) Heidelberg, 18. Juli.
Nun grüß dich Gott, Altheidelberg!
Laut rusen alle Glocken
Vom heil'gen Geist durch Thal und Berg
Mit jubelndem Frohlocken!
so hebt der letzte herzbewegende Gruß an, den I. V. v. Scheffel
seinem vielgeliebten Heidelberg zugesandt. „Der Stadt Heidelberg
zum Jubiläum gewidmet und bei einem Festmahl oder Festbankett
zu verwenden", schrieb der damals schon krank hier im Neckar-
hotel weilende Dichter — und wahrlich, das Schwanenlied
Scheffel's, cs wird von Tausend Kehlen gesungen widerhallen
an den rebengrünen Bergen des Neckarthals in diesen August-
tagen, wenn die Mauern Altheidelbergs sich füllen mit den
wogenden Schaaren, die von allen Enden gekommen, der ehr-
würdigen und ewig jungen Ruperto-Carola fünfhundertsten Ge-
burtstag festlich zu begehen. Und wenn es von Lippe zu Lippe
tönt „mit jubelndem Frohlocken", wird auch des in Frieden
ruhenden Sängers gedacht werden, der wohl keinem der Tausenden
ein Fremder war. Denn wer freute sich au Heidelberg, der
nicht Scheffel gelesen, der nicht seine weinsrohen Lieder schon an
fröhlicher Tafelrunde gesungen! Auch Altheidelberg, das dem
Dichter so viel verdankt — war Scheffel doch im eigentlichen Sinne
des Wortes der Herold des Ruhmes und der Schönheit der lieb-
lichen Neckarstadt — wird seiner nicht vergessen. Wie beklagt man
es, daß er dahin geschieden, ohue dieses Fest, auf das so lange
schon er sich gefreut, gesehen zu haben. „Es wär zu schön gewesen,
es hat nicht sollen sein", Scheffel inmitten einer begeisterten
und für ihn begeisterten Gemeinde an dem Jubelfeste der alma
mator, die ihm so überaus theuer gewesen und der zu gedenken
ih.n eine „liebe That" war! Wenn ihm darum in diesen Tagen
dec Freude manch stille Libation gebracht, manch lauter Tusch zu
seinen Ehren geblasen wird, wahrlich, er hats verdient um Alt-
heidelberg und seine Hochschule. Scheffel's Name ist auf aller
Lippen und wird dauern, so lang noch deutsche Weisen erklingen
und fröhliche Burschen treu der Väter Brauche auf Deutschlands
Wohl den Becher leeren. Und so lange wird auch der Name
Heidelberg einen wonnigen, trauten Klang behalten, der ihm
Glanz und Blühen sichert in fernen Zeiten.
„Fünfhundert Jahr — ein hohes Wort", fünfhundert Jahre
deutschen Forscher- und Culturlebens erreichen durch die Semi-
millennarfeier in diesen Augusttagen ihren Abschluß. Keine zweite
deutsche Hochschule im Gebiete des jetziges Reiches sieht auf eine
solche Vergangenheit zurück. Wechselvoll, wie das Geschick des
deutschen Volkes, ist das lange Leben dieser umvorsitas littsrarum,
eit Ruprecht I. oder Senior, Kurfürst und Pfalzgraf, sie 1386
ns Dasein rief. Er war es auch, der den Grundstein legte zur
besitzern soll das Eigenthum einfach geraubt werden. Allein die
Landliga will damit namentlich das in Hypotheken investirte
Eigenthum werthlos machen; Herr Flürscheim nennt dieses mit einer
der Sache übel anstehendeü Geschmacklosigkeit „die goldene 110".
Jn diesem Punkte weicht er nämlich von der Lehre Henry
George's ab. Er sagt, daß nicht so sehr durch die Bodenrente
selbst (wie George will) der Arbeitsertrag der großen Mehrheit
der Menschheit zum Vortheil einer kleinen Zahl von Großgrund-
besitzern vcrmindert und die ganze Lebenslage der ersteren ver-
schlechtert werde, sondern dadurch, daß der Privatgrundbesitz
allein die Möglichkeit gewähre, die Ueberschüsse der Riesen-
vermögen, die ja von den Eigenthümern gar nicht verzehrt werden
könnten, immer wieder sicher und zugleich rententragend anzulegen.
Die drei Zweige der Familie Rothschild, so führt Flür-
scheim aus, werden jetzt auf 3—4 Milliarden Mark
Vermögen geschätzt, was einem Einkommen von 100
bis 150 Millionen entspricht. Die Herren verbrauchen
aber sicher keine 20 Millionen pro Jahr, und wenn sie
ihren Luxus noch so sehr ausdehnen, so können sie höchstens einige
Millionen mehr verbrauchen, aber keine 80—100 Millionen. Diese
können sie nicht auf industrielle Unternehmungen verwenden, denn
dann würden sie durch deren Vermehrung zum Vortheil der
Consumenten die Preise der Producte herabdrücken und sich selbst
um ihre Rente bringen. Sie müssen damit in den Grundbesitz,
entweder müssen sie selbst Eigenthümer werden oder aber sie
leihen cs auf Hypotheken oder an Staaten aus, was in dieser
Beziehung den Hypotheken analog sein soll. Ohne diese sichere
Belegung wäre die Bildung der rententragenden Riesenvermögen
nach Flürscheim nicht möglich. Wir möchten auf diese Ab
weichung sachlich nicht einmal ein großes Gewicht legen. Sie
kommt aber insofern in Betracht, als eben sie es der „Landliga"
gestattet, mit der Verstaatlichung des Grundbesitzes zugleich
wenigstens in einer Richtung eine capitalfeindliche Tendenz zu
entfalten und an die Noth, die angeblich den Grundbesitzern von
Seiten der Capitalisten bereitet wird, zu appelliren.
Ob darüber unsere Grundbesitzer mit der Verstaatlichung des
Grundbesitzes Frieden schließen? Wir glauben es nicht. Wir
lassen auch dahingestellt, ob eines Tages vielleicht die Apathie der
ländlichen Tagelöhnermassen in eine hitzige Betheiligung an dem
Rufe: „Her mit dem Lande, das wir im Schweiße unseres
Angesichts beackern" umschlagen könnte; die große Lebhaftigkeit
der socialdemokratischen Bewegung in den industriellen Arbeiter-
kreisen könnte immerhin eine solche Vermuthung nahe legcn.
Aber das Eine scheint uns durch den großen Erfolg der George-
schen Lehre in England und Amerika und nunmehr auch durch
die Landliga in Deutschland bewiesen zu werden: es ist ein
gefährliches Spiel, das die conservative Partei, die Großgrund-
besitzerpartei mit dem Socialismus treibt. Sie entfessetl die
socialistischen Leidenschaften, hinter denen doch die communistischen
stecken. Sie glaubt, das Einkommen des Tabackhändlers, des
Tabackfabrikanten, des Spirituosenhändlers und Wirthes dem
Staate als nehmenswerth denunciren zu dürfen und gleich-
zeitig hinsichtlich der Rente des Grundbesitzers und Spiritus-
fabrikanten nicht blos sicher sein, sondern eine beträcht-
liche Steigerung auf Kosten des gemeinen Mannes
beanspruchen zu können. Das ist ein doppeltes Spiel,
das sich eines Tages rächen muß. Allen diesen socialistischen
Hetzereien liegt die Begierde nach des Nächsten Eigenthum zu
Grunde. Hier begehrt der Socialdemokrat und der Großgrund-
besitzer das Geld des Bankiers und Hypothekengläubigers; daß sie
es aus verschiedenen Gründen und unter Anwendung eines ver-
schiedenen gesellschaftlichen Betragens thun, will dabei wenig be-
deuten. Dort gehört die Wegnahme des Grundbesitzcs schon zum
System der Socialdemokraten, und nun kommt von anderer Seite
die Lehre, daß man gar nicht einmal Socialdemokrat zu sein
brauche, um den Grundbesitz den jetzigen „widerrechtlichen" Eigen-
thümern zum Besten des Volkes wieder abzunehmen und sich
dadurch zum Mitschöpfer einer großen Wohlthat für die Mensch-
heit zu machen. Wo man die Heiligkeit gewisser Kategorien des
Heiligen Geistkirche, von deren Thürmen die Glocken die Jubel-
feier einläuten werden. Ein trefflicher Gedanke! die Haupt-
epochen dieser fünfhundertjährigen Geschichte wieder lebendig zu
machen und all die bunten Gestalten vergangener Tage in dem
prächtigen Zuge, der am 6. August durch Heidelbergs Straßen
sich bewegen wird, zu neuem, wenn auch kurzem Leben, wach-
zurufen. An diesem Tage wird Morgens 9 Uhr der historische
Festzug, der Glanz- und Mittelpunkt der ganzen Feier, sich in
Bewegung setzen. 900 Personen mit 300 Pferden und 14 Pracht-
wagen werden in 14 farbenprächtigen Gruppen die vergangenen
fünfhundert Jahre darstellen.
Den glänzenden, über 800 Meter langen Zug eröffnet nach
Gebühr Kurfürst Ruprccht, der in rauher Zeit em gar feiner
und kunstliebender Herr war; er erst schuf Heidelberg zur
ordentlichen Stadt und Residenz; ein doppelter Grund, ihn zn
ehren und zu feiern. Jhm folgt, umgeben von reisiger Schaar,
Friedrich der Siegrciche, wie er im Glanz der Waffen am
30. Juni 1462 triumphirend in Heidelberg einzieht, nachdem er
zwischen Schwetzingen und Seckenheim, da, wo jetzt zur Erinnerung
an die Schlacht das Dorf Friederichsfeld gebaut ist, — ein be-
kannter Knotenpunkt der Frankfurt-Heidelberg-Mannheimer Bahnen
— den Markgrafen Carl von Baden, den Bischof von Metz und
Grafen Ulrich von Württemberg besiegt und zu Gefangenen ge-
macht hatte. — Es folgt die Pflege der Kunst und Wissenschaft
durch Kurfürst Otto Heinrich (1556—1559). Er ist derselbe, von
dem Scheffel das feucht-fröhliche Lied sang, in dem der Enderle
von Ketsch eine so gespenstige Rolle spielt.
„Ott' Heinrich der Pfalzgraf bei Rheine,
Der sprach eines Tages: „Rem blemm",
Jch pfeif' auf die saueren Weine,
Jch geh' nach Jerusalem!"
Diese Reise nach dem Orient hat Otto Heinrich wirklich
unternommen, wenn auch nicht, weil, wie es weiter heißt, „viel
schöner und lielienweißer die Jungfrauen schauen dort drein".
Er sammelte mit großem Fleiß im gelobten Lande cine Menge
werthvoller arabischer und griechischer Schriften, die er der
Heidelberger Universität vermachte und damit hauptsächlich den
Grund zu der Bibliothek lcgte, die später im 30jährigen Kriege
geraubt und nach Rom gebracht wurde. Er errichtete auch den
Otto-Heinrichsbau, das Juwel der deutschen Schloßarchitektur,
deffen prachtvvlle übriggebliebene Faxade heute als die herrlichste
Zierde der Heidelberger Schloßruine bewundert wird.
Eine Scene, das Volksleben der fröhlichen Pfalz zu Ende
des 16. Jahrhunderts, der sich ein Winzerzug anschließt, in dem
hauptsächlich die Heidelberger Schönen Gelegenheit haben, zu
glänzen, vermittelt den Uebergang zu dem Einzugsbilde Kurfürst
Friedrichs V., wie er an der Seite seiner schönen, stolzen eng-
lischen Gemahlin in pomphaftem Zuge durch Heidelbergs Gassen
zum Schlosse reitet. Die Geschichte dieses unglücklichen Fürsten,
des nachherigen Böhmerkönigs, des Winterkönigs, wie ihn spottend
Eigenthums untergraben zu können meint, da wird der ganze
Eigenthumsbegriff geschädigt. Den deutschen Conservativen,
Staatssocialisten, Christlichsocialen u. s. w. wird es nicht gelingen,
das Grundeigenthum mit Gottesfrieden zu umgeben, wenn sie
das Capitaleigenthum als eine große Mißbildung unserer Cultur
behandeln. Aber auch die George'schen Bestrebungen, die Ver-
staatlichung auf die Bodenrente zu bcschränken, werden damit
nicht verbinden können, daß im Uebrigen alles Privateinkommen
aus Capital, geschäftlichen Unternehmungen und Arbeit bestehen
bleibt. Nach beiden Seiten kann man nur warnend sagen.
Entfesseln Sie die — bösen Leidenschaften nicht.
DenlscheS Neich.
ui. Bevlin, 18. Juli. An einen geheimen Erlaß der groß-
herzoglich hessischen Regierung, betreffend das Vorgehen gegen
die socialdemokratis che Agitation ist mehrfach die Ver-
muthung geknüpft worden, daß nun anch in Hessen schärfere
Maßregeln gegen die Socialdemokratie in Anwendnng gebracht
werden sollen. Die hessische Regierung, in deren Bezirk die
Socialdemokratie zahlreich vertreten ist und nicht unerheblichen
Einfluß gewonnen hat, ist bisher allerdings weniger energisch
vorgegangen, als es etwa in Preußen der Fall ist. Als unmittelbar
nach dem Attentat gegen dcn Polizeirath Rumpff im preußischen
Staatsministerium die Frage erwogen wurde, ob es angezeigt sei,
über Frankfurt am Main den kleinen Belagerungszustand zu
verhängen, scheiterte die Ausführung dieser Maßregel an dem
Widerstande der hessischen Regiernng, den kleinen Belagerungs-
zustand zugleich über die benachbarten hessischen Gebietstheile zu
verhängen. JN Folge dessen verzichtete die Preußische Regierung
auf ihre Absicht, von welcher sie sich ohne ein gleichzeitiges Vor-
geheu der hessischen Regierung keinen Erfolg zu versprechen ver-
mochte. Man nimmt an, daß der durch den „Socialdemokrat"
bekannt gewordene Erlaß der letzteren durch Vorstellungen des
preußischen Ministeriums des Jnnern veranlaßt worden ist. Ob
das strengere Vorgehen gegen die Socialdemokratie in Hessen von
besserem Erfolge begleitet sein wird, als in Berlin, bleibt abzuwarten,
zumal die socialdemokratische Organisation über ganz Deutschland
gleich gut geregelt ist. Wie sie sich in Berlin unter dem Aus-
nahmegesetz einzurichten verstand und befestigte, darüber hört
man täglich allerlei Jnteressantes, besonders auch über den Um-
fang, den die Arbeitervereinsbewegung angenommen hatte. Wcnn
es heute als cine günstige Wirkung der Suspendirung des Ver-
sammlungsrechts für Berlin und Umgegend bezeichnet wird, daß
nur sehr weuige Äersammlungen der polizeilichen Auflösung ver-
fallen, so ist das doch nicht ganz zutreffend. Die Lciter der Ver-
sammlnngen verfahren allerdings mit größerer Vorsicht, aber auch
mit großem Geschick, dem es a'uch zumeist zu verdanken ist, daß
die Versammlungen ruhiger verlaufen. Dafür suchen gewisse
Persönlichkeiten in der Socialdemokratie dem in ihnen lcbenden
Bcdürfniß nach Ruhestörungen dadurch gerecht zu werden, daß sie
das Gastrecht in den Versammlungen anöerer Parteien schnöde
i.i.ßbrauchen, uud es licgt gewiß Bercchnung darin, daß sie sich
zu diesem Behuse die Zusammenkünfte derjenigen Parteien aus-
suchen, die man unter dem Sammelnamen „Reichsfeinde" begreift.
So führte der bekannte Herr Görcki erst kürzlich wieder den vor-
zeitigen Schluß einer Sitzung des hiesigen „demokratischen Ver-
eins" herbei, in welcher über den kleinen BelagerungSzustand
discutirt wurde. Dcr ehemalige Maschinenschlosser und jetzige
Cigarrenkaufmann Görcki spielt eine merkwürdige Rolle in der
Berliner Bewegung. Es ist einer der unklarstcn Köpfe, die jemals
ihre Weisheit an den Markt gebracht haben; seine Stärke besteht
in einem sür 'die Hörer geradezu beängstigenden Redeschwall.
Wie dieser Mann es zu einer führenden Rolle in Berlin
hat bringen können, ist ein nicht zu lösendes Räthsel.
Dieselben Arbeiter, die gewöhnt waren, die von unerschütterlichem
Glanben an die Richtigkeit ihrer Theorieu erfüllten und sür diese
begeisterten Parteichefs Bebel und Liebknecht zu hören, klatschen
jetzt dem ödesten Phrasenschwall des Herrn Görcki Beifall. Jn
der Stadtverordnetenversammluug, der er auch angehört, bildet
er das komische Element: er sorgt für die Heiterkeit in der
ernsten Versammtung; denn er spricht ohne Kenntniß der Dinge,
die verhandelt werden und wiewohl diese eine agitatorische Be-
handlung nicht vertragen, sucht sie Herr Görcki agitatorisch aus-
zunutzen. Gäbe es keinen Belagerungszustand über Berlin und
kein Ausnahmegesetz, so gäbe es auch keinen Görcki! Denn er
genießt nicht das allgemeine Vertrauen seiner Parteigenossen; er
hat sich sogar schon Mißtrauensvoten in öffentlichen Versamm-
lungen geholt, in denen ihm mancherlei Sünden vorgehalten
seine Feinde nannten, weil nach einem kurzen Winter die Schlacht
am Weißen Berge der böhmischen Königsherrlichkeit ein so jähes
Ende bereitete, ist sattsam bekannt. Hier, wo es nur gilt, kurz
die Bedeutung der historischen Gruppen zu schildern, ohne deren
Kenntniß selbstverständlich kein rechtes Verständniß und keine
genußbringende Würdigung des Zuges möglich ist, bedarf auch
das sich weiter anschließende, Prächtig ausgestattete Bild, die
böhmische Gesandtschaft, > keiner Erklärung. Die jetzt folgende
Gruppe führt uns zurück in die Zeit des 30jährigen Krieges und
des Orleans'schen Erbfolgekrieges (1688—1697). Es sind die
traurigsten Zeiten, die je über Heidelberg und seine Universität
kameni Jm 30jährigen Kriege mehrmals geplündert und aus-
geraubt, vollendete sich sein Geschick durch die Mordbanden
Ludwig XIV., des allerchristlichsten Königs. Pfalzgräffn Elisabeth
Charlotte war an den Äruder des Königs, den Herzog von
Orleans, vermählt, einc verhängnißvolle Verbindung für Heidel-
berg und die ganze Pfalz. Denn Erbansprüche, die dieserhalb
der König von Frankreich machen zu können glaubte, boten den
Anlaß zu der Zerstörung des Schlosses, der Berbrennnng und
Verwüstung der ganzen Stadt. „Sollte man mir au'ch das
Leben nehmen", schreibt die unglückliche Fürstin in einem
von Ranke publicirten Briefe, „so kann ich doch nicht
lassen, zu bedauern und zu beweinen, daß ich sozusagen
die Ursache von meines Vaterlandes Untergang bin. Alle Nacht,
sobald ich ein wenig eingeschlafen, deucht mir, ich sei zu Heidel-
delberg oder Mannheim und sehe all' die Verwüstungen ....
und uoch dazu nimbts man ühel, daß ich betrübt darüber bin,
aber ich kann's wahrlich nicht lassen."
Auch die folgende Grnppe: Kurfürst Carl Ludwig, aehört
noch in den Rahmen dieser traurigen Zeit. Der Fürst zieht am
7. October 1649 wieder in die alte, verödete Residenz seiner
Väter ein, ein ernstes, stimmungsvolles Bild. Ein fröhlicher
Jagdzug aus der Zeit Carl Philipps (1716—1742) bendet diesen
Cyklus und leitet über in die neueste, bessere Zeit, die Wieder-
herstellung der Universität durch Karl Friedrich von Baden, die
letzte Gruppe, welche der Geschichte angehört; denn gleich daran
schließt sich in buntem, malerischen Zug die Studentenschaft des
19. Jahrhunderts, die Burschenschaften, die Corps und das
Ganze krönend: das neuc deutsche Reich.
Als Karl Friedrich von Äaden im Luneviller Frieden 1802
den größten Theil der rechtsrheinischen Pfalz, und damit Heidel-
berg erhielt, stand es schlimm um die Rupertina, diesen hoch-
berühmten Sitz deutscher Wissenschaft. Die Jahre des Krieges
hatten drückend auf der Stadt gelastet und die Universität, die
erste und blühendste in Deutschland, hatte in ihnen beinahe alles
verloren. Reiche Besitzthümer, die ihr früher durch die Muni-
ficenz der Fürsten zu Theil geworden, waren ihr aus dem linken
Rheinufer durch die französische Occupation entrissen, und was
übrig blieb, reichte kaum hin, die während der Kriege gemachten
Schulden zu decken. Jedes innere, wissenschaftliche Leben war in
wurden. Für den Politischen Charakter des Mannes ist es be-
zeichnend, daß er bei den letzten Reichstagswahlen sein Möglichstes
that, um seine Freunde zur Unterstütz'ung der Wahl Stöcker's
gegen Virchow im 2. Berliner Wahlkreise zu gewinnen. Es ist
nicht unmöglich, daß dieser dem Hofprediger unterlegen wäre,
wenn nicht die parlamentarischen Führer der Socialdemokratie
mit einer Erklärung zu seinen Gunsten eingetreten wären. Wenn
man nun sieht, daß Herr Görki nach der Ausweisung Singer's
an die Spitze dcr Berliner Bewegung tritt, so erscheint die Aus-
weisung Singer's in ganz besonderer Beleuchtung.
* Berlin, 17. Juli. Wir erhalten folgcnde Zuschrift:
Sehr geehrte Äedaction! Jn No. 14 213 der „Weser-Zeitung"
bringen Sie eine Correspondenz aus Berlin, in welcher die Ver-
muthung ausgesprochen wird, bei der zwischen Mr. Mackinnon
und Mr. Stanley einerseits, Commerzienrath Gebhard und mir
andererseits, zu Bonn stattgehabten Zusammenkunft sei „der Ver-
such gemacht, englischeCapitalisten für Unternehmungen
auf dem Gebiete der Deutsch-Ostafrikanischen Ge-
sellschaft zu interessiren." Da diese Vermuthung, welche
auch in andern Blättern ausgesprochen worden ist, auf den
Charakter der betreffenden Zusammenkunft ein unrichtiges Licht
wirft, so gestatten Sie mir, dieselbe für unrichtig zu erklären.
Genehmigen Sie u. s. w. Carl Peters.
(-) Chemnitz, 17. Juli. Außerordentlich interessant ist de
heute erschienene Bericht der hiesigen Handels- und
Gewerbekammer für das Jahr 1886. Neber die allgemeine
Lage des Handels und der Jndustrie spricht derselbe sich sehr
trübe aus und in der That hatten ja auch namentlich die hiesigen
Jndustriellen Veranlassung, vielfach Klage über einen schweren
Rückgang des Geschäfts zu führen, der zum großen Theil den
durch die deutschen Schutzzölle hervorgerufenen Repressivmaßregeln
des Auslandes und der vielfachen Beunruhigung der Jndustrie
durch die auswärtige Politik — Carolinenfrage — zur Last fällt.
Die Kammer spricht sich dahin aus, daß die gewerblichen Zustände
in Deutschland gegenwärtig in ein Stadium getreten seien, das
nahezu an Ueberproduction grenze. Die lange erhoffte Besserung
der geschäftlichen Verhältnisse sei nicht eingetreten, vielmehr habe
sich mit wenig Ausnahmen der allgemeine Geschäftsgang noch
drückender, nöch langsamer und lähmender als im vergangenen
Jahre gestaltet. Das ist eine Kennzeichnung des vielberühmten
„Segens", den angeblich die Schutzzölle der deutschen Jndustrie
gebracht haben, wie man sie kaum treffendcr wünschcn kann.
Scharf wendet sich die Handelskammer aegen die Bestrebungen
der Agrarier nnd sie betont, daß es im Allgemeinen geboten er-
scheine, in der Zollgesetzgebung möge gegenübersolchen Bestrebungsn
cndlich ein Ruhepunkt e'intreten. Gegen dcn Wollzoll hat sich die
Kammer aus dem Grunde ausgesprochen, weil dieser cine
Schädigung und schwere Benachtheiligung unserer Textilindustrie
im Gefolge haben und somit einen lähmenden Druck auf unsere
wirthschaftliche Thätigkeit ausüben würde, welcher mit einem
totalen Rückzuge derselben enden müffe. Dann aber werde
der Zoll auch zu einer starken Belastung unserer inländischen
Consumtion führen, indem eine Erhöhung der Preisc für Woll-
waaren die nothwendige Folge sein müsse. Dieser Punkt ver-
diene — ncben andcren — die größte Beachtung, da Wollwaarcn
keineswegs ein Luxus-, sondern ein nothwendiger Verbrauchs-
artikel seien. Die großen Nachtheile deS Wollzolls Würdsn dnrch
die Vortheile, welche man von ihm für die Landwirthschaft er-
warte, bei weitem nicht ausgewogcn. — Sich gegen die von
zünftlerischer Seite gewünschte Einschränkung des Hausirhandels
wendend, führt der Handelskammerber cht aus, es liege in diesen
Anträgen ein Angriff auf die Gewerbefreiheit verborgen, welche,
abgesehen von kleincren Punkten und minder wesentlichen Bestand-
theilen, durchaus nicht wieder rückgängig gemacht werden könne,
denn das jetzt bestehende wirthschaftliche, politische und sociale
Leben der Cülturnationen sei nach derselben eingerichtet und
gründe sich auf dieselbe. Die alten Zustände seicn unwieder-
bringlich verloren. Jm Allgemeinen wcist der Bericht darauf
hin, daß der Hausirhandcl keineswegs eine so sehr schädigende
Wirkung ausübe, als man vielfach annehme; auch möge man in
dieser Beziehung mehr dem Selbstschutz vertrauen und nicht immer
gleich die Gesetzgebung zu Hülfe rufen. Wie schon aus diesem
knappen Auszuge hervorgeht, enthält der Chemnitzer Handels-
kammerbericht, trotzdem er dic Colonialpolitik der Regierung an-
erkennt, eine vernichtende Kritik unseres gegenwärtigen Äirthschafts-
systems und der agrarischen und zünftlerischen Bestrebungen.
* Augsburg, 18. Juli. Der Kaiser ist heute Abend halb
9 Uhr hier eingetroffen und auf festlich geschmücktem Bahnhofe
von dem Vertreter des Regierungsprüsidenten, dem Divisions-
general, dem Bürgermeister, den Vertretern der Stadt und zahl
reichen Mitgliedern der staatlichen und kirchlichen Behörden
feierlich empfangen worden, auch der preußische Gesandte aus
München mit den Mitgliedern der Gesandtschaft war zum Em-
den Kriegswirren erstickt. Aeußerlich entblättert, innerlich ent-
kräftet stand die altehrwürdige Stätte der Musen, als das neue
Jahrhundert über ihr aufging, und es schien, als ob das im
Jahre 1786 so glanzvoll gefeierte vierhundertjährige Jubiläum
der Schwauengesang für diesen hochberühmten Sitz deutscher
Wissenschaft werden sollte.
Dvch Gott und Karl Friedrich hatten es anders beschossen,
und noch manches unvergängliche Rnhmesblatt hat das fünfte
Säculum der Rupertina, jetzt zu Ehren ihres zweiten Stifters
Ruperto-Carola genannt, eingebracht. Glänzender, als die Fest-
tage im November 1786 werden die heurigen Augusttage gefeiert
werden. Soweit das Gaudeamus klingt, sindet das Fest Wider-
hall in deutschen Herzen. Mögen sie kommen die Freunde Alt-
heidelbergs und seines Jubelkindes. Sie finden ein fröhliches
Willkomiiien, sie finden noch die alte Sitte, das alte, flotte,
schneidige Studententhum. Perkeo's Geist, der feucht-fröhliche
Genius loci Heidelbergs, dem alles „Wurst ist und egal, was sie
drauß hantiren", geht noch immer um in der ewig heiteren
Musenstadt am Neckar. Noch einmal wird dem kleinen Knirps
und großen Zecher das Faß, das große, das längst hohl klang
und leer, gefüllt, noch einmal wird er, wenn Faß und Fest zur
Neige geht, anstimmen die alte Klage:
„Nmi singt e-n Deprofmidis, daß daS Gewölb erdröhnt,
Das Faß steht auf der Neige, ich falle sieggekrönt."
Doch dieses Mal kein Solo, 's wird fröhliche Cumpanei da
droben im Keller geben, und feine Bürgertöchter helscn dem
alten Schenken des Amtes warten. Ein guter Jahrgang wird
da droben im Schloßkeller verschenkt werden, und mancher Gast
wird weinselig den Blick vom Schloßaltane abwärts senden auf
die herrliche gesegnete Pfalz, über Stadt und Fluß, bis hin nach
Speiers vielthürmigem Dom, wo die blauen Höhen dcr Haardt
und die Ausläufer der Vogesen die weite Rheinebene begrenzen.
Wer einmal da oben gestanden, der vergißt das glänzende Bild
nie mehr, das immer und immer wicder auftaucht in den stillen
Stunden der Erinnerung, und das mit Macht jetzt so manchen
alten Studio, dem Haar und Bart längst eraraute, seit er zuletzt
hier stand, wieder zurückzieht zur Neckarstadt. Manch ernster
Mann wird ein anderer hier sein, ein anderer von hier zurück-
kehren, als man zu Haus in der Würde des Amtes und unter
den täglichen Sorgen des Lebens ihn kennt. Cerevis und
Burschenband, die so langc Jahre in irgend einem Gefach des
Arbeitstisches verstaubt und unbeachtet rnhten, sie kommen noch
einmal zu Ehren, und der Abend des 6. August wird zum all-
gemeinen Festcommers in der riesigen Halle am Neckarufer eine
Corona zusammen sehen, zahlreich, würdig und stolz, wie sie je
nur eine Tafelrunde schmückte.