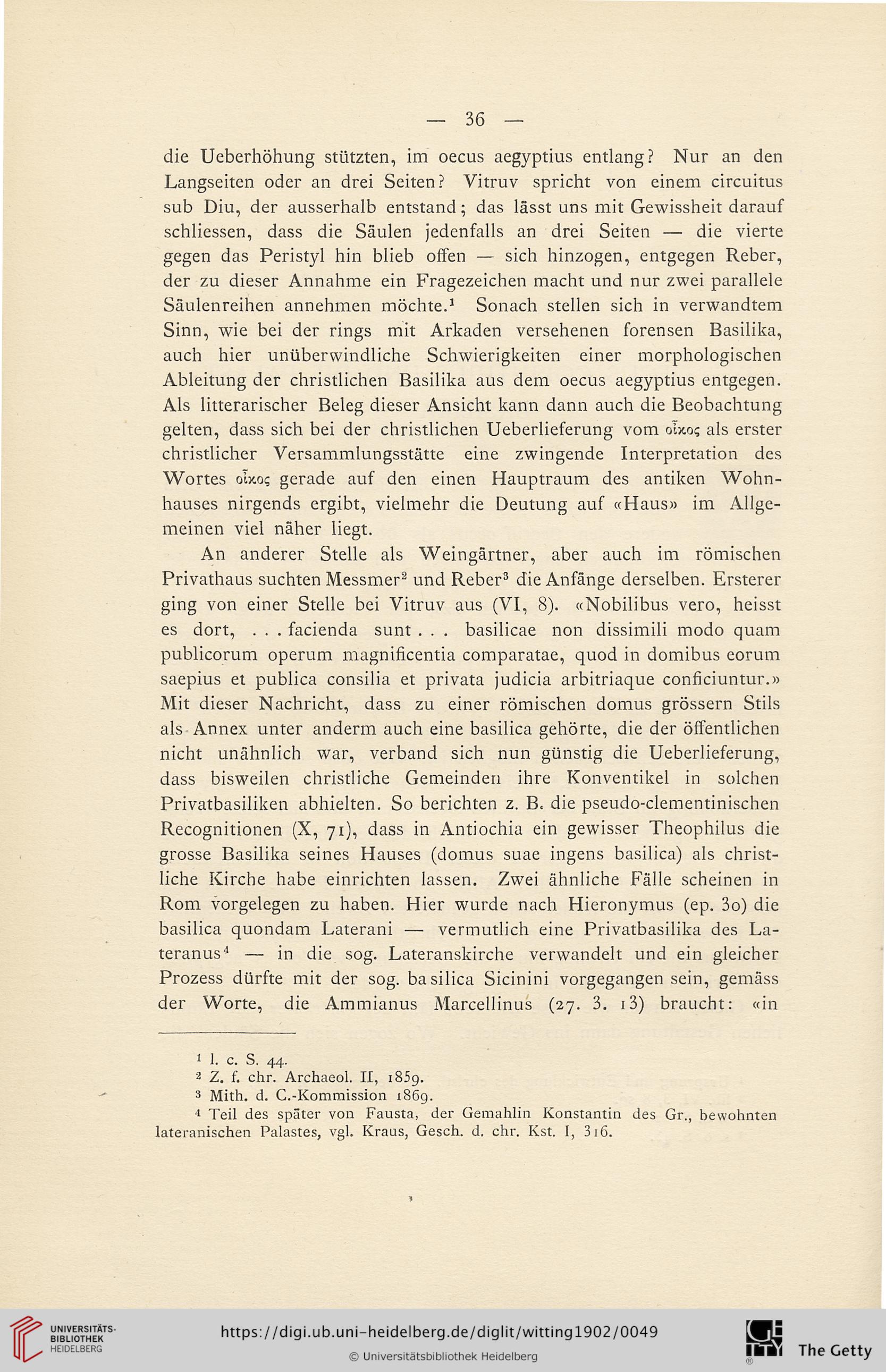36
die Ueberhöhung stützten, im oecus aegyptius entlang? Nur an den
Langseiten oder an drei Seiten? Vitruv spricht von einem circuitus
sub Diu, der ausserhalb entstand; das lässt uns mit Gewissheit darauf
schliessen, dass die Säulen jedenfalls an drei Seiten — die vierte
gegen das Peristyl hin blieb offen — sich hinzogen, entgegen Reber,
der zu dieser Annahme ein Fragezeichen macht und nur zwei parallele
Säulenreihen annehmen möchte.1 Sonach stellen sich in verwandtem
Sinn, wie bei der rings mit Arkaden versehenen forensen Basilika,
auch hier unüberwindliche Schwierigkeiten einer morphologischen
Ableitung der christlichen Basilika aus dem oecus aegyptius entgegen.
Als litterarischer Beleg dieser Ansicht kann dann auch die Beobachtung
gelten, dass sich bei der christlichen Ueberlieferung vom οίκος als erster
christlicher Versammlungsstätte eine zwingende Interpretation des
Wortes οίκος gerade auf den einen Hauptraum des antiken Wohn-
hauses nirgends ergibt, vielmehr die Deutung auf «Haus» im Allge-
meinen viel näher liegt.
An anderer Stelle als Weingärtner, aber auch im römischen
Privathaus suchten Messmer2 und Reber3 4 die Anfänge derselben. Ersterer
ging von einer Stelle bei Vitruv aus (VI, 8). «Nobilibus vero, heisst
es dort, . . . facienda sunt . . . basilicae non dissimili modo quam
publicorum operum magnificentia comparatae, quod in domibus eorum
saepius et publica consilia et privata judicia arbitriaque conficiuntur.»
Mit dieser Nachricht, dass zu einer römischen domus grössere Stils
als Annex unter anderm auch eine basilica gehörte, die der öffentlichen
nicht unähnlich war, verband sich nun günstig die Ueberlieferung,
dass bisweilen christliche Gemeinden ihre Konventikel in solchen
Privatbasiliken abhielten. So berichten z. B. die pseudo-clementinischen
Recognitionen (X, 71), dass in Antiochia ein gewisser Theophilus die
grosse Basilika seines Hauses (domus suae ingens basilica) als christ-
liche Kirche habe einrichten lassen. Zwei ähnliche Fälle scheinen in
Rom vorgelegen zu haben. Hier wurde nach Hieronymus (ep. 3o) die
basilica quondam Laterani — vermutlich eine Privatbasilika des La-
teranus1 — in die sog. Lateranskirche verwandelt und ein gleicher
Prozess dürfte mit der sog. basilica Sicinini vorgegangen sein, gemäss
der Worte, die Ammianus Marcellinus (27. 3. i3) braucht: «in
1 1. c. S. 44.
2 Z. f. ehr. Archaeol. II, 1859.
3 Mith. d. C.-Kommission 1869.
4 Teil des später von Fausta, der Gemahlin Konstantin des Gr., bewohnten
lateranischen Palastes, vgl. Kraus, Gesch. d. ehr. Kst, 1, 316.
die Ueberhöhung stützten, im oecus aegyptius entlang? Nur an den
Langseiten oder an drei Seiten? Vitruv spricht von einem circuitus
sub Diu, der ausserhalb entstand; das lässt uns mit Gewissheit darauf
schliessen, dass die Säulen jedenfalls an drei Seiten — die vierte
gegen das Peristyl hin blieb offen — sich hinzogen, entgegen Reber,
der zu dieser Annahme ein Fragezeichen macht und nur zwei parallele
Säulenreihen annehmen möchte.1 Sonach stellen sich in verwandtem
Sinn, wie bei der rings mit Arkaden versehenen forensen Basilika,
auch hier unüberwindliche Schwierigkeiten einer morphologischen
Ableitung der christlichen Basilika aus dem oecus aegyptius entgegen.
Als litterarischer Beleg dieser Ansicht kann dann auch die Beobachtung
gelten, dass sich bei der christlichen Ueberlieferung vom οίκος als erster
christlicher Versammlungsstätte eine zwingende Interpretation des
Wortes οίκος gerade auf den einen Hauptraum des antiken Wohn-
hauses nirgends ergibt, vielmehr die Deutung auf «Haus» im Allge-
meinen viel näher liegt.
An anderer Stelle als Weingärtner, aber auch im römischen
Privathaus suchten Messmer2 und Reber3 4 die Anfänge derselben. Ersterer
ging von einer Stelle bei Vitruv aus (VI, 8). «Nobilibus vero, heisst
es dort, . . . facienda sunt . . . basilicae non dissimili modo quam
publicorum operum magnificentia comparatae, quod in domibus eorum
saepius et publica consilia et privata judicia arbitriaque conficiuntur.»
Mit dieser Nachricht, dass zu einer römischen domus grössere Stils
als Annex unter anderm auch eine basilica gehörte, die der öffentlichen
nicht unähnlich war, verband sich nun günstig die Ueberlieferung,
dass bisweilen christliche Gemeinden ihre Konventikel in solchen
Privatbasiliken abhielten. So berichten z. B. die pseudo-clementinischen
Recognitionen (X, 71), dass in Antiochia ein gewisser Theophilus die
grosse Basilika seines Hauses (domus suae ingens basilica) als christ-
liche Kirche habe einrichten lassen. Zwei ähnliche Fälle scheinen in
Rom vorgelegen zu haben. Hier wurde nach Hieronymus (ep. 3o) die
basilica quondam Laterani — vermutlich eine Privatbasilika des La-
teranus1 — in die sog. Lateranskirche verwandelt und ein gleicher
Prozess dürfte mit der sog. basilica Sicinini vorgegangen sein, gemäss
der Worte, die Ammianus Marcellinus (27. 3. i3) braucht: «in
1 1. c. S. 44.
2 Z. f. ehr. Archaeol. II, 1859.
3 Mith. d. C.-Kommission 1869.
4 Teil des später von Fausta, der Gemahlin Konstantin des Gr., bewohnten
lateranischen Palastes, vgl. Kraus, Gesch. d. ehr. Kst, 1, 316.