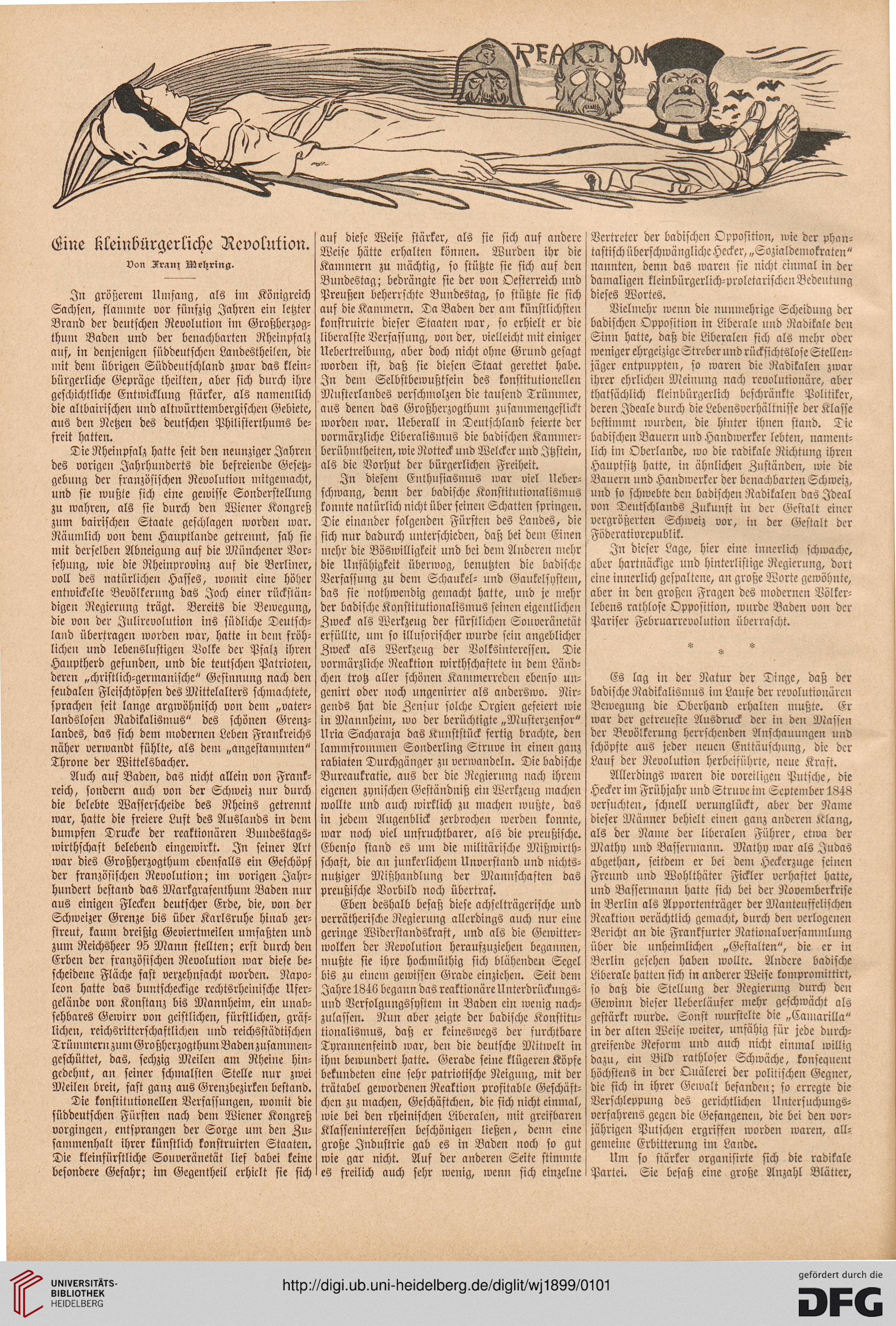(Line kleinbürgerliche Revolution.
von Franz Mehring.
In größerem Umfang, als im Königreich
Sachsen, flamnite vor fünfzig Jahren ein letzter
Brand der deutschen Revolution im Großherzog-
thuin Baden und der benachbarten Rheinpfalz
auf, in denjenigen süddeutschen Landestheilen, die
mit dem übrigen Süddeutschland zwar das klein-
bürgerliche Gepräge theilten, aber sich durch ihre
geschichtliche Entwicklung stärker, als namentlich
die altbairischen und altwürtteinbergischen Gebiete,
aus den Netzen des deutschen Philisterthums be-
freit hatten.
Die Rheiupfalz hatte seit den neunziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts die befreiende Gesetz-
gebung der französischen Revolution mitgemacht,
und sie wußte sich eine gewisse Sonderstellung
zu wahren, als sie durch den Wiener Kongreß
zum bairischen Staate geschlagen worden war.
Räumlich von dem Hauptlande getrennt, sah sie
mit derselben Abneigung auf die Münchener Vor-
sehung, wie die Rheinprovinz auf die Berliner,
voll des natürlichen Hasses, womit eine höher
entwickelte Bevölkerung das Joch einer rückstän-
digen Regierung trägt. Bereits die Bewegung,
die von der Julirevolution ins südliche Deutsch-
land übertragen worden war, hatte in dem fröh-
lichen und lebenslustigen Volke der Pfalz ihren
Hauptherd gefunden, und die teutschen Patrioten,
deren „christlich-germanische" Gesinnung nach den
feudalen Fleischtöpfen des Mittelalters schmachtete,
sprachen seit lange argwöhnisch von dem „vater-
landslosen Radikalisnms" des schönen Grenz-
landes, das sich dem modernen Leben Frankreichs
näher verwandt fühlte, als bem „angestammten"
Throne der Wittelsbacher.
Auch auf Baden, das nicht allein von Frank-
reich, sondern auch von der Schweiz nur durch
die belebte Wasserscheide des Rheins getrennt
war, hatte die freiere Luft des Auslands in dem
dumpfen Drucke der reaktionären Buudestags-
wirthschaft belebend eingewirkt. In seiner Art
war dies Großherzogthum ebenfalls ein Geschöpf
der französischen Revolution; im vorigen Jahr-
hundert bestand das Markgrafenthum Baden nur
aus einigen Flecken deutscher Erde, die, von der
Schweizer Grenze bis über Karlsruhe hinab zer-
streut, kaum dreißig Geviertmeilen umfaßten und
zmu Reichsheer 95 Mann stellten; erst durch den
Erben der französischen Revolution war diese be-
scheidene Fläche fast verzehnfacht worden. Napo-
leon hatte das buntscheckige rechtsrheinische Ufer-
gelände von Konstanz bis Mannheim, ein unab-
sehbares Gewirr von geistlichen, fürstlichen, gräf-
lichen, reichsritterschaftlichen und reichsstüdtischen
Trümmern zum Großhcrzogthum Baden zusammen-
geschüttet, das, sechzig Meilen am Rheine hin-
gedehnt, an seiner schmälsten Stelle nur zwei
Meilen breit, fast ganz aus Grenzbezirken bestand.
Die konstitutionellen Verfassungen, womit die
süddeutschen Fürsten nach dem Wiener Kongreß
vorgingcn, entsprangen der Sorge um den Zu-
sammenhalt ihrer künstlich konstruirten Staaten.
Die kleinfürstliche Souveränetät lief dabei keine
besondere Gefahr; im Gegentheil erhielt sie sich
auf diese Weise stärker, als sie sich auf andere
Weise hätte erhalten können. Wurden ihr die
Kammern zu mächtig, so stützte sie sich auf den
Bundestag; bedrängte sie der von Oesterreich und
Preußen beherrschte Bundestag, so stützte sie sich
auf die Kammern. Da Badeu der ain künstlichsten
konstruirte dieser Staaten war, so erhielt er die
liberalste Verfassung, von der, vielleicht mit einiger
Uebertreibung, aber doch nicht ohne Grund gesagt
worden ist, daß sie diesen Staat gerettet habe.
In dem Selbstbewußtsein des konstitutionellen
Musterlandes verschmolzen die tausend Trümmer,
aus denen das Großherzogthum zusauimengeflickt
worden war. Ueberall in Deutschland feierte der
vormärzliche Liberalismus die badischen Kammer-
berühmtheiten, wie Rotteck und Welckcr und Jtzstein,
als die Vorhut der bürgerlichen Freiheit.
In diesem Enthusiasmus war viel Ueber-
schwaug, denn der badische Konstitutionalismus
konnte natürlich nicht über seinen Schatten springen.
Die einander folgenden Fürsten des Landes, die
sich nur dadurch unterschieden, daß bei dem Einen
mehr die Böswilligkeit und bei dem Anderen mehr
die Unfähigkeit überwog, benutzten die badische
Verfassung zu dem Schaukel- und Gaukelsystem,
das sie nothwendig gemacht hatte, und je mehr
der badische Konstitutionalismus seinen eigentlichen
Zweck als Werkzeug der fürstlichen Souveränetät
erfüllte, um so illusorischer wurde sein angeblicher
Zweck als Werkzeug der Volksinteressen. Die
vormärzliche Reaktion wirthschaftete in dem Läud-
chen trotz aller schönen Kammerreden ebenso un-
gcnirt oder noch ungenirter als anderswo. Nir-
gends hat die Zensur solche Orgien gefeiert wie
in Mannheim, wo der berüchtigte „Musterzensor"
Uria Sacharaja das Kunststück fertig brachte, den
lammfrommen Sonderling Struve in einen ganz
rabiaten Durchgänger zu verwandeln. Die badische
Bureaukratie, aus der die Regierung nach ihrem
eigenen zynischen Geständniß ein Werkzeug machen
wollte und auch wirklich zu machen wußte, das
in jedem Augenblick zerbrochen werden konnte,
lvar noch viel unfruchtbarer, als die preußische.
Ebenso stand es um die militärische Mißwirth-
schaft, die an junkerlichem Unverstand und nichts-
nutziger Mißhandlung der Mannschaften das
preußische Vorbild noch übertraf.
Eben deshalb besaß diese achselträgerische und
verrätherische Regierung allerdings auch nur eine
geringe Widerstandskraft, und als die Gewitter-
wolken der Revolution heraufzuziehen begannen,
mußte sie ihre hochmiithig sich blähenden Segel
bis zu einem gewissen Grade einziehen. Seit dem
Jahre 1846 begann das reaktionäre Unterdrückungs-
und Verfolgungssystem in Baden ein wenig nach-
zulassen. Nun aber zeigte der badische Konstitu-
tionalismus, daß er keineswegs der furchtbare
Tyrannenfeind war, den die deutsche Mitwelt in
ihm bewundert hatte. Gerade seine klügeren Köpfe
bekundeten eine sehr patriotische Neigung, mit der
trätabel gewordenen Reaktion profitable Geschäft-
chen zu machen, Geschäftchen, die sich nicht einmal,
wie bei den rheinischen Liberalen, mit greifbaren
Klasseninteressen beschönigen ließen, denn eine
große Industrie gab es in Baden noch so gut
wie gar nicht. Auf der anderen Seite stimmte
es freilich auch sehr wenig, wenn sich einzelne
Vertreter der badischen Opposition, ivie der phan-
tastisch überschwängliche Hecker, „Sozialdemokraten"
nannten, denn das waren sie nicht einmal in der
damaligen kleinbürgerlich-proletarischen Bedeutung
dieses Wortes.
Vielmehr wenn die nunmehrige Scheidung der
badischen Opposition in Liberale und Radikale den
Sinn hatte, daß die Liberalen sich als mehr oder
weniger ehrgeizige Streber und rücksichtslose Stellen-
jäger entpuppten, so waren die Radikalen zwar
ihrer ehrlichen Meinung nach revolutionäre, aber
thatsächlich kleinbürgerlich beschränkte Politiker,
deren Ideale durch die Lebensverhältnisse der Klasse
bestinimt wurden, die hinter ihnen stand. Tic
badischen Bauern und Handwerker lebten, nament-
lich im Oberlande, wo die radikale Richtung ihren
Hauptsitz hatte, in ähnlichen Zuständen, wie die
Bauern und Handwerker der benachbarten Schweiz,
und so schwebte den badischen Radikalen das Ideal
von Deutschlands Zukunft in der Gestalt einer
vergrößerten «Schweiz vor, in der Gestalt der
Föderativrepublik.
In dieser Lage, hier eine innerlich schwache,
aber hartnäckige und hinterlistige Regierung, dort
eine innerlich gespaltene, an große Worte gewöhnte,
aber in den großen Fragen des modernen Völker-
lebens rathlose Opposition, wurde Baden von der
Pariser Februarrevolution überrascht.
Es lag in der Natur der Dinge, daß der
badische Radikalismus im Laufe der revolutionären
Bewegung die Oberhand erhalten mußte. Er
war der getreueste Ausdruck der in den Massen
der Bevölkerung herrschenden Anschauungen und
schöpfte aus jeder neuen Enttäuschung, die der
Lauf der Revolution herbeiführte, neue Kraft.
Allerdings waren die voreiligen Putsche, die
Hecker im Frühjahr und Struve im September 1848
versuchten, schnell verunglückt, aber der Name
dieser Männer behielt einen ganz anderen Klang,
als der Name der liberalen Führer, etwa der
Mathy und Bassermann. Mathy war als Judas
abgethan, seitdem er bei dem Heckerzuge seinen
Freund und Wohlthäter Fickler verhaftet hatte,
und Bassermann hatte sich bei der Novemberkrise
in Berlin als Apportenträger der Manteuffelischen
Reaktion verächtlich gemacht, durch den verlogenen
Bericht an die Frankfurter Nationalversammlung
über die unheimlichen „Gestalten", die er in
Berlin gesehen haben wollte. Andere badische
Liberale hatten sich in anderer Weise kompromittirt,
so daß die Stellung der Negierung durch den
Gewinn dieser Ueberläufer mehr geschwächt als
gestärkt wurde. Sonst wurstelte die „Caniarilla"
in der alten Weise weiter, unfähig für jede durch-
greifende Reform und auch nicht einmal willig
dazu, ein Bild rathloser Schwäche, konsequent
höchstens in der Quälerei der politischen Gegner,
die sich in ihrer Geivalt befanden; so erregte die
Verschleppung des gerichtlichen Untersuchungs-
verfahrens gegen die Gefangenen, die bei den vor-
jährigen Putschen ergriffen worden waren, all-
gemeine Erbitterung im Lande.
Um so stärker organisirte sich die radikale
Partei. Sie besaß eine große Anzahl Blätter,
von Franz Mehring.
In größerem Umfang, als im Königreich
Sachsen, flamnite vor fünfzig Jahren ein letzter
Brand der deutschen Revolution im Großherzog-
thuin Baden und der benachbarten Rheinpfalz
auf, in denjenigen süddeutschen Landestheilen, die
mit dem übrigen Süddeutschland zwar das klein-
bürgerliche Gepräge theilten, aber sich durch ihre
geschichtliche Entwicklung stärker, als namentlich
die altbairischen und altwürtteinbergischen Gebiete,
aus den Netzen des deutschen Philisterthums be-
freit hatten.
Die Rheiupfalz hatte seit den neunziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts die befreiende Gesetz-
gebung der französischen Revolution mitgemacht,
und sie wußte sich eine gewisse Sonderstellung
zu wahren, als sie durch den Wiener Kongreß
zum bairischen Staate geschlagen worden war.
Räumlich von dem Hauptlande getrennt, sah sie
mit derselben Abneigung auf die Münchener Vor-
sehung, wie die Rheinprovinz auf die Berliner,
voll des natürlichen Hasses, womit eine höher
entwickelte Bevölkerung das Joch einer rückstän-
digen Regierung trägt. Bereits die Bewegung,
die von der Julirevolution ins südliche Deutsch-
land übertragen worden war, hatte in dem fröh-
lichen und lebenslustigen Volke der Pfalz ihren
Hauptherd gefunden, und die teutschen Patrioten,
deren „christlich-germanische" Gesinnung nach den
feudalen Fleischtöpfen des Mittelalters schmachtete,
sprachen seit lange argwöhnisch von dem „vater-
landslosen Radikalisnms" des schönen Grenz-
landes, das sich dem modernen Leben Frankreichs
näher verwandt fühlte, als bem „angestammten"
Throne der Wittelsbacher.
Auch auf Baden, das nicht allein von Frank-
reich, sondern auch von der Schweiz nur durch
die belebte Wasserscheide des Rheins getrennt
war, hatte die freiere Luft des Auslands in dem
dumpfen Drucke der reaktionären Buudestags-
wirthschaft belebend eingewirkt. In seiner Art
war dies Großherzogthum ebenfalls ein Geschöpf
der französischen Revolution; im vorigen Jahr-
hundert bestand das Markgrafenthum Baden nur
aus einigen Flecken deutscher Erde, die, von der
Schweizer Grenze bis über Karlsruhe hinab zer-
streut, kaum dreißig Geviertmeilen umfaßten und
zmu Reichsheer 95 Mann stellten; erst durch den
Erben der französischen Revolution war diese be-
scheidene Fläche fast verzehnfacht worden. Napo-
leon hatte das buntscheckige rechtsrheinische Ufer-
gelände von Konstanz bis Mannheim, ein unab-
sehbares Gewirr von geistlichen, fürstlichen, gräf-
lichen, reichsritterschaftlichen und reichsstüdtischen
Trümmern zum Großhcrzogthum Baden zusammen-
geschüttet, das, sechzig Meilen am Rheine hin-
gedehnt, an seiner schmälsten Stelle nur zwei
Meilen breit, fast ganz aus Grenzbezirken bestand.
Die konstitutionellen Verfassungen, womit die
süddeutschen Fürsten nach dem Wiener Kongreß
vorgingcn, entsprangen der Sorge um den Zu-
sammenhalt ihrer künstlich konstruirten Staaten.
Die kleinfürstliche Souveränetät lief dabei keine
besondere Gefahr; im Gegentheil erhielt sie sich
auf diese Weise stärker, als sie sich auf andere
Weise hätte erhalten können. Wurden ihr die
Kammern zu mächtig, so stützte sie sich auf den
Bundestag; bedrängte sie der von Oesterreich und
Preußen beherrschte Bundestag, so stützte sie sich
auf die Kammern. Da Badeu der ain künstlichsten
konstruirte dieser Staaten war, so erhielt er die
liberalste Verfassung, von der, vielleicht mit einiger
Uebertreibung, aber doch nicht ohne Grund gesagt
worden ist, daß sie diesen Staat gerettet habe.
In dem Selbstbewußtsein des konstitutionellen
Musterlandes verschmolzen die tausend Trümmer,
aus denen das Großherzogthum zusauimengeflickt
worden war. Ueberall in Deutschland feierte der
vormärzliche Liberalismus die badischen Kammer-
berühmtheiten, wie Rotteck und Welckcr und Jtzstein,
als die Vorhut der bürgerlichen Freiheit.
In diesem Enthusiasmus war viel Ueber-
schwaug, denn der badische Konstitutionalismus
konnte natürlich nicht über seinen Schatten springen.
Die einander folgenden Fürsten des Landes, die
sich nur dadurch unterschieden, daß bei dem Einen
mehr die Böswilligkeit und bei dem Anderen mehr
die Unfähigkeit überwog, benutzten die badische
Verfassung zu dem Schaukel- und Gaukelsystem,
das sie nothwendig gemacht hatte, und je mehr
der badische Konstitutionalismus seinen eigentlichen
Zweck als Werkzeug der fürstlichen Souveränetät
erfüllte, um so illusorischer wurde sein angeblicher
Zweck als Werkzeug der Volksinteressen. Die
vormärzliche Reaktion wirthschaftete in dem Läud-
chen trotz aller schönen Kammerreden ebenso un-
gcnirt oder noch ungenirter als anderswo. Nir-
gends hat die Zensur solche Orgien gefeiert wie
in Mannheim, wo der berüchtigte „Musterzensor"
Uria Sacharaja das Kunststück fertig brachte, den
lammfrommen Sonderling Struve in einen ganz
rabiaten Durchgänger zu verwandeln. Die badische
Bureaukratie, aus der die Regierung nach ihrem
eigenen zynischen Geständniß ein Werkzeug machen
wollte und auch wirklich zu machen wußte, das
in jedem Augenblick zerbrochen werden konnte,
lvar noch viel unfruchtbarer, als die preußische.
Ebenso stand es um die militärische Mißwirth-
schaft, die an junkerlichem Unverstand und nichts-
nutziger Mißhandlung der Mannschaften das
preußische Vorbild noch übertraf.
Eben deshalb besaß diese achselträgerische und
verrätherische Regierung allerdings auch nur eine
geringe Widerstandskraft, und als die Gewitter-
wolken der Revolution heraufzuziehen begannen,
mußte sie ihre hochmiithig sich blähenden Segel
bis zu einem gewissen Grade einziehen. Seit dem
Jahre 1846 begann das reaktionäre Unterdrückungs-
und Verfolgungssystem in Baden ein wenig nach-
zulassen. Nun aber zeigte der badische Konstitu-
tionalismus, daß er keineswegs der furchtbare
Tyrannenfeind war, den die deutsche Mitwelt in
ihm bewundert hatte. Gerade seine klügeren Köpfe
bekundeten eine sehr patriotische Neigung, mit der
trätabel gewordenen Reaktion profitable Geschäft-
chen zu machen, Geschäftchen, die sich nicht einmal,
wie bei den rheinischen Liberalen, mit greifbaren
Klasseninteressen beschönigen ließen, denn eine
große Industrie gab es in Baden noch so gut
wie gar nicht. Auf der anderen Seite stimmte
es freilich auch sehr wenig, wenn sich einzelne
Vertreter der badischen Opposition, ivie der phan-
tastisch überschwängliche Hecker, „Sozialdemokraten"
nannten, denn das waren sie nicht einmal in der
damaligen kleinbürgerlich-proletarischen Bedeutung
dieses Wortes.
Vielmehr wenn die nunmehrige Scheidung der
badischen Opposition in Liberale und Radikale den
Sinn hatte, daß die Liberalen sich als mehr oder
weniger ehrgeizige Streber und rücksichtslose Stellen-
jäger entpuppten, so waren die Radikalen zwar
ihrer ehrlichen Meinung nach revolutionäre, aber
thatsächlich kleinbürgerlich beschränkte Politiker,
deren Ideale durch die Lebensverhältnisse der Klasse
bestinimt wurden, die hinter ihnen stand. Tic
badischen Bauern und Handwerker lebten, nament-
lich im Oberlande, wo die radikale Richtung ihren
Hauptsitz hatte, in ähnlichen Zuständen, wie die
Bauern und Handwerker der benachbarten Schweiz,
und so schwebte den badischen Radikalen das Ideal
von Deutschlands Zukunft in der Gestalt einer
vergrößerten «Schweiz vor, in der Gestalt der
Föderativrepublik.
In dieser Lage, hier eine innerlich schwache,
aber hartnäckige und hinterlistige Regierung, dort
eine innerlich gespaltene, an große Worte gewöhnte,
aber in den großen Fragen des modernen Völker-
lebens rathlose Opposition, wurde Baden von der
Pariser Februarrevolution überrascht.
Es lag in der Natur der Dinge, daß der
badische Radikalismus im Laufe der revolutionären
Bewegung die Oberhand erhalten mußte. Er
war der getreueste Ausdruck der in den Massen
der Bevölkerung herrschenden Anschauungen und
schöpfte aus jeder neuen Enttäuschung, die der
Lauf der Revolution herbeiführte, neue Kraft.
Allerdings waren die voreiligen Putsche, die
Hecker im Frühjahr und Struve im September 1848
versuchten, schnell verunglückt, aber der Name
dieser Männer behielt einen ganz anderen Klang,
als der Name der liberalen Führer, etwa der
Mathy und Bassermann. Mathy war als Judas
abgethan, seitdem er bei dem Heckerzuge seinen
Freund und Wohlthäter Fickler verhaftet hatte,
und Bassermann hatte sich bei der Novemberkrise
in Berlin als Apportenträger der Manteuffelischen
Reaktion verächtlich gemacht, durch den verlogenen
Bericht an die Frankfurter Nationalversammlung
über die unheimlichen „Gestalten", die er in
Berlin gesehen haben wollte. Andere badische
Liberale hatten sich in anderer Weise kompromittirt,
so daß die Stellung der Negierung durch den
Gewinn dieser Ueberläufer mehr geschwächt als
gestärkt wurde. Sonst wurstelte die „Caniarilla"
in der alten Weise weiter, unfähig für jede durch-
greifende Reform und auch nicht einmal willig
dazu, ein Bild rathloser Schwäche, konsequent
höchstens in der Quälerei der politischen Gegner,
die sich in ihrer Geivalt befanden; so erregte die
Verschleppung des gerichtlichen Untersuchungs-
verfahrens gegen die Gefangenen, die bei den vor-
jährigen Putschen ergriffen worden waren, all-
gemeine Erbitterung im Lande.
Um so stärker organisirte sich die radikale
Partei. Sie besaß eine große Anzahl Blätter,