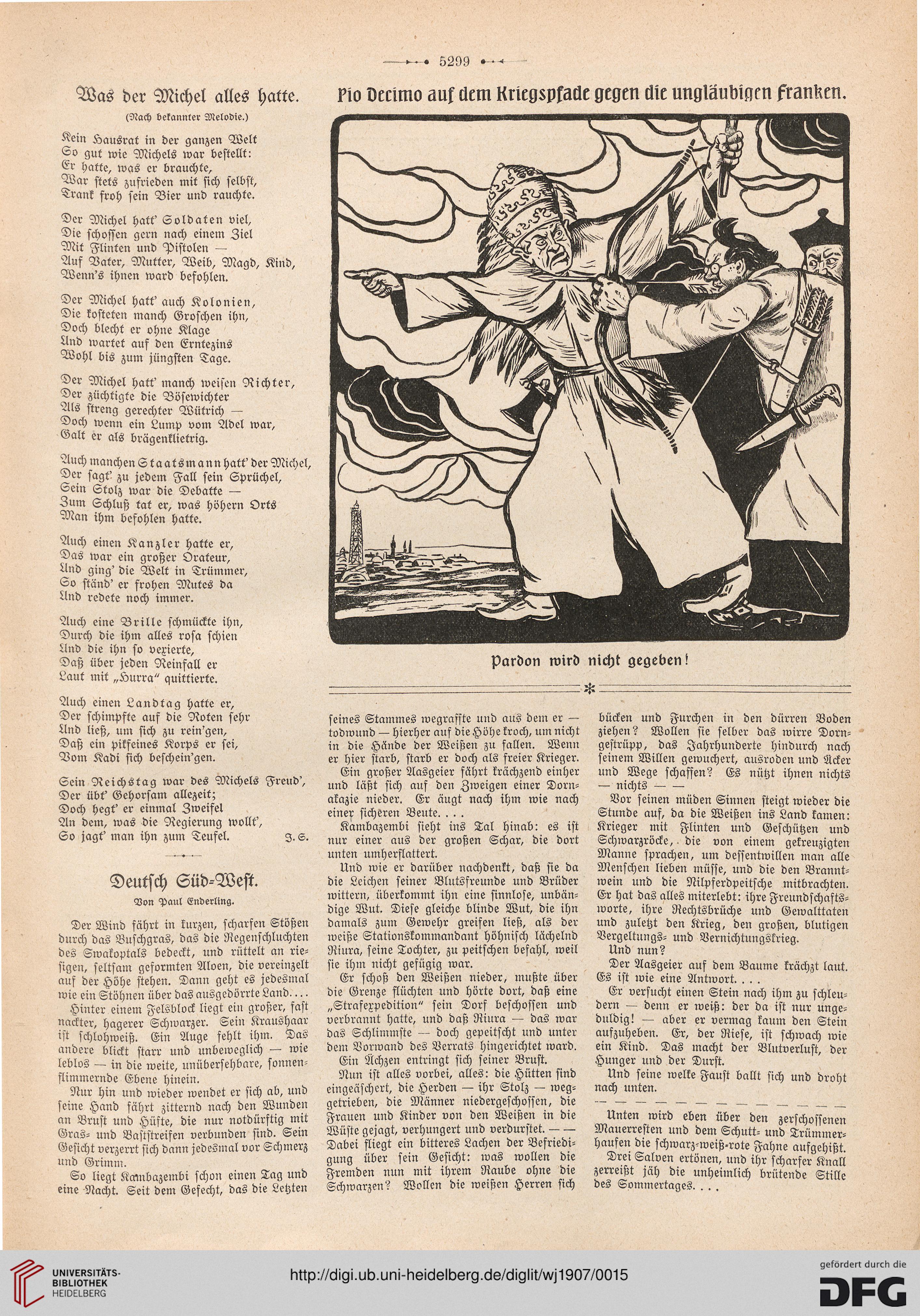5299 *-
Was der Michel alles hatte.
(Nach bekannter Melodie.)
Kein Lausrat in der ganzen Welt
So gut wie Michels war bestellt:
Er hatte, was er brauchte.
War stets zufrieden mit sich selbst,
Trank froh sein Bier und rauchte.
Der Michel hatt' Soldaten viel.
Die schossen gern nach einem Ziel
Mit Flinten und Pistolen —
Auf Vater, Mutter, Weib, Magd, Kind,
Wenn's ihnen ward besohlen.
Der Michel hatt' auch Kolonien,
Die kosteten manch Groschen ihn.
Doch blecht er ohne Klage
And wartet auf den Erntezins
Wohl bis zum jüngsten Tage.
Der Michel hatt' manch weisen Richter,
Der züchtigte die Bösewichter
Als streng gerechter Wütrich —
Dock) wenn ein Lump vom Adel war.
Galt er als brägenklietrig.
Auch manchen Staatsmann hatt' der Michel,
Der sagt! zu jedem Fall sein Sprüchel,
Sein Stolz war die Debatte —
Zum Schluß tat er, was höhern Orts
Man ihm befohlen hatte.
Auch einen Kanzler hatte er,
Das war ein großer Orateur,
And ging' die Welt in Trümmer,
So stand' er frohen Mutes da
And redete noch immer.
Auch eine Brille schmückte ihn,
Durch die ihm alles rosa schien
And die ihn so vexierte.
Daß über jeden Neinsall er
Laut mit „Lurra" quittierte.
Auch einen Landtag hatte er.
Der schimpfte aus die Roten sehr
And ließ, um sich zu rein'gen.
Daß ein pikfeines Korps er sei.
Vom Kadi sich beschein'gen.
Sein Reichstag war des Michels Freud',
Der übt' Gehorsam allezeit;
Doch hegt' er einmal Zweifel
An dem, was die Regierung wollt'.
So jagt' man ihn zum Teufel. I. e.
Deutsch Süd-West.
Von Paul Enderling.
Der Wind fährt in kurzen, scharfen Stößen
durch das Buschgras, das die Regenschluchten
des Swakoptals bedeckt, und rüttelt an rie-
sigen, seltsam geformten Aloen, die vereinzelt
auf der Höhe stehen. Dann geht es jedesmal
wie ein Stöhnen über das ausgedörrte Land—
Hinter einem Felsblock liegt ein großer, fast
nackter, hagerer Schwarzer. Sein Kraushaar
ist schlohweiß. Ein Auge fehlt ihm. Das
andere blickt starr und unbeweglich — wie
leblos — in die weite, unübersehbare, sonnen-
flimmernde Ebene hinein.
Nur hin und wieder wendet er sich ab, und
seine Hand fährt zitternd nach den Wunden
an Brust und Hüfte, die nur notdürftig mit
Gras- und Baststreifen verbunden sind. Sein
Gesicht verzerrt sich dann jedesmal vor Schmerz
und Grimm.
So liegt Kcnnbazembi schon einen Tag und
eine Nacht. Seit dem Gefecht, das die Letzten
Pio Oecuno auf dem Kriegspfade gegen die ungläubigen franken.
Pardon wird nicht gegeben!
--—_ * ——
seines Stammes wegraffte und aus dem er —
todwund — hierher auf die Höhe kroch, um nicht
in die Hände der Weißen zu fallen. Wenn
er hier starb, starb er doch als freier Krieger.
Ein großer Aasgeier fährt krächzend einher
und läßt sich auf den Zweigen einer Dorn-
akazie nieder. Er äugt nach ihm wie nach
einer sicheren Beute. . . .
Kambazembi sieht ins Tal hinab: es ist
nur einer aus der großen Schar, die dort
unten umherflattert.
Und wie er darüber nachdenkt, daß sie da
die Leichen seiner Blutsfreunde und Brüder
wittern, überkommt ihn eine sinnlose, unbän-
dige Wut. Diese gleiche blinde Wut, die ihn
damals zum Gewehr greisen ließ, als der
weiße Stationskommandant höhnisch lächelnd
Riura, seine Tochter, zu peitschen befahl, weil
sie ihm nicht gefügig war.
Er schoß den Weißen nieder, mußte über
die Grenze flüchten und hörte dort, daß eine
„Strafexpedition" sein Dorf beschossen und
verbrannt hatte, und daß Riura — das war
das Schlimmste — doch gepeitscht und unter
dem Vorwand des Verrats hingerichtet ward.
Ein Ächzen entringt sich seiner Brust.
Nun ist alles vorbei, alles: die Hütten sind
eingeäschert, die Herden — ihr Stolz — weg-
getrieben, die Männer niedergeschossen, die
Frauen und Kinder von den Weißen in die
Wüste gejagt, verhungert und verdurstet.--
Dabei fliegt ein bitteres Lachen der Befriedi-
gung über sein Gesicht: was wollen die
Fremden nun mit ihrem Raube ohne die
Schwarzen? Wollen die weißen Herren sich
bücken und Furchen in den dürren Boden
ziehen? Wollen sie selber das wirre Dorn-
gestrüpp, das Jahrhunderte hindurch nach
seinem Willen gewuchert, ausroden und Acker
und Wege schaffen? Es nützt ihnen nichts
— nichts-
Vor seinen müden Sinnen steigt wieder die
Stunde auf, da die Weißen ins Land kamen:
Krieger mit Flinten und Geschützen und
Schwarzröcke,. die von einem gekreuzigten
Manne sprachen, um dessentwillen man alle
Menschen lieben müsse, und die den Brannt-
wein und die Nilpferdpeitsche mitbrachten.
Er hat das alles miterlebt: ihre Freundschafts-
worte, ihre Rechtsbrüche und Gewalttaten
und zuletzt den Krieg, den großen, blutigen
Vergeltungs- und Vernichtungskrieg.
Und nun?
Der Aasgeier auf dem Baume krächzt laut.
Es ist wie eine Antwort. . . .
Er versucht einen Stein nach ihm zu schleu-
dern — denn er weiß: der da ist nur unge-
duldig! — aber er vermag kaum den Stein
aufzuheben. Er, der Riese, ist schwach wie
ein Kind. Das macht der Blutverlust, der
Hunger und der Durst.
Und seine welke Faust ballt sich und droht
nach unten.
Unten wird eben über den zerschossenen
Mauerresten und dem Schutt- und Trümmer-
haufen die schwarz-weiß-rote Fahne aufgehißt.
Drei Salven ertönen, und ihr scharfer Knall
zerreißt jäh die unheimlich brütende Stille
des Spmmertages. . . .
Was der Michel alles hatte.
(Nach bekannter Melodie.)
Kein Lausrat in der ganzen Welt
So gut wie Michels war bestellt:
Er hatte, was er brauchte.
War stets zufrieden mit sich selbst,
Trank froh sein Bier und rauchte.
Der Michel hatt' Soldaten viel.
Die schossen gern nach einem Ziel
Mit Flinten und Pistolen —
Auf Vater, Mutter, Weib, Magd, Kind,
Wenn's ihnen ward besohlen.
Der Michel hatt' auch Kolonien,
Die kosteten manch Groschen ihn.
Doch blecht er ohne Klage
And wartet auf den Erntezins
Wohl bis zum jüngsten Tage.
Der Michel hatt' manch weisen Richter,
Der züchtigte die Bösewichter
Als streng gerechter Wütrich —
Dock) wenn ein Lump vom Adel war.
Galt er als brägenklietrig.
Auch manchen Staatsmann hatt' der Michel,
Der sagt! zu jedem Fall sein Sprüchel,
Sein Stolz war die Debatte —
Zum Schluß tat er, was höhern Orts
Man ihm befohlen hatte.
Auch einen Kanzler hatte er,
Das war ein großer Orateur,
And ging' die Welt in Trümmer,
So stand' er frohen Mutes da
And redete noch immer.
Auch eine Brille schmückte ihn,
Durch die ihm alles rosa schien
And die ihn so vexierte.
Daß über jeden Neinsall er
Laut mit „Lurra" quittierte.
Auch einen Landtag hatte er.
Der schimpfte aus die Roten sehr
And ließ, um sich zu rein'gen.
Daß ein pikfeines Korps er sei.
Vom Kadi sich beschein'gen.
Sein Reichstag war des Michels Freud',
Der übt' Gehorsam allezeit;
Doch hegt' er einmal Zweifel
An dem, was die Regierung wollt'.
So jagt' man ihn zum Teufel. I. e.
Deutsch Süd-West.
Von Paul Enderling.
Der Wind fährt in kurzen, scharfen Stößen
durch das Buschgras, das die Regenschluchten
des Swakoptals bedeckt, und rüttelt an rie-
sigen, seltsam geformten Aloen, die vereinzelt
auf der Höhe stehen. Dann geht es jedesmal
wie ein Stöhnen über das ausgedörrte Land—
Hinter einem Felsblock liegt ein großer, fast
nackter, hagerer Schwarzer. Sein Kraushaar
ist schlohweiß. Ein Auge fehlt ihm. Das
andere blickt starr und unbeweglich — wie
leblos — in die weite, unübersehbare, sonnen-
flimmernde Ebene hinein.
Nur hin und wieder wendet er sich ab, und
seine Hand fährt zitternd nach den Wunden
an Brust und Hüfte, die nur notdürftig mit
Gras- und Baststreifen verbunden sind. Sein
Gesicht verzerrt sich dann jedesmal vor Schmerz
und Grimm.
So liegt Kcnnbazembi schon einen Tag und
eine Nacht. Seit dem Gefecht, das die Letzten
Pio Oecuno auf dem Kriegspfade gegen die ungläubigen franken.
Pardon wird nicht gegeben!
--—_ * ——
seines Stammes wegraffte und aus dem er —
todwund — hierher auf die Höhe kroch, um nicht
in die Hände der Weißen zu fallen. Wenn
er hier starb, starb er doch als freier Krieger.
Ein großer Aasgeier fährt krächzend einher
und läßt sich auf den Zweigen einer Dorn-
akazie nieder. Er äugt nach ihm wie nach
einer sicheren Beute. . . .
Kambazembi sieht ins Tal hinab: es ist
nur einer aus der großen Schar, die dort
unten umherflattert.
Und wie er darüber nachdenkt, daß sie da
die Leichen seiner Blutsfreunde und Brüder
wittern, überkommt ihn eine sinnlose, unbän-
dige Wut. Diese gleiche blinde Wut, die ihn
damals zum Gewehr greisen ließ, als der
weiße Stationskommandant höhnisch lächelnd
Riura, seine Tochter, zu peitschen befahl, weil
sie ihm nicht gefügig war.
Er schoß den Weißen nieder, mußte über
die Grenze flüchten und hörte dort, daß eine
„Strafexpedition" sein Dorf beschossen und
verbrannt hatte, und daß Riura — das war
das Schlimmste — doch gepeitscht und unter
dem Vorwand des Verrats hingerichtet ward.
Ein Ächzen entringt sich seiner Brust.
Nun ist alles vorbei, alles: die Hütten sind
eingeäschert, die Herden — ihr Stolz — weg-
getrieben, die Männer niedergeschossen, die
Frauen und Kinder von den Weißen in die
Wüste gejagt, verhungert und verdurstet.--
Dabei fliegt ein bitteres Lachen der Befriedi-
gung über sein Gesicht: was wollen die
Fremden nun mit ihrem Raube ohne die
Schwarzen? Wollen die weißen Herren sich
bücken und Furchen in den dürren Boden
ziehen? Wollen sie selber das wirre Dorn-
gestrüpp, das Jahrhunderte hindurch nach
seinem Willen gewuchert, ausroden und Acker
und Wege schaffen? Es nützt ihnen nichts
— nichts-
Vor seinen müden Sinnen steigt wieder die
Stunde auf, da die Weißen ins Land kamen:
Krieger mit Flinten und Geschützen und
Schwarzröcke,. die von einem gekreuzigten
Manne sprachen, um dessentwillen man alle
Menschen lieben müsse, und die den Brannt-
wein und die Nilpferdpeitsche mitbrachten.
Er hat das alles miterlebt: ihre Freundschafts-
worte, ihre Rechtsbrüche und Gewalttaten
und zuletzt den Krieg, den großen, blutigen
Vergeltungs- und Vernichtungskrieg.
Und nun?
Der Aasgeier auf dem Baume krächzt laut.
Es ist wie eine Antwort. . . .
Er versucht einen Stein nach ihm zu schleu-
dern — denn er weiß: der da ist nur unge-
duldig! — aber er vermag kaum den Stein
aufzuheben. Er, der Riese, ist schwach wie
ein Kind. Das macht der Blutverlust, der
Hunger und der Durst.
Und seine welke Faust ballt sich und droht
nach unten.
Unten wird eben über den zerschossenen
Mauerresten und dem Schutt- und Trümmer-
haufen die schwarz-weiß-rote Fahne aufgehißt.
Drei Salven ertönen, und ihr scharfer Knall
zerreißt jäh die unheimlich brütende Stille
des Spmmertages. . . .