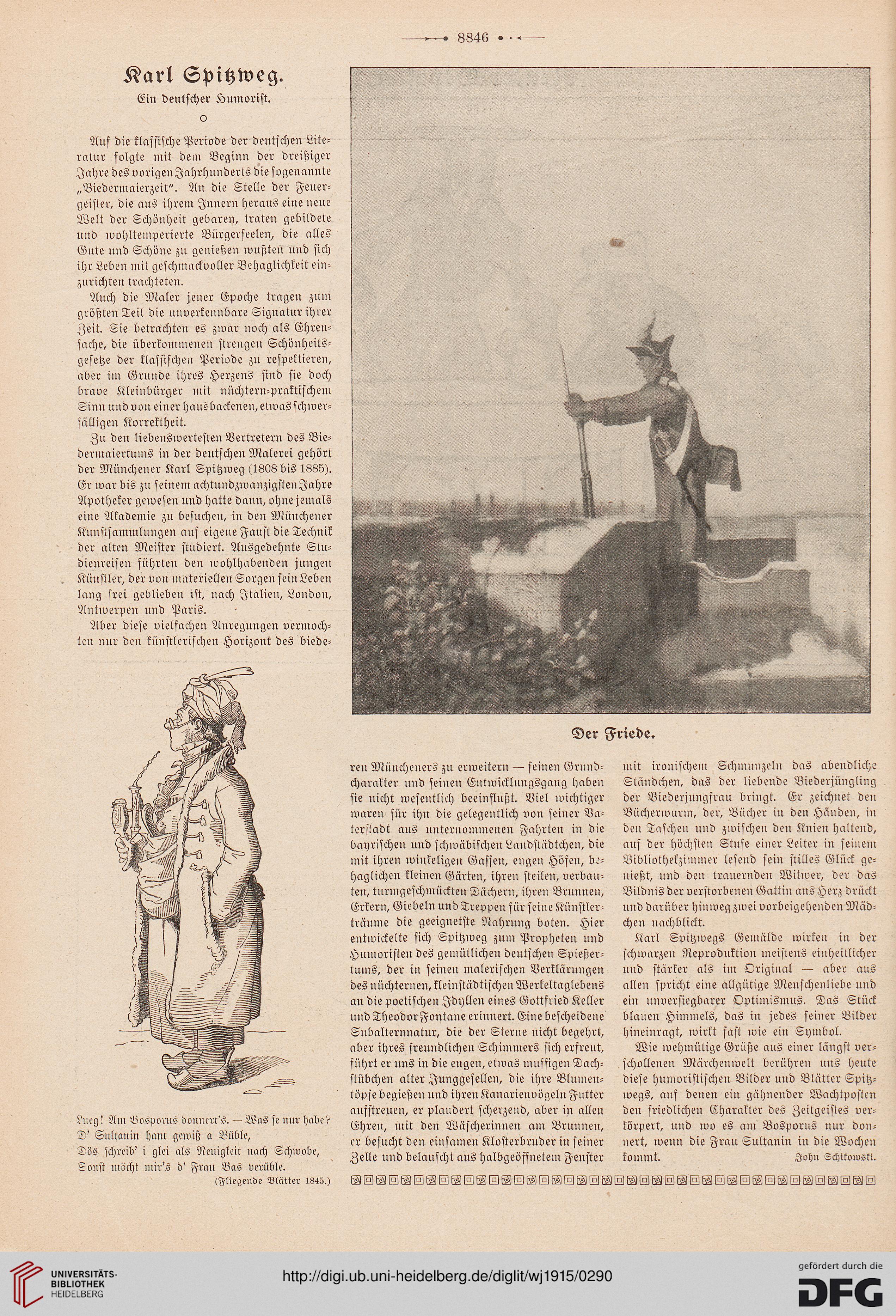8846
Der Friede.
Karl Spitzweg.
Ein deutscher Lumorist.
o
Auf die klassische Periode der deutschen Lite-
ratur folgte mit dem Beginn der dreißiger
Jahre des vorigen Jahrhunderts die sogenannte
„Biedermaierzeit". An die Stelle der Feuer-
geister, die aus ihrem Innern heraus eine neue
Welt der Schönheit gebaren, traten gebildete
und wohltemperierte Bürgerseelen, die alles
Gute und Schöne zu genießen wußten und sich
ihr Leben mit geschmackvoller Behaglichkeit ein
zurichte» trachteten.
Auch die Maler jener Epoche tragen zum
größten Teil die unverkennbare Signatur ihrer
Zeit. Sie betrachten es zwar noch als Ehren-
sache, die überkommenen strenge» Schönheits-
gesetze der klassischen Periode 51t respektieren,
aber im Grunde ihres Herzens sind sie doch
brave Kleinbürger mit nüchtern-praktischem
Sinn und von einer hausbackene», etivasschwer-
fälligen Korrektheit.
Zu den liebenswertesten Vertretern des Bie-
dermaiertums in der deutschen Malerei gehört
der Münchener Karl Spitzweg (1608 bis 1885).
Er war bis zu seinen: achtundzrvanzigstenJahre
Apotheker gewesen und hatte dann, ohne jemals
eine Akademie 311 besuchen, in den Münchener
Kunstsammlungen auf eigene Faust die Technik
der alten Meister studiert. Ausgedehnte Stu-
dienreisen führten den wohlhabenden jungen
Künstler, der von materiellen Sorgen sein Leben
lang frei geblieben ist, nach Italien, London,
Antwerpen und Paris.
Silier diese vielfachen Anregungen vermoch-
ten nur den künstlerischen Horizont des biede-
kueg! Am Bosporus donncrt's. - Was je nur habe?
D' Snlkanin haut gewiß a Bnblc,
Dös schreib' i glci als Neuigkeit nach Schwebe,
Sonst möcht mir's d' Frau Bas vcrüble.
Wiegende Blätter 1845.)
re» Müncheners zu erweitern — seinen Grund-
charakter und seinen Entwicklungsgang haben
sie nicht wesentlich beeinflußt. Viel wichtiger
waren für ihn die gelegentlich von seiner Va-
terstadt aus unternommenen Fahrten in die
bayrische» und schwäbischen Landstädtchen, die
mit ihren winkeligen Gassen, engen Höfen, be-
hagliche» kleinen Gärten, ihren steilen, verbau-
ten, turmgeschmückte» Dächern, ihren Brunnen,
Erkern, Giebeln und Treppen für seine Künstler-
träume die geeignetste Nahrung boten. Hier
entwickelte sich Spitziveg zum Propheten und
Humoristen des gemütlichen deutschen Spießer-
tums, der in seinen malerischen Verklärungen
des nüchternen, kleinstädtischen Werkeltaglebens
an die poetischen Idyllen eines Gottfried Keller
und TheodorFontane erinnert. Eine bescheidene
Snbalternnatur, die der Sterne nicht begehrt,
aber ihres freundliche» Schimmers sich erfreut,
führt er uns in die engen, etivas muffigen Dach-
stübchen alter Junggesellen, die ihre Blumen-
töpfe begießen und ihren Kanarienvögeln Futter
aufstreuc», er plaudert scherzend, aber in allen
Ehren, mit den Wäscherinnen am Brunnen,
er besucht den einsamen Klosterbruder in seiner
Zelle und belauscht aus halbgeöffnetem Fenster
mit ironischem Schmunzeln das abendliche
Ständchen, das der liebende Biederjüngling
der Biederjungfrau bringt. Er zeichnet den
Bücherwurm, der, Bücher in den Händen, in
den Taschen und zwischen den Knien haltend,
auf der höchsten Stufe einer Leiter in seinem
Bibliothekzimmer lesend sein stilles Glück ge-
nießt, und den trauernden Witwer, der das
Bildnis der verstorbenen Gattin ans Herz drückt
und darüber hinweg zwei vorbeigehenden Mäd-
chen nachblickt.
Karl Spitzwegs Gemälde wirken in der
schwarzen Reproduktion meistens einheitlicher
und stärker als im Original — aber aus
allen spricht eine allgütige Menschenliebe und
ein unversiegbarer Optimismus. Das Stück
blauen Himmels, das in jedes seiner Bilder
hineinragt, wirkt fast wie ein Symbol.
Wie wehmütige Grüße aus einer längst ver-
schollenen Märchenwelt berühre» uns heute
diese humoristischen Bilder und Blätter Spitz-
wegs, auf denen ein gähnender Wachtposten
den friedliche» Charakter des Zeitgeistes ver-
körpert, und wo es am Bosporus nur don-
nert, wenn die Frau Sultanin in die Wochen
kommt. John Schtkowsli.
Der Friede.
Karl Spitzweg.
Ein deutscher Lumorist.
o
Auf die klassische Periode der deutschen Lite-
ratur folgte mit dem Beginn der dreißiger
Jahre des vorigen Jahrhunderts die sogenannte
„Biedermaierzeit". An die Stelle der Feuer-
geister, die aus ihrem Innern heraus eine neue
Welt der Schönheit gebaren, traten gebildete
und wohltemperierte Bürgerseelen, die alles
Gute und Schöne zu genießen wußten und sich
ihr Leben mit geschmackvoller Behaglichkeit ein
zurichte» trachteten.
Auch die Maler jener Epoche tragen zum
größten Teil die unverkennbare Signatur ihrer
Zeit. Sie betrachten es zwar noch als Ehren-
sache, die überkommenen strenge» Schönheits-
gesetze der klassischen Periode 51t respektieren,
aber im Grunde ihres Herzens sind sie doch
brave Kleinbürger mit nüchtern-praktischem
Sinn und von einer hausbackene», etivasschwer-
fälligen Korrektheit.
Zu den liebenswertesten Vertretern des Bie-
dermaiertums in der deutschen Malerei gehört
der Münchener Karl Spitzweg (1608 bis 1885).
Er war bis zu seinen: achtundzrvanzigstenJahre
Apotheker gewesen und hatte dann, ohne jemals
eine Akademie 311 besuchen, in den Münchener
Kunstsammlungen auf eigene Faust die Technik
der alten Meister studiert. Ausgedehnte Stu-
dienreisen führten den wohlhabenden jungen
Künstler, der von materiellen Sorgen sein Leben
lang frei geblieben ist, nach Italien, London,
Antwerpen und Paris.
Silier diese vielfachen Anregungen vermoch-
ten nur den künstlerischen Horizont des biede-
kueg! Am Bosporus donncrt's. - Was je nur habe?
D' Snlkanin haut gewiß a Bnblc,
Dös schreib' i glci als Neuigkeit nach Schwebe,
Sonst möcht mir's d' Frau Bas vcrüble.
Wiegende Blätter 1845.)
re» Müncheners zu erweitern — seinen Grund-
charakter und seinen Entwicklungsgang haben
sie nicht wesentlich beeinflußt. Viel wichtiger
waren für ihn die gelegentlich von seiner Va-
terstadt aus unternommenen Fahrten in die
bayrische» und schwäbischen Landstädtchen, die
mit ihren winkeligen Gassen, engen Höfen, be-
hagliche» kleinen Gärten, ihren steilen, verbau-
ten, turmgeschmückte» Dächern, ihren Brunnen,
Erkern, Giebeln und Treppen für seine Künstler-
träume die geeignetste Nahrung boten. Hier
entwickelte sich Spitziveg zum Propheten und
Humoristen des gemütlichen deutschen Spießer-
tums, der in seinen malerischen Verklärungen
des nüchternen, kleinstädtischen Werkeltaglebens
an die poetischen Idyllen eines Gottfried Keller
und TheodorFontane erinnert. Eine bescheidene
Snbalternnatur, die der Sterne nicht begehrt,
aber ihres freundliche» Schimmers sich erfreut,
führt er uns in die engen, etivas muffigen Dach-
stübchen alter Junggesellen, die ihre Blumen-
töpfe begießen und ihren Kanarienvögeln Futter
aufstreuc», er plaudert scherzend, aber in allen
Ehren, mit den Wäscherinnen am Brunnen,
er besucht den einsamen Klosterbruder in seiner
Zelle und belauscht aus halbgeöffnetem Fenster
mit ironischem Schmunzeln das abendliche
Ständchen, das der liebende Biederjüngling
der Biederjungfrau bringt. Er zeichnet den
Bücherwurm, der, Bücher in den Händen, in
den Taschen und zwischen den Knien haltend,
auf der höchsten Stufe einer Leiter in seinem
Bibliothekzimmer lesend sein stilles Glück ge-
nießt, und den trauernden Witwer, der das
Bildnis der verstorbenen Gattin ans Herz drückt
und darüber hinweg zwei vorbeigehenden Mäd-
chen nachblickt.
Karl Spitzwegs Gemälde wirken in der
schwarzen Reproduktion meistens einheitlicher
und stärker als im Original — aber aus
allen spricht eine allgütige Menschenliebe und
ein unversiegbarer Optimismus. Das Stück
blauen Himmels, das in jedes seiner Bilder
hineinragt, wirkt fast wie ein Symbol.
Wie wehmütige Grüße aus einer längst ver-
schollenen Märchenwelt berühre» uns heute
diese humoristischen Bilder und Blätter Spitz-
wegs, auf denen ein gähnender Wachtposten
den friedliche» Charakter des Zeitgeistes ver-
körpert, und wo es am Bosporus nur don-
nert, wenn die Frau Sultanin in die Wochen
kommt. John Schtkowsli.