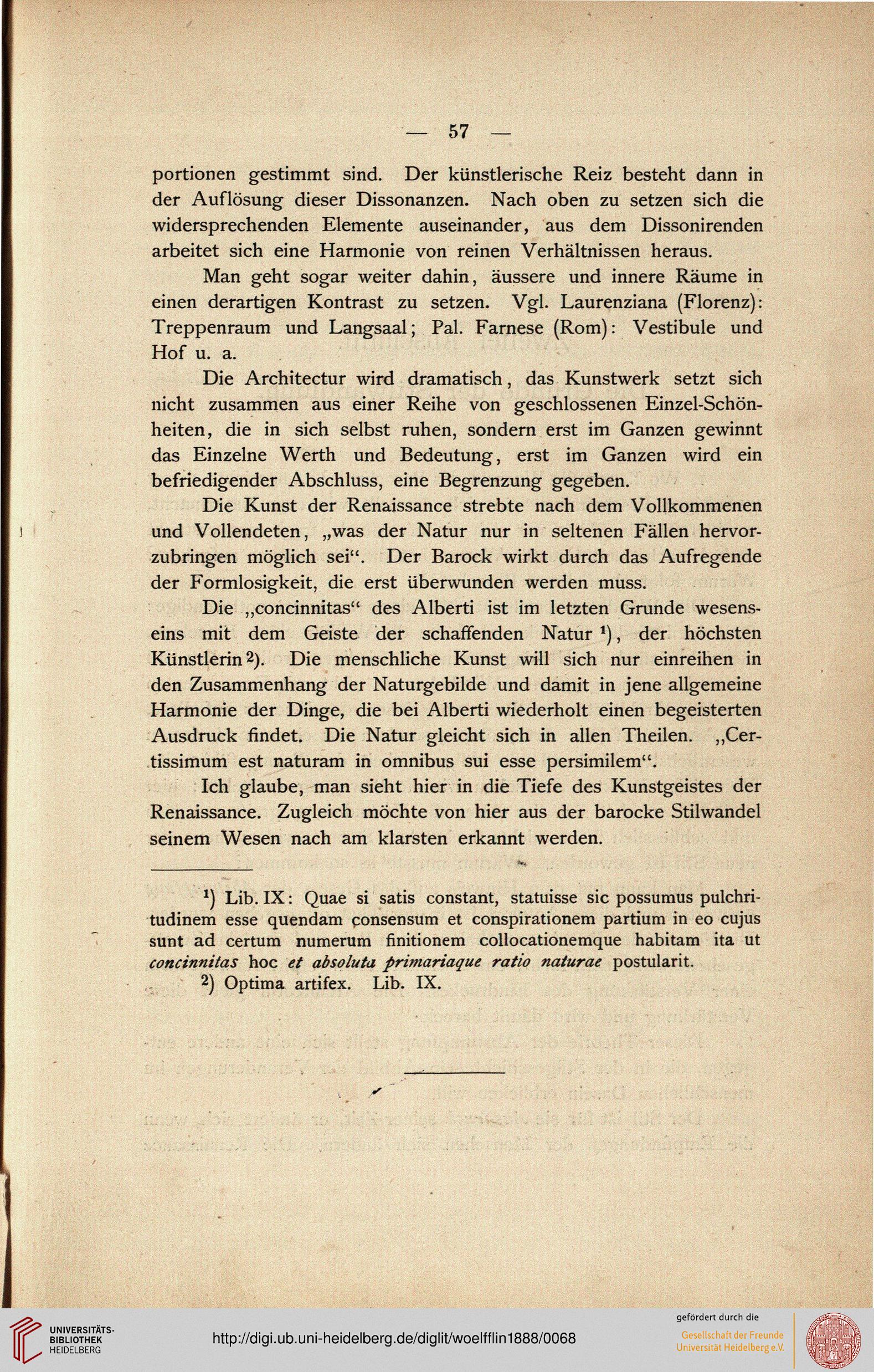— 57 —
Portionen gestimmt sind. Der künstlerische Reiz besteht dann in
der Auflösung dieser Dissonanzen. Nach oben zu setzen sich die
widersprechenden Elemente auseinander, aus dem Dissonirenden
arbeitet sich eine Harmonie von reinen Verhältnissen heraus.
Man geht sogar weiter dahin, äussere und innere Räume in
einen derartigen Kontrast zu setzen. Vgl. Laurenziana (Florenz):
Treppenraum und Langsaal; Pal. Farnese (Rom): Vestibüle und
Hof u. a.
Die Architectur wird dramatisch, das Kunstwerk setzt sich
nicht zusammen aus einer Reihe von geschlossenen Einzel-Schön-
heiten, die in sich selbst ruhen, sondern erst im Ganzen gewinnt
das Einzelne Werth und Bedeutung, erst im Ganzen wird ein
befriedigender Abschluss, eine Begrenzung gegeben.
Die Kunst der Renaissance strebte nach dem Vollkommenen
und Vollendeten, „was der Natur nur in seltenen Fällen hervor-
zubringen möglich sei". Der Barock wirkt durch das Aufregende
der Formlosigkeit, die erst überwunden werden muss.
Die „concinnitas" des Alberti ist im letzten Grunde wesens-
eins mit dem Geiste der schaffenden Natur *), der höchsten
Künstlerin2). Die menschliche Kunst will sich nur einreihen in
den Zusammenhang der Naturgebilde und damit in jene allgemeine
Harmonie der Dinge, die bei Alberti wiederholt einen begeisterten
Ausdruck findet. Die Natur gleicht sich in allen Theilen. „Cer-
tissimum est naturam in omnibus sui esse persimilem".
Ich glaube, man sieht hier in die Tiefe des Kunstgeistes der
Renaissance. Zugleich möchte von hier aus der barocke Stilwandel
seinem Wesen nach am klarsten erkannt werden.
') Lib. IX: Quae si satis constant, statuisse sie possumus pulchri-
tudinem esse quendam consensum et conspirationem partium in eo cujus
sunt ad certum numerum finitionem collocationemque habitam ita ut
concinnitas hoc et absoluta primariaque ratio naturae postularit.
2) Optima artifex. Lib. IX.
Portionen gestimmt sind. Der künstlerische Reiz besteht dann in
der Auflösung dieser Dissonanzen. Nach oben zu setzen sich die
widersprechenden Elemente auseinander, aus dem Dissonirenden
arbeitet sich eine Harmonie von reinen Verhältnissen heraus.
Man geht sogar weiter dahin, äussere und innere Räume in
einen derartigen Kontrast zu setzen. Vgl. Laurenziana (Florenz):
Treppenraum und Langsaal; Pal. Farnese (Rom): Vestibüle und
Hof u. a.
Die Architectur wird dramatisch, das Kunstwerk setzt sich
nicht zusammen aus einer Reihe von geschlossenen Einzel-Schön-
heiten, die in sich selbst ruhen, sondern erst im Ganzen gewinnt
das Einzelne Werth und Bedeutung, erst im Ganzen wird ein
befriedigender Abschluss, eine Begrenzung gegeben.
Die Kunst der Renaissance strebte nach dem Vollkommenen
und Vollendeten, „was der Natur nur in seltenen Fällen hervor-
zubringen möglich sei". Der Barock wirkt durch das Aufregende
der Formlosigkeit, die erst überwunden werden muss.
Die „concinnitas" des Alberti ist im letzten Grunde wesens-
eins mit dem Geiste der schaffenden Natur *), der höchsten
Künstlerin2). Die menschliche Kunst will sich nur einreihen in
den Zusammenhang der Naturgebilde und damit in jene allgemeine
Harmonie der Dinge, die bei Alberti wiederholt einen begeisterten
Ausdruck findet. Die Natur gleicht sich in allen Theilen. „Cer-
tissimum est naturam in omnibus sui esse persimilem".
Ich glaube, man sieht hier in die Tiefe des Kunstgeistes der
Renaissance. Zugleich möchte von hier aus der barocke Stilwandel
seinem Wesen nach am klarsten erkannt werden.
') Lib. IX: Quae si satis constant, statuisse sie possumus pulchri-
tudinem esse quendam consensum et conspirationem partium in eo cujus
sunt ad certum numerum finitionem collocationemque habitam ita ut
concinnitas hoc et absoluta primariaque ratio naturae postularit.
2) Optima artifex. Lib. IX.