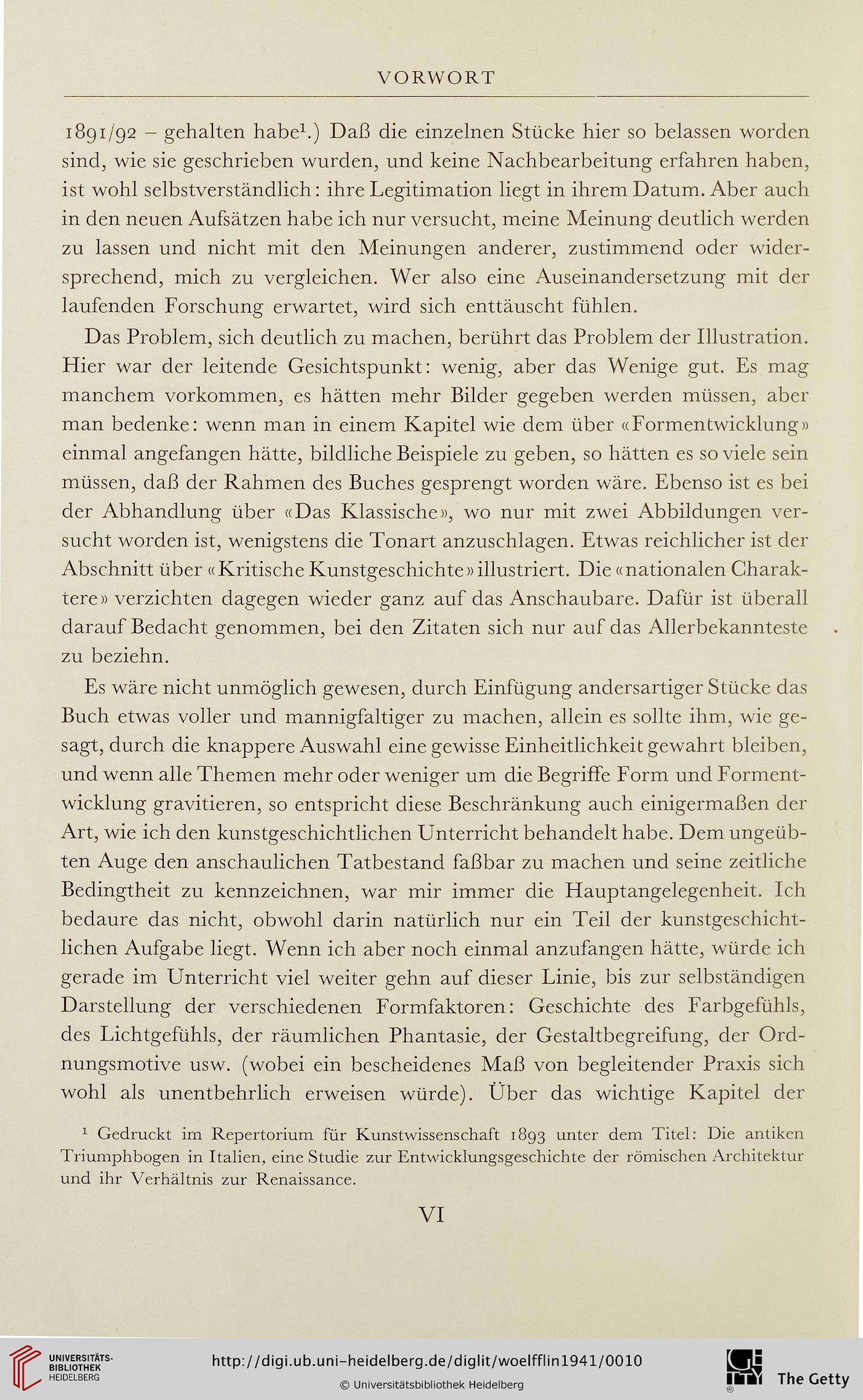VORWORT
1891/92 — gehalten habe1.) Daß die einzelnen Stücke hier so belassen worden
sind, wie sie geschrieben wurden, und keine Nachbearbeitung erfahren haben,
ist wohl selbstverständlich: ihre Legitimation liegt in ihrem Datum. Aber auch
in den neuen Aufsätzen habe ich nur versucht, meine Meinung deutlich werden
zu lassen und nicht mit den Meinungen anderer, zustimmend oder wider-
sprechend, mich zu vergleichen. Wer also eine Auseinandersetzung mit der
laufenden Forschung erwartet, wird sich enttäuscht fühlen.
Das Problem, sich deutlich zu machen, berührt das Problem der Illustration.
Hier war der leitende Gesichtspunkt: wenig, aber das Wenige gut. Es mag
manchem Vorkommen, es hätten mehr Bilder gegeben werden müssen, aber
man bedenke: wenn man in einem Kapitel wie dem über «Formentwicklung»
einmal angefangen hätte, bildliche Beispiele zu geben, so hätten es so viele sein
müssen, daß der Rahmen des Buches gesprengt worden wäre. Ebenso ist es bei
der Abhandlung über «Das Klassische», wo nur mit zwei Abbildungen ver-
sucht worden ist, wenigstens die Tonart anzuschlagen. Etwas reichlicher ist der
Abschnitt über «Kritische Kunstgeschichte» illustriert. Die «nationalen Charak-
tere» verzichten dagegen wieder ganz auf das Anschaubare. Dafür ist überall
darauf Bedacht genommen, bei den Zitaten sich nur auf das Allerbekannteste
zu beziehn.
Es wäre nicht unmöglich gewesen, durch Einfügung andersartiger Stücke das
Buch etwas voller und mannigfaltiger zu machen, allein es sollte ihm, wie ge-
sagt, durch die knappere Auswahl eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt bleiben,
und wenn alle Themen mehr oder weniger um die Begriffe Form und Forment-
wicklung gravitieren, so entspricht diese Beschränkung auch einigermaßen der
Art, wie ich den kunstgeschichtlichen Unterricht behandelt habe. Dem ungeüb-
ten Auge den anschaulichen Tatbestand faßbar zu machen und seine zeitliche
Bedingtheit zu kennzeichnen, war mir immer die Hauptangelegenheit. Ich
bedaure das nicht, obwohl darin natürlich nur ein Teil der kunstgeschicht-
lichen Aufgabe liegt. Wenn ich aber noch einmal anzufangen hätte, würde ich
gerade im Unterricht viel weiter gehn auf dieser Linie, bis zur selbständigen
Darstellung der verschiedenen Formfaktoren: Geschichte des Farbgefühls,
des Lichtgefühls, der räumlichen Phantasie, der Gestaltbegreifung, der Ord-
nungsmotive usw. (wobei ein bescheidenes Maß von begleitender Praxis sich
wohl als unentbehrlich erweisen würde). Über das wichtige Kapitel der
1 Gedruckt im Repertorium für Kunstwissenschaft 1893 unter dem Titel: Die antiken
Triumphbogen in Italien, eine Studie zur Entwicklungsgeschichte der römischen Architektur
und ihr Verhältnis zur Renaissance.
VI
1891/92 — gehalten habe1.) Daß die einzelnen Stücke hier so belassen worden
sind, wie sie geschrieben wurden, und keine Nachbearbeitung erfahren haben,
ist wohl selbstverständlich: ihre Legitimation liegt in ihrem Datum. Aber auch
in den neuen Aufsätzen habe ich nur versucht, meine Meinung deutlich werden
zu lassen und nicht mit den Meinungen anderer, zustimmend oder wider-
sprechend, mich zu vergleichen. Wer also eine Auseinandersetzung mit der
laufenden Forschung erwartet, wird sich enttäuscht fühlen.
Das Problem, sich deutlich zu machen, berührt das Problem der Illustration.
Hier war der leitende Gesichtspunkt: wenig, aber das Wenige gut. Es mag
manchem Vorkommen, es hätten mehr Bilder gegeben werden müssen, aber
man bedenke: wenn man in einem Kapitel wie dem über «Formentwicklung»
einmal angefangen hätte, bildliche Beispiele zu geben, so hätten es so viele sein
müssen, daß der Rahmen des Buches gesprengt worden wäre. Ebenso ist es bei
der Abhandlung über «Das Klassische», wo nur mit zwei Abbildungen ver-
sucht worden ist, wenigstens die Tonart anzuschlagen. Etwas reichlicher ist der
Abschnitt über «Kritische Kunstgeschichte» illustriert. Die «nationalen Charak-
tere» verzichten dagegen wieder ganz auf das Anschaubare. Dafür ist überall
darauf Bedacht genommen, bei den Zitaten sich nur auf das Allerbekannteste
zu beziehn.
Es wäre nicht unmöglich gewesen, durch Einfügung andersartiger Stücke das
Buch etwas voller und mannigfaltiger zu machen, allein es sollte ihm, wie ge-
sagt, durch die knappere Auswahl eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt bleiben,
und wenn alle Themen mehr oder weniger um die Begriffe Form und Forment-
wicklung gravitieren, so entspricht diese Beschränkung auch einigermaßen der
Art, wie ich den kunstgeschichtlichen Unterricht behandelt habe. Dem ungeüb-
ten Auge den anschaulichen Tatbestand faßbar zu machen und seine zeitliche
Bedingtheit zu kennzeichnen, war mir immer die Hauptangelegenheit. Ich
bedaure das nicht, obwohl darin natürlich nur ein Teil der kunstgeschicht-
lichen Aufgabe liegt. Wenn ich aber noch einmal anzufangen hätte, würde ich
gerade im Unterricht viel weiter gehn auf dieser Linie, bis zur selbständigen
Darstellung der verschiedenen Formfaktoren: Geschichte des Farbgefühls,
des Lichtgefühls, der räumlichen Phantasie, der Gestaltbegreifung, der Ord-
nungsmotive usw. (wobei ein bescheidenes Maß von begleitender Praxis sich
wohl als unentbehrlich erweisen würde). Über das wichtige Kapitel der
1 Gedruckt im Repertorium für Kunstwissenschaft 1893 unter dem Titel: Die antiken
Triumphbogen in Italien, eine Studie zur Entwicklungsgeschichte der römischen Architektur
und ihr Verhältnis zur Renaissance.
VI