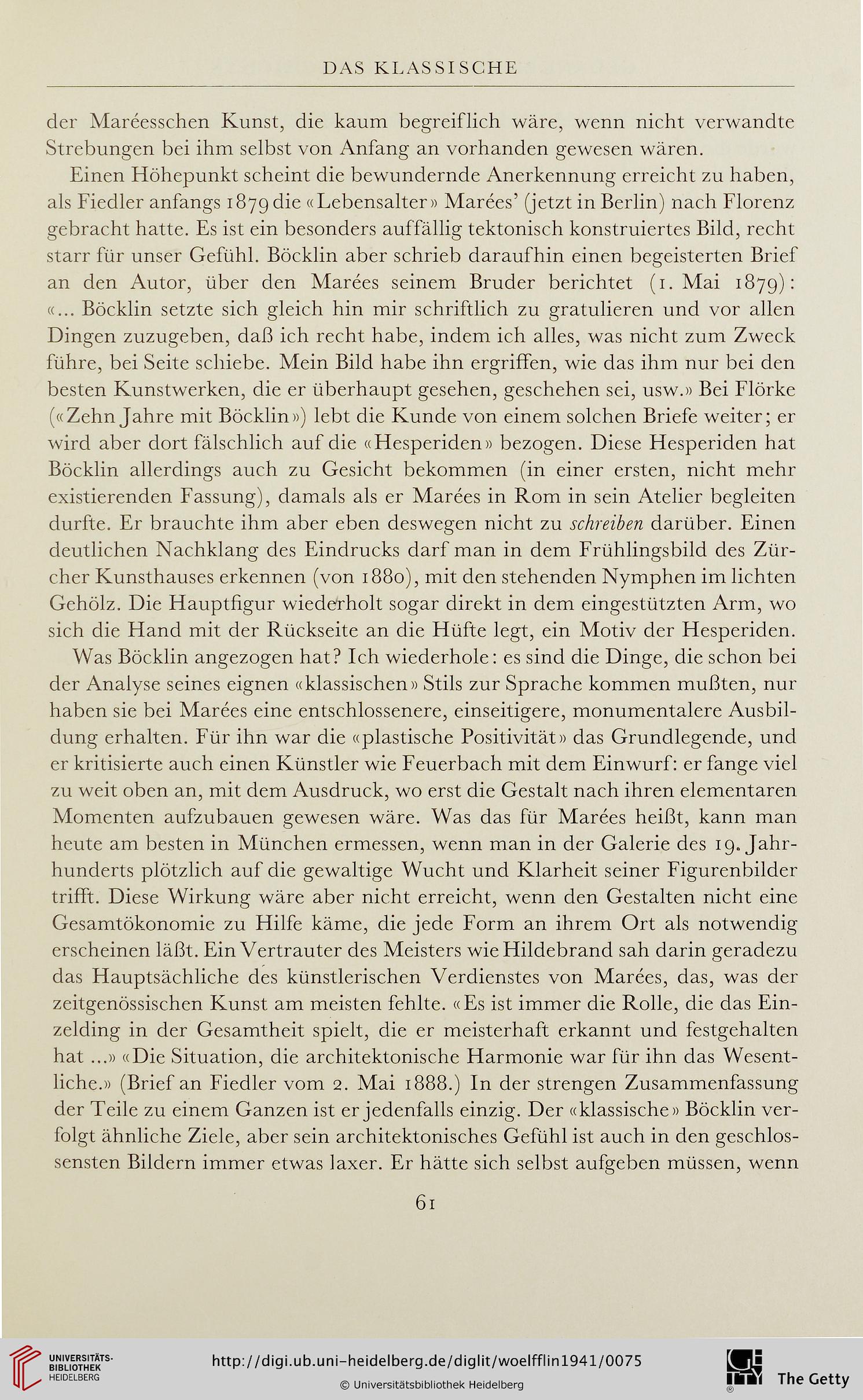DAS KLASSISCHE
der Mareesschen Kunst, die kaum begreiflich wäre, wenn nicht verwandte
Strebungen bei ihm selbst von Anfang an vorhanden gewesen wären.
Einen Höhepunkt scheint die bewundernde Anerkennung erreicht zu haben,
als Fiedler anfangs 1879 die «Lebensalter» Marees’ (jetzt in Berlin) nach Florenz
gebracht hatte. Es ist ein besonders auffällig tektonisch konstruiertes Bild, recht
starr für unser Gefühl. Böcklin aber schrieb daraufhin einen begeisterten Brief
an den Autor, über den Marees seinem Bruder berichtet (1. Mai 1879):
«... Böcklin setzte sich gleich hin mir schriftlich zu gratulieren und vor allen
Dingen zuzugeben, daß ich recht habe, indem ich alles, was nicht zum Zweck
führe, bei Seite schiebe. Mein Bild habe ihn ergriffen, wie das ihm nur bei den
besten Kunstwerken, die er überhaupt gesehen, geschehen sei, usw.» Bei Flörke
(«Zehn Jahre mit Böcklin») lebt die Kunde von einem solchen Briefe weiter; er
wird aber dort fälschlich auf die «Hesperiden» bezogen. Diese Hesperiden hat
Böcklin allerdings auch zu Gesicht bekommen (in einer ersten, nicht mehr
existierenden Fassung), damals als er Marees in Rom in sein Atelier begleiten
durfte. Er brauchte ihm aber eben deswegen nicht zu schreiben darüber. Einen
deutlichen Nachklang des Eindrucks darf man in dem Frühlingsbild des Zür-
cher Kunsthauses erkennen (von 1880), mit den stehenden Nymphen im lichten
Gehölz. Die Haupthgur wiederholt sogar direkt in dem eingestützten Arm, wo
sich die Hand mit der Rückseite an die Hüfte legt, ein Motiv der Hesperiden.
Was Böcklin angezogen hat? Ich wiederhole: es sind die Dinge, die schon bei
der Analyse seines eignen «klassischen» Stils zur Sprache kommen mußten, nur
haben sie bei Marees eine entschlossenere, einseitigere, monumentalere Ausbil-
dung erhalten. Für ihn war die «plastische Positivität» das Grundlegende, und
er kritisierte auch einen Künstler wie Feuerbach mit dem Einwurf: er fange viel
zu weit oben an, mit dem Ausdruck, wo erst die Gestalt nach ihren elementaren
Momenten aufzubauen gewesen wäre. Was das für Marees heißt, kann man
heute am besten in München ermessen, wenn man in der Galerie des 19. Jahr-
hunderts plötzlich auf die gewaltige Wucht und Klarheit seiner Figurenbilder
trifft. Diese Wirkung wäre aber nicht erreicht, wenn den Gestalten nicht eine
Gesamtökonomie zu Hilfe käme, die jede Form an ihrem Ort als notwendig
erscheinen läßt. Ein Vertrauter des Meisters wie Hildebrand sah darin geradezu
das Hauptsächliche des künstlerischen Verdienstes von Marees, das, was der
zeitgenössischen Kunst am meisten fehlte. «Es ist immer die Rolle, die das Ein-
zelding in der Gesamtheit spielt, die er meisterhaft erkannt und festgehalten
hat ...» «Die Situation, die architektonische Harmonie war für ihn das Wesent-
liche.» (Brief an Fiedler vom 2. Mai 1888.) In der strengen Zusammenfassung
der Teile zu einem Ganzen ist er jedenfalls einzig. Der «klassische» Böcklin ver-
folgt ähnliche Ziele, aber sein architektonisches Gefühl ist auch in den geschlos-
sensten Bildern immer etwas laxer. Er hätte sich selbst aufgeben müssen, wenn
61
der Mareesschen Kunst, die kaum begreiflich wäre, wenn nicht verwandte
Strebungen bei ihm selbst von Anfang an vorhanden gewesen wären.
Einen Höhepunkt scheint die bewundernde Anerkennung erreicht zu haben,
als Fiedler anfangs 1879 die «Lebensalter» Marees’ (jetzt in Berlin) nach Florenz
gebracht hatte. Es ist ein besonders auffällig tektonisch konstruiertes Bild, recht
starr für unser Gefühl. Böcklin aber schrieb daraufhin einen begeisterten Brief
an den Autor, über den Marees seinem Bruder berichtet (1. Mai 1879):
«... Böcklin setzte sich gleich hin mir schriftlich zu gratulieren und vor allen
Dingen zuzugeben, daß ich recht habe, indem ich alles, was nicht zum Zweck
führe, bei Seite schiebe. Mein Bild habe ihn ergriffen, wie das ihm nur bei den
besten Kunstwerken, die er überhaupt gesehen, geschehen sei, usw.» Bei Flörke
(«Zehn Jahre mit Böcklin») lebt die Kunde von einem solchen Briefe weiter; er
wird aber dort fälschlich auf die «Hesperiden» bezogen. Diese Hesperiden hat
Böcklin allerdings auch zu Gesicht bekommen (in einer ersten, nicht mehr
existierenden Fassung), damals als er Marees in Rom in sein Atelier begleiten
durfte. Er brauchte ihm aber eben deswegen nicht zu schreiben darüber. Einen
deutlichen Nachklang des Eindrucks darf man in dem Frühlingsbild des Zür-
cher Kunsthauses erkennen (von 1880), mit den stehenden Nymphen im lichten
Gehölz. Die Haupthgur wiederholt sogar direkt in dem eingestützten Arm, wo
sich die Hand mit der Rückseite an die Hüfte legt, ein Motiv der Hesperiden.
Was Böcklin angezogen hat? Ich wiederhole: es sind die Dinge, die schon bei
der Analyse seines eignen «klassischen» Stils zur Sprache kommen mußten, nur
haben sie bei Marees eine entschlossenere, einseitigere, monumentalere Ausbil-
dung erhalten. Für ihn war die «plastische Positivität» das Grundlegende, und
er kritisierte auch einen Künstler wie Feuerbach mit dem Einwurf: er fange viel
zu weit oben an, mit dem Ausdruck, wo erst die Gestalt nach ihren elementaren
Momenten aufzubauen gewesen wäre. Was das für Marees heißt, kann man
heute am besten in München ermessen, wenn man in der Galerie des 19. Jahr-
hunderts plötzlich auf die gewaltige Wucht und Klarheit seiner Figurenbilder
trifft. Diese Wirkung wäre aber nicht erreicht, wenn den Gestalten nicht eine
Gesamtökonomie zu Hilfe käme, die jede Form an ihrem Ort als notwendig
erscheinen läßt. Ein Vertrauter des Meisters wie Hildebrand sah darin geradezu
das Hauptsächliche des künstlerischen Verdienstes von Marees, das, was der
zeitgenössischen Kunst am meisten fehlte. «Es ist immer die Rolle, die das Ein-
zelding in der Gesamtheit spielt, die er meisterhaft erkannt und festgehalten
hat ...» «Die Situation, die architektonische Harmonie war für ihn das Wesent-
liche.» (Brief an Fiedler vom 2. Mai 1888.) In der strengen Zusammenfassung
der Teile zu einem Ganzen ist er jedenfalls einzig. Der «klassische» Böcklin ver-
folgt ähnliche Ziele, aber sein architektonisches Gefühl ist auch in den geschlos-
sensten Bildern immer etwas laxer. Er hätte sich selbst aufgeben müssen, wenn
61