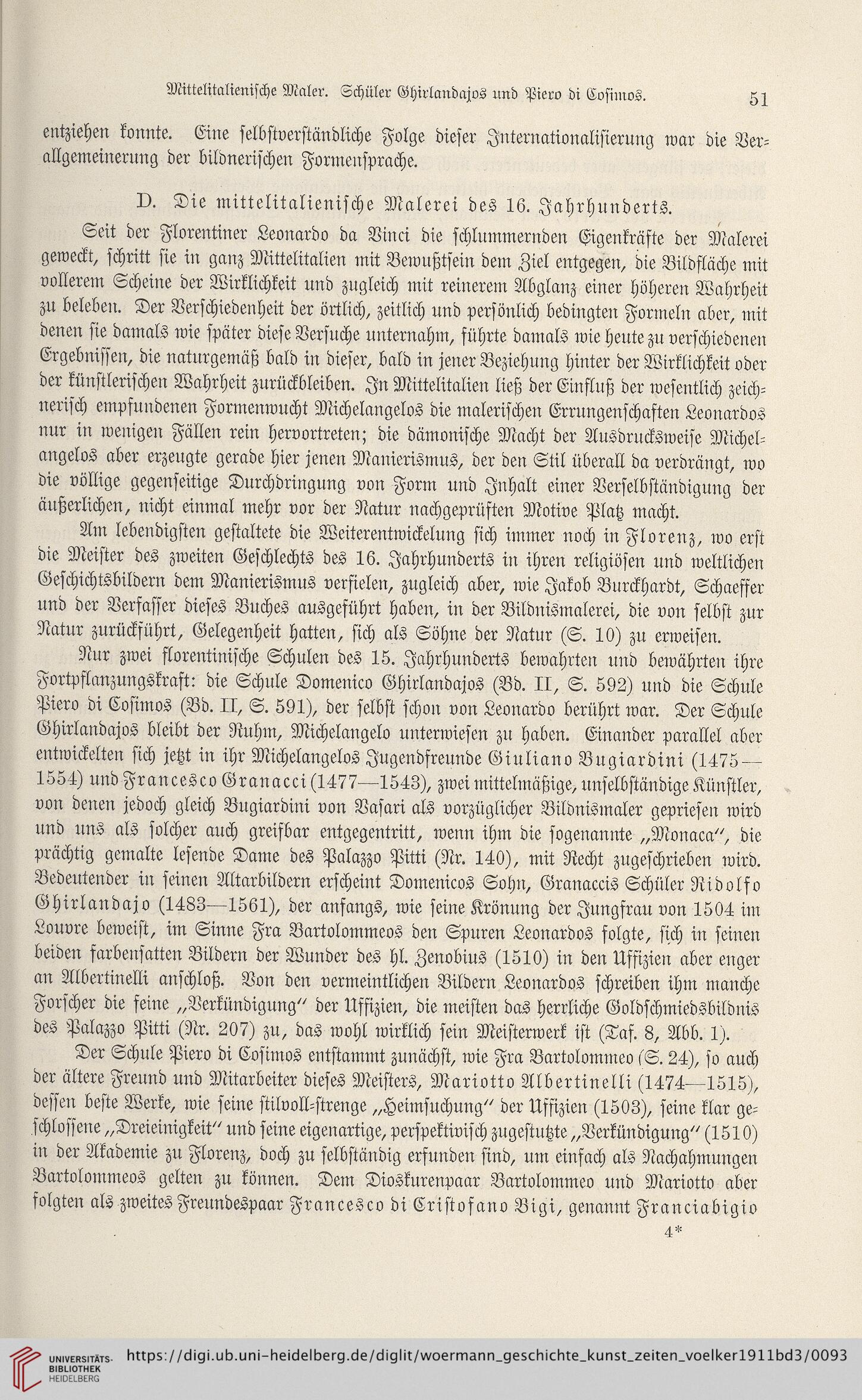Mittelitalieniſche Maler. Schüler Ghirlandajos und Piero di Coſimos. 51
entziehen konnte. Eine ſelbſtverſtändliche Folge dieſer Internationaliſierung war die Ver-
allgemeinerung der bildneriſchen Formenſprache.
D. Die mittelitalieniſche Malerei des 16. Jahrhunderts.
Seit der Florentiner Leonardo da Vinci die ſchlummernden Eigenkräfte der Malerei
geweckt, ſchritt ſie in ganz Mittelitalien mit Bewußtſein dem Ziel entgegen, die Bildfläche mit
vollerem Scheine der Wirklichkeit und zugleich mit reinerem Abglanz einer höheren Wahrheit
zu beleben. Der Verſchiedenheit der örtlich, zeitlich und perſönlich bedingten Formeln aber, mit
denen ſie damals wie ſpäter dieſe Verſuche unternahm, führte damals wie heute zu verſchiedenen
Ergebniſſen, die naturgemäß bald in dieſer, bald in jener Beziehung hinter der Wirklichkeit oder
der künſtleriſchen Wahrheit zurückbleiben. In Mittelitalien ließ der Einfluß der weſentlich zeich-
neriſch empfundenen Formenwucht Michelangelos die maleriſchen Errungenſchaften Leonardos
nur in wenigen Fällen rein hervortreten; die dämoniſche Macht der Ausdrucksweiſe Michel-
angelos aber erzeugte gerade hier jenen Manierismus, der den Stil überall da verdrängt, wo
die völlige gegenſeitige Durchdringung von Form und Inhalt einer Verſelbſtändigung der
äußerlichen, nicht einmal mehr vor der Natur nachgeprüften Motive Platz macht.
Am lebendigſten geſtaltete die Weiterentwickelung ſich immer noch in Florenz, wo erſt
die Meiſter des zweiten Geſchlechts des 16. Jahrhunderts in ihren religiöſen und weltlichen
Geſchichtsbildern dem Manierismus verfielen, zugleich aber, wie Jakob Burckhardt, Schaeffer
und der Verfaſſer dieſes Buches ausgeführt haben, in der Bildnismalerei, die von ſelbſt zur
Natur zurückführt, Gelegenheit hatten, ſich als Söhne der Natur (S. 10) zu erweiſen.
Nur zwei florentiniſche Schulen des 15. Jahrhunderts bewahrten und bewährten ihre
Fortpflanzungskraft: die Schule Domenico Ghirlandajos (Bd. II, S. 592) und die Schule
Piero di Coſimos (Bd. II, S. 591), der ſelbſt ſchon von Leonardo berührt war. Der Schule
Ghirlandajos bleibt der Ruhm, Michelangelo unterwieſen zu haben. Einander parallel aber
entwickelten ſich jetzt in ihr Michelangelos Jugendfreunde Giuliano Bugiardini (1475—
1554) und Francesco Granacci (14771543), zwei mittelmäßige, unſelbſtändige Künſtler,
von denen jedoch gleich Bugiardini von Vaſari als vorzüglicher Bildnismaler geprieſen wird
und uns als ſolcher auch greifbar entgegentritt, wenn ihm die ſogenannte „Monaca“, die
prächtig gemalte leſende Dame des Palazzo Pitti (Nr. 140), mit Recht zugeſchrieben wird.
Bedeutender in ſeinen Altarbildern erſcheint Domenicos Sohn, Granaccis Schüler Ridolfo
Ghirlandajo (14831561), der anfangs, wie ſeine Krönung der Jungfrau von 1504 im
Louvre beweiſt, im Sinne Fra Bartolommeos den Spuren Leonardos folgte, ſich in ſeinen
beiden farbenſatten Bildern der Wunder des hl. Zenobius (1510) in den Uffizien aber enger
an Albertinelli anſchloß. Von den vermeintlichen Bildern Leonardos ſchreiben ihm manche
Forſcher die feine „Verkündigung“ der Uffizien, die meiſten das herrliche Goldſchmiedsbildnis
des Palazzo Pitti (Nr. 207) zu, das wohl wirklich ſein Meiſterwerk iſt (Taf. 8, Abb. 1).
Der Schule Piero di Coſimos entſtammt zunächſt, wie Fra Bartolommeo (S. 24), ſo auch
der ältere Freund und Mitarbeiter dieſes Meiſters, Mariotto Albertinelli (1474—1515),
deſſen beſte Werke, wie ſeine ſtilvoll⸗ſtrenge „Heimſuchung“ der Uffizien (1503), ſeine klar ge-
in der Akademie zu Florenz, doch zu ſelbſtändig erfunden ſind, um einfach als Nachahmungen
Bartolommeos gelten zu können. Dem Dioskurenpaar Bartolommeo und Mariotto aber
folgten als zweites Freundespaar Francesco di Criſtofano Bigi, genannt Franciabigio
entziehen konnte. Eine ſelbſtverſtändliche Folge dieſer Internationaliſierung war die Ver-
allgemeinerung der bildneriſchen Formenſprache.
D. Die mittelitalieniſche Malerei des 16. Jahrhunderts.
Seit der Florentiner Leonardo da Vinci die ſchlummernden Eigenkräfte der Malerei
geweckt, ſchritt ſie in ganz Mittelitalien mit Bewußtſein dem Ziel entgegen, die Bildfläche mit
vollerem Scheine der Wirklichkeit und zugleich mit reinerem Abglanz einer höheren Wahrheit
zu beleben. Der Verſchiedenheit der örtlich, zeitlich und perſönlich bedingten Formeln aber, mit
denen ſie damals wie ſpäter dieſe Verſuche unternahm, führte damals wie heute zu verſchiedenen
Ergebniſſen, die naturgemäß bald in dieſer, bald in jener Beziehung hinter der Wirklichkeit oder
der künſtleriſchen Wahrheit zurückbleiben. In Mittelitalien ließ der Einfluß der weſentlich zeich-
neriſch empfundenen Formenwucht Michelangelos die maleriſchen Errungenſchaften Leonardos
nur in wenigen Fällen rein hervortreten; die dämoniſche Macht der Ausdrucksweiſe Michel-
angelos aber erzeugte gerade hier jenen Manierismus, der den Stil überall da verdrängt, wo
die völlige gegenſeitige Durchdringung von Form und Inhalt einer Verſelbſtändigung der
äußerlichen, nicht einmal mehr vor der Natur nachgeprüften Motive Platz macht.
Am lebendigſten geſtaltete die Weiterentwickelung ſich immer noch in Florenz, wo erſt
die Meiſter des zweiten Geſchlechts des 16. Jahrhunderts in ihren religiöſen und weltlichen
Geſchichtsbildern dem Manierismus verfielen, zugleich aber, wie Jakob Burckhardt, Schaeffer
und der Verfaſſer dieſes Buches ausgeführt haben, in der Bildnismalerei, die von ſelbſt zur
Natur zurückführt, Gelegenheit hatten, ſich als Söhne der Natur (S. 10) zu erweiſen.
Nur zwei florentiniſche Schulen des 15. Jahrhunderts bewahrten und bewährten ihre
Fortpflanzungskraft: die Schule Domenico Ghirlandajos (Bd. II, S. 592) und die Schule
Piero di Coſimos (Bd. II, S. 591), der ſelbſt ſchon von Leonardo berührt war. Der Schule
Ghirlandajos bleibt der Ruhm, Michelangelo unterwieſen zu haben. Einander parallel aber
entwickelten ſich jetzt in ihr Michelangelos Jugendfreunde Giuliano Bugiardini (1475—
1554) und Francesco Granacci (14771543), zwei mittelmäßige, unſelbſtändige Künſtler,
von denen jedoch gleich Bugiardini von Vaſari als vorzüglicher Bildnismaler geprieſen wird
und uns als ſolcher auch greifbar entgegentritt, wenn ihm die ſogenannte „Monaca“, die
prächtig gemalte leſende Dame des Palazzo Pitti (Nr. 140), mit Recht zugeſchrieben wird.
Bedeutender in ſeinen Altarbildern erſcheint Domenicos Sohn, Granaccis Schüler Ridolfo
Ghirlandajo (14831561), der anfangs, wie ſeine Krönung der Jungfrau von 1504 im
Louvre beweiſt, im Sinne Fra Bartolommeos den Spuren Leonardos folgte, ſich in ſeinen
beiden farbenſatten Bildern der Wunder des hl. Zenobius (1510) in den Uffizien aber enger
an Albertinelli anſchloß. Von den vermeintlichen Bildern Leonardos ſchreiben ihm manche
Forſcher die feine „Verkündigung“ der Uffizien, die meiſten das herrliche Goldſchmiedsbildnis
des Palazzo Pitti (Nr. 207) zu, das wohl wirklich ſein Meiſterwerk iſt (Taf. 8, Abb. 1).
Der Schule Piero di Coſimos entſtammt zunächſt, wie Fra Bartolommeo (S. 24), ſo auch
der ältere Freund und Mitarbeiter dieſes Meiſters, Mariotto Albertinelli (1474—1515),
deſſen beſte Werke, wie ſeine ſtilvoll⸗ſtrenge „Heimſuchung“ der Uffizien (1503), ſeine klar ge-
in der Akademie zu Florenz, doch zu ſelbſtändig erfunden ſind, um einfach als Nachahmungen
Bartolommeos gelten zu können. Dem Dioskurenpaar Bartolommeo und Mariotto aber
folgten als zweites Freundespaar Francesco di Criſtofano Bigi, genannt Franciabigio