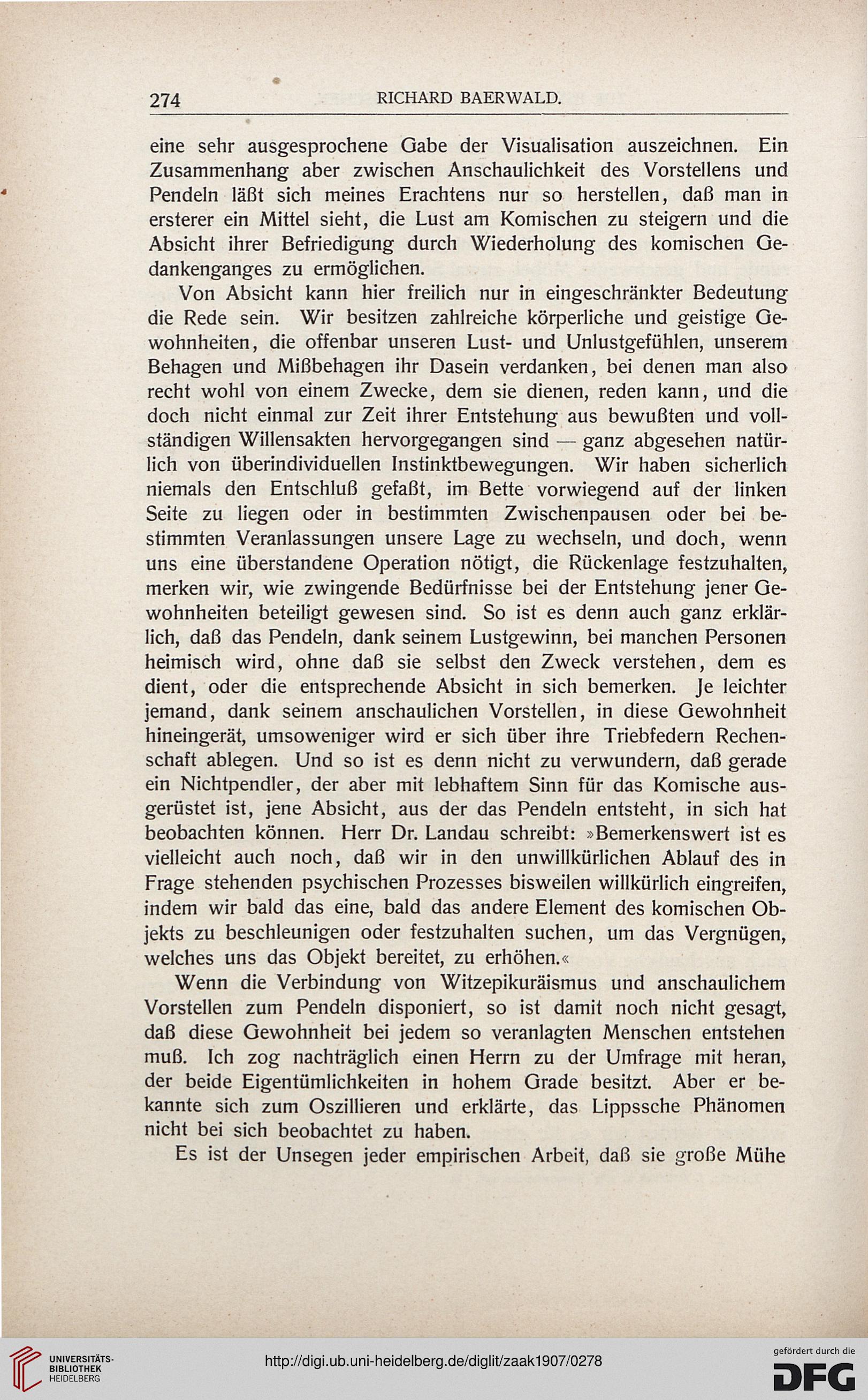274 RICHARD BAERWALD.
eine sehr ausgesprochene Gabe der Visualisation auszeichnen. Ein
Zusammenhang aber zwischen Anschaulichkeit des Vorstellens und
Pendeln läßt sich meines Erachtens nur so herstellen, daß man in
ersterer ein Mittel sieht, die Lust am Komischen zu steigern und die
Absicht ihrer Befriedigung durch Wiederholung des komischen Ge-
dankenganges zu ermöglichen.
Von Absicht kann hier freilich nur in eingeschränkter Bedeutung
die Rede sein. Wir besitzen zahlreiche körperliche und geistige Ge-
wohnheiten, die offenbar unseren Lust- und Unlustgefühlen, unserem
Behagen und Mißbehagen ihr Dasein verdanken, bei denen man also
recht wohl von einem Zwecke, dem sie dienen, reden kann, und die
doch nicht einmal zur Zeit ihrer Entstehung aus bewußten und voll-
ständigen Willensakten hervorgegangen sind — ganz abgesehen natür-
lich von überindividuellen Instinktbewegungen. Wir haben sicherlich
niemals den Entschluß gefaßt, im Bette vorwiegend auf der linken
Seite zu liegen oder in bestimmten Zwischenpausen oder bei be-
stimmten Veranlassungen unsere Lage zu wechseln, und doch, wenn
uns eine überstandene Operation nötigt, die Rückenlage festzuhalten,
merken wir, wie zwingende Bedürfnisse bei der Entstehung jener Ge-
wohnheiten beteiligt gewesen sind. So ist es denn auch ganz erklär-
lich, daß das Pendeln, dank seinem Lustgewinn, bei manchen Personen
heimisch wird, ohne daß sie selbst den Zweck verstehen, dem es
dient, oder die entsprechende Absicht in sich bemerken. Je leichter
jemand, dank seinem anschaulichen Vorstellen, in diese Gewohnheit
hineingerät, umsoweniger wird er sich über ihre Triebfedern Rechen-
schaft ablegen. Und so ist es denn nicht zu verwundern, daß gerade
ein Nichtpendler, der aber mit lebhaftem Sinn für das Komische aus-
gerüstet ist, jene Absicht, aus der das Pendeln entsteht, in sich hat
beobachten können. Herr Dr. Landau schreibt: »Bemerkenswert ist es
vielleicht auch noch, daß wir in den unwillkürlichen Ablauf des in
Frage stehenden psychischen Prozesses bisweilen willkürlich eingreifen,
indem wir bald das eine, bald das andere Element des komischen Ob-
jekts zu beschleunigen oder festzuhalten suchen, um das Vergnügen,
welches uns das Objekt bereitet, zu erhöhen.«
Wenn die Verbindung von Witzepikuräismus und anschaulichem
Vorstellen zum Pendeln disponiert, so ist damit noch nicht gesagt,
daß diese Gewohnheit bei jedem so veranlagten Menschen entstehen
muß. Ich zog nachträglich einen Herrn zu der Umfrage mit heran,
der beide Eigentümlichkeiten in hohem Grade besitzt. Aber er be-
kannte sich zum Oszillieren und erklärte, das Lippssche Phänomen
nicht bei sich beobachtet zu haben.
Es ist der Unsegen jeder empirischen Arbeit, daß sie große Mühe
eine sehr ausgesprochene Gabe der Visualisation auszeichnen. Ein
Zusammenhang aber zwischen Anschaulichkeit des Vorstellens und
Pendeln läßt sich meines Erachtens nur so herstellen, daß man in
ersterer ein Mittel sieht, die Lust am Komischen zu steigern und die
Absicht ihrer Befriedigung durch Wiederholung des komischen Ge-
dankenganges zu ermöglichen.
Von Absicht kann hier freilich nur in eingeschränkter Bedeutung
die Rede sein. Wir besitzen zahlreiche körperliche und geistige Ge-
wohnheiten, die offenbar unseren Lust- und Unlustgefühlen, unserem
Behagen und Mißbehagen ihr Dasein verdanken, bei denen man also
recht wohl von einem Zwecke, dem sie dienen, reden kann, und die
doch nicht einmal zur Zeit ihrer Entstehung aus bewußten und voll-
ständigen Willensakten hervorgegangen sind — ganz abgesehen natür-
lich von überindividuellen Instinktbewegungen. Wir haben sicherlich
niemals den Entschluß gefaßt, im Bette vorwiegend auf der linken
Seite zu liegen oder in bestimmten Zwischenpausen oder bei be-
stimmten Veranlassungen unsere Lage zu wechseln, und doch, wenn
uns eine überstandene Operation nötigt, die Rückenlage festzuhalten,
merken wir, wie zwingende Bedürfnisse bei der Entstehung jener Ge-
wohnheiten beteiligt gewesen sind. So ist es denn auch ganz erklär-
lich, daß das Pendeln, dank seinem Lustgewinn, bei manchen Personen
heimisch wird, ohne daß sie selbst den Zweck verstehen, dem es
dient, oder die entsprechende Absicht in sich bemerken. Je leichter
jemand, dank seinem anschaulichen Vorstellen, in diese Gewohnheit
hineingerät, umsoweniger wird er sich über ihre Triebfedern Rechen-
schaft ablegen. Und so ist es denn nicht zu verwundern, daß gerade
ein Nichtpendler, der aber mit lebhaftem Sinn für das Komische aus-
gerüstet ist, jene Absicht, aus der das Pendeln entsteht, in sich hat
beobachten können. Herr Dr. Landau schreibt: »Bemerkenswert ist es
vielleicht auch noch, daß wir in den unwillkürlichen Ablauf des in
Frage stehenden psychischen Prozesses bisweilen willkürlich eingreifen,
indem wir bald das eine, bald das andere Element des komischen Ob-
jekts zu beschleunigen oder festzuhalten suchen, um das Vergnügen,
welches uns das Objekt bereitet, zu erhöhen.«
Wenn die Verbindung von Witzepikuräismus und anschaulichem
Vorstellen zum Pendeln disponiert, so ist damit noch nicht gesagt,
daß diese Gewohnheit bei jedem so veranlagten Menschen entstehen
muß. Ich zog nachträglich einen Herrn zu der Umfrage mit heran,
der beide Eigentümlichkeiten in hohem Grade besitzt. Aber er be-
kannte sich zum Oszillieren und erklärte, das Lippssche Phänomen
nicht bei sich beobachtet zu haben.
Es ist der Unsegen jeder empirischen Arbeit, daß sie große Mühe