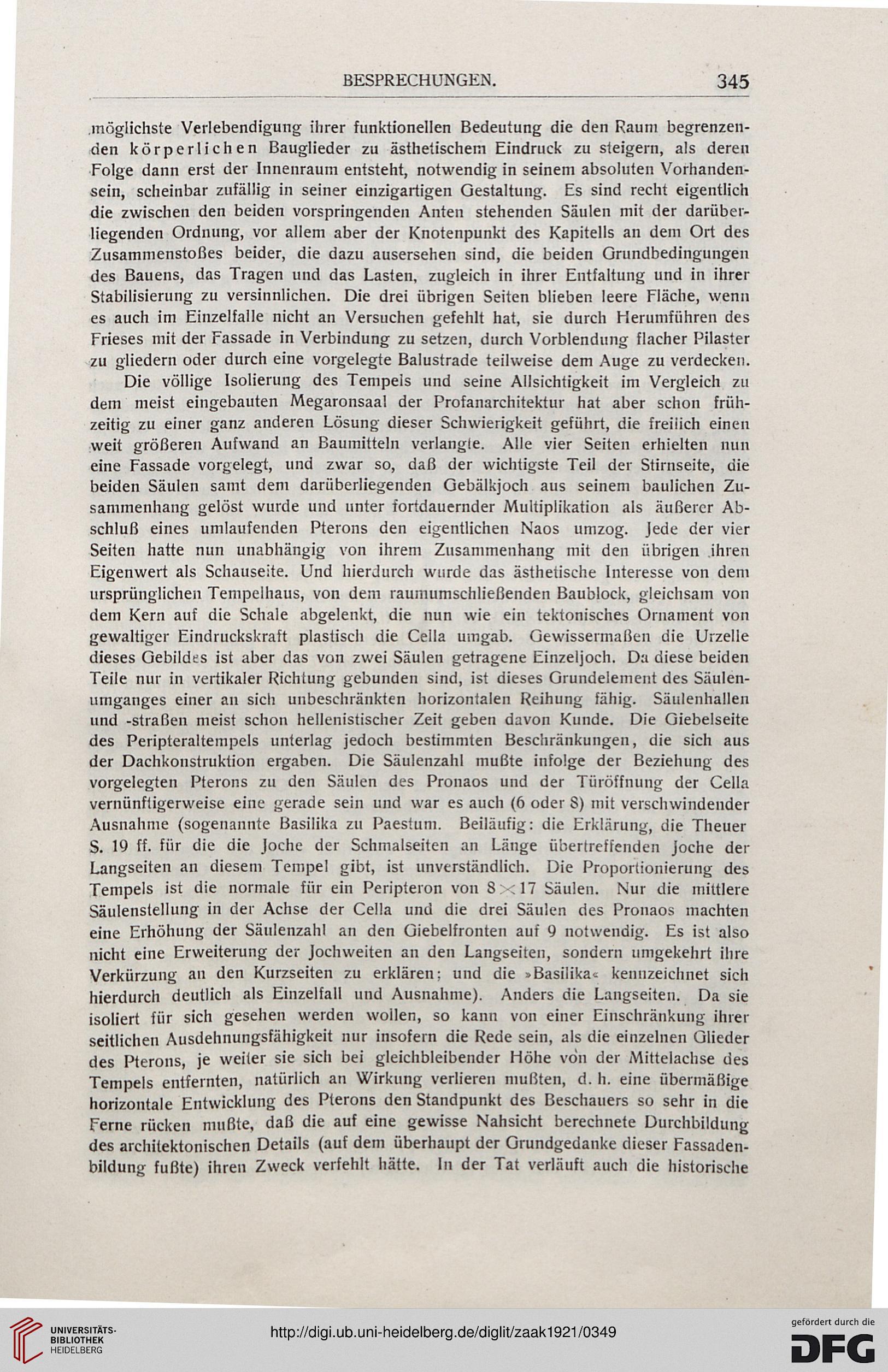BESPRECHUNGEN. 345
möglichste Verlebendigung ihrer funktionellen Bedeutung die den Raum begrenzen-
den körperlichen Bauglieder zu ästhetischem Eindruck zu steigern, als deren
Folge dann erst der Innenraum entsteht, notwendig in seinem absoluten Vorhanden-
sein, scheinbar zufällig in seiner einzigartigen Gestaltung. Es sind recht eigentlich
die zwischen den beiden vorspringenden Anten stehenden Säulen mit der darüber-
liegenden Ordnung, vor allem aber der Knotenpunkt des Kapitells an dem Ort des
Zusammenstoßes beider, die dazu ausersehen sind, die beiden Grundbedingungen
des Bauens, das Tragen und das Lasten, zugleich in ihrer Entfaltung und in ihrer
Stabilisierung zu versinnlichen. Die drei übrigen Seiten blieben leere Fläche, wenn
es auch im Einzelfalle nicht an Versuchen gefehlt hat, sie durch Herumführen des
Frieses mit der Fassade in Verbindung zu setzen, durch Vorblendung flacher Pilaster
zu gliedern oder durch eine vorgelegte Balustrade teilweise dem Auge zu verdecken.
Die völlige Isolierung des Tempeis und seine Allsichtigkeit im Vergleich zu
dem meist eingebauten Megaronsaa! der Profanarchitektur hat aber schon früh-
zeitig zu einer ganz anderen Lösung dieser Schwierigkeit geführt, die freiiich einen
weit größeren Aufwand an Baumitteln verlangte. Alle vier Seiten erhielten nun
eine Fassade vorgelegt, und zwar so, daß der wichtigste Teil der Stirnseite, die
beiden Säulen samt dem darüberliegenden Gebälkjoch aus seinem baulichen Zu-
sammenhang gelöst wurde und unter fortdauernder Multiplikation als äußerer Ab-
schluß eines umlaufenden Pterons den eigentlichen Naos umzog. Jede der vier
Seiten hatte nun unabhängig von ihrem Zusammenhang mit den übrigen .ihren
Eigenwert als Schauseite. Und hierdurch wurde das ästhetische Interesse von dem
ursprünglichen Tempelhaus, von dem raumumschließenden Baublock, gleichsam von
dem Kern auf die Schale abgelenkt, die nun wie ein tektonisches Ornament von
gewaltiger Eindruckskraft plastisch die Cella umgab. Gewissermaßen die Uizelle
dieses Gebildes ist aber das von zwei Säulen getragene Einzeljoch. Da diese beiden
Teile nur in vertikaler Richtung gebunden sind, ist dieses Grundelement des Säulen-
umganges einer an sich unbeschränkten horizontalen Reihung fähig. Säulenhallen
und -straßen meist schon hellenistischer Zeit geben davon Kunde. Die Giebelseite
des Peripteraltempels unterlag jedoch bestimmten Beschränkungen, die sich aus
der Dachkonstruktion ergaben. Die Säulenzahl mußte infolge der Beziehung des
vorgelegten Pterons zu den Säulen des Pronaos und der Türöffnung der Cella
vernünftigerweise eine gerade sein und war es auch (6 oder S) mit verschwindender
Ausnahme (sogenannte Basilika zu Paesium. Beiläufig: die Erklärung, die Theuer
S. 19 ff. für die die Joche der Schmalseiten an Länge übertreffenden Joche der
Langseiten an diesem Tempel gibt, ist unverständlich. Die Proportionierung des
Tempels ist die normale für ein Peripteron von S: < 17 Säulen. Nur die mittlere
Säulenstellung in der Achse der Cella und die drei Säulen des Pronaos machten
eine Erhöhung der Säulenzahl an den Giebelfronten auf 9 notwendig. Es ist also
nicht eine Erweiterung der Jochweiten an den Langseiten, sondern umgekehrt ihre
Verkürzung an den Kurzseiten zu erklären; und die »Basilika« kennzeichnet sich
hierdurch deutlich als Einzelfall und Ausnahme). Anders die Langseiten. Da sie
isoliert für sich gesehen werden wollen, so kann von einer Einschränkung ihrer
seitlichen Ausdehnungsfähigkeit nur insofern die Rede sein, als die einzelnen Glieder
des Pterons, je weiter sie sich bei gleichbleibender Höhe von der Mittelachse des
Tempels entfernten, natürlich an Wirkung verlieren mußten, d. h. eine übermäßige
horizontale Entwicklung des Pterons den Standpunkt des Beschauers so sehr in die
Ferne rücken mußte, daß die auf eine gewisse Nahsicht berechnete Durchbildung
des architektonischen Details (auf dem überhaupt der Grundgedanke dieser Fassaden-
bildung fußte) ihren Zweck verfehlt hätte. In der Tat verläuft auch die historische
möglichste Verlebendigung ihrer funktionellen Bedeutung die den Raum begrenzen-
den körperlichen Bauglieder zu ästhetischem Eindruck zu steigern, als deren
Folge dann erst der Innenraum entsteht, notwendig in seinem absoluten Vorhanden-
sein, scheinbar zufällig in seiner einzigartigen Gestaltung. Es sind recht eigentlich
die zwischen den beiden vorspringenden Anten stehenden Säulen mit der darüber-
liegenden Ordnung, vor allem aber der Knotenpunkt des Kapitells an dem Ort des
Zusammenstoßes beider, die dazu ausersehen sind, die beiden Grundbedingungen
des Bauens, das Tragen und das Lasten, zugleich in ihrer Entfaltung und in ihrer
Stabilisierung zu versinnlichen. Die drei übrigen Seiten blieben leere Fläche, wenn
es auch im Einzelfalle nicht an Versuchen gefehlt hat, sie durch Herumführen des
Frieses mit der Fassade in Verbindung zu setzen, durch Vorblendung flacher Pilaster
zu gliedern oder durch eine vorgelegte Balustrade teilweise dem Auge zu verdecken.
Die völlige Isolierung des Tempeis und seine Allsichtigkeit im Vergleich zu
dem meist eingebauten Megaronsaa! der Profanarchitektur hat aber schon früh-
zeitig zu einer ganz anderen Lösung dieser Schwierigkeit geführt, die freiiich einen
weit größeren Aufwand an Baumitteln verlangte. Alle vier Seiten erhielten nun
eine Fassade vorgelegt, und zwar so, daß der wichtigste Teil der Stirnseite, die
beiden Säulen samt dem darüberliegenden Gebälkjoch aus seinem baulichen Zu-
sammenhang gelöst wurde und unter fortdauernder Multiplikation als äußerer Ab-
schluß eines umlaufenden Pterons den eigentlichen Naos umzog. Jede der vier
Seiten hatte nun unabhängig von ihrem Zusammenhang mit den übrigen .ihren
Eigenwert als Schauseite. Und hierdurch wurde das ästhetische Interesse von dem
ursprünglichen Tempelhaus, von dem raumumschließenden Baublock, gleichsam von
dem Kern auf die Schale abgelenkt, die nun wie ein tektonisches Ornament von
gewaltiger Eindruckskraft plastisch die Cella umgab. Gewissermaßen die Uizelle
dieses Gebildes ist aber das von zwei Säulen getragene Einzeljoch. Da diese beiden
Teile nur in vertikaler Richtung gebunden sind, ist dieses Grundelement des Säulen-
umganges einer an sich unbeschränkten horizontalen Reihung fähig. Säulenhallen
und -straßen meist schon hellenistischer Zeit geben davon Kunde. Die Giebelseite
des Peripteraltempels unterlag jedoch bestimmten Beschränkungen, die sich aus
der Dachkonstruktion ergaben. Die Säulenzahl mußte infolge der Beziehung des
vorgelegten Pterons zu den Säulen des Pronaos und der Türöffnung der Cella
vernünftigerweise eine gerade sein und war es auch (6 oder S) mit verschwindender
Ausnahme (sogenannte Basilika zu Paesium. Beiläufig: die Erklärung, die Theuer
S. 19 ff. für die die Joche der Schmalseiten an Länge übertreffenden Joche der
Langseiten an diesem Tempel gibt, ist unverständlich. Die Proportionierung des
Tempels ist die normale für ein Peripteron von S: < 17 Säulen. Nur die mittlere
Säulenstellung in der Achse der Cella und die drei Säulen des Pronaos machten
eine Erhöhung der Säulenzahl an den Giebelfronten auf 9 notwendig. Es ist also
nicht eine Erweiterung der Jochweiten an den Langseiten, sondern umgekehrt ihre
Verkürzung an den Kurzseiten zu erklären; und die »Basilika« kennzeichnet sich
hierdurch deutlich als Einzelfall und Ausnahme). Anders die Langseiten. Da sie
isoliert für sich gesehen werden wollen, so kann von einer Einschränkung ihrer
seitlichen Ausdehnungsfähigkeit nur insofern die Rede sein, als die einzelnen Glieder
des Pterons, je weiter sie sich bei gleichbleibender Höhe von der Mittelachse des
Tempels entfernten, natürlich an Wirkung verlieren mußten, d. h. eine übermäßige
horizontale Entwicklung des Pterons den Standpunkt des Beschauers so sehr in die
Ferne rücken mußte, daß die auf eine gewisse Nahsicht berechnete Durchbildung
des architektonischen Details (auf dem überhaupt der Grundgedanke dieser Fassaden-
bildung fußte) ihren Zweck verfehlt hätte. In der Tat verläuft auch die historische