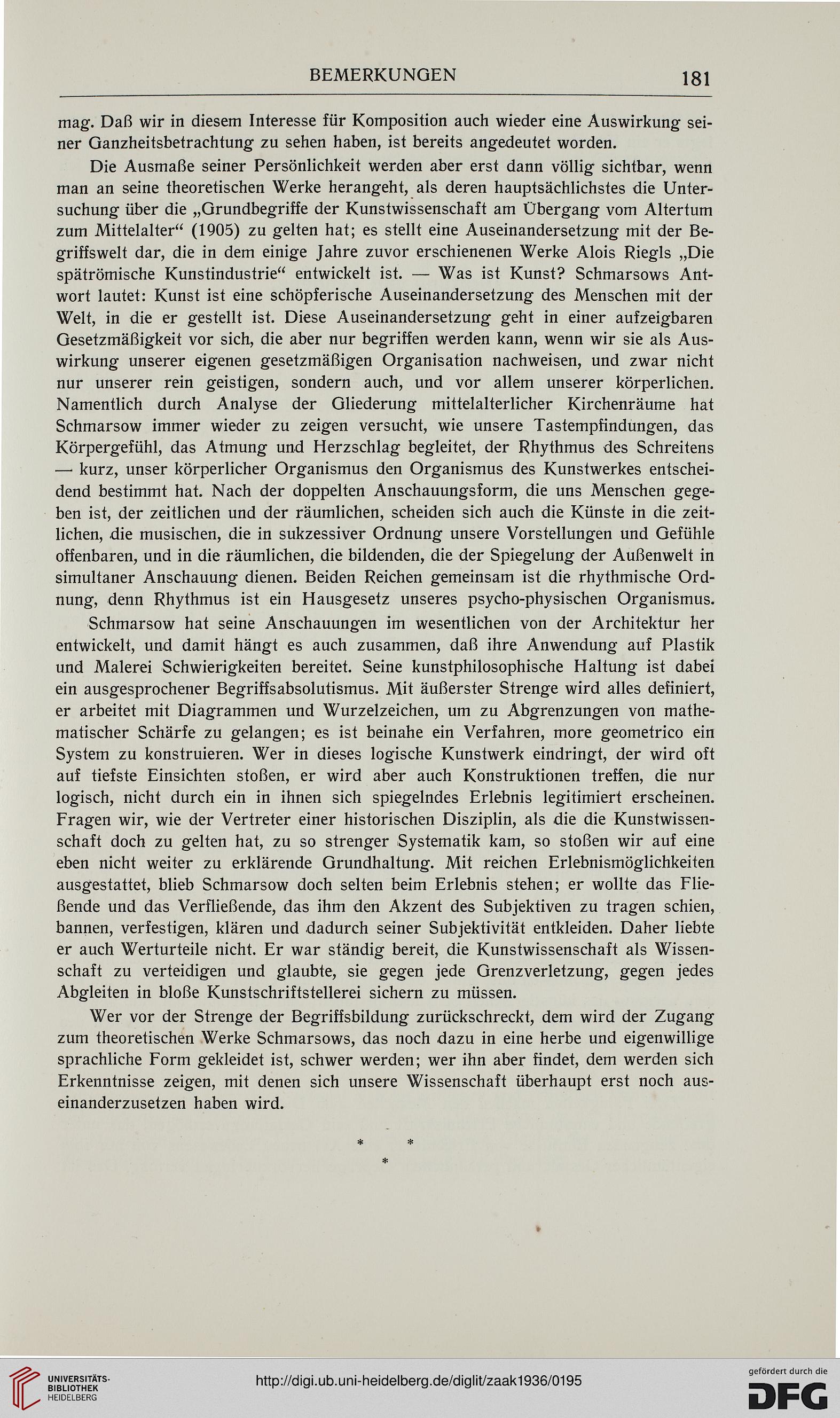BEMERKUNGEN
181
mag. Daß wir in diesem Interesse für Komposition auch wieder eine Auswirkung sei-
ner Ganzheitsbetrachtung zu sehen haben, ist bereits angedeutet worden.
Die Ausmaße seiner Persönlichkeit werden aber erst dann völlig sichtbar, wenn
man an seine theoretischen Werke herangeht, als deren hauptsächlichstes die Unter-
suchung über die „Grundbegriffe der Kunstwissenschaft am Übergang vom Altertum
zum Mittelalter" (1905) zu gelten hat; es stellt eine Auseinandersetzung mit der Be-
griffswelt dar, die in dem einige Jahre zuvor erschienenen Werke Alois Riegls „Die
spätrömische Kunstindustrie" entwickelt ist. — Was ist Kunst? Schmarsows Ant-
wort lautet: Kunst ist eine schöpferische Auseinandersetzung des Menschen mit der
Welt, in die er gestellt ist. Diese Auseinandersetzung geht in einer aufzeigbaren
Gesetzmäßigkeit vor sich, die aber nur begriffen werden kann, wenn wir sie als Aus-
wirkung unserer eigenen gesetzmäßigen Organisation nachweisen, und zwar nicht
nur unserer rein geistigen, sondern auch, und vor allem unserer körperlichen.
Namentlich durch Analyse der Gliederung mittelalterlicher Kirchenräume hat
Schmarsow immer wieder zu zeigen versucht, wie unsere Tastempfindungen, das
Körpergefühl, das Atmung und Herzschlag begleitet, der Rhythmus des Schreitens
— kurz, unser körperlicher Organismus den Organismus des Kunstwerkes entschei-
dend bestimmt hat. Nach der doppelten Anschauungsform, die uns Menschen gege-
ben ist, der zeitlichen und der räumlichen, scheiden sich auch die Künste in die zeit-
lichen, die musischen, die in sukzessiver Ordnung unsere Vorstellungen und Gefühle
offenbaren, und in die räumlichen, die bildenden, die der Spiegelung der Außenwelt in
simultaner Anschauung dienen. Beiden Reichen gemeinsam ist die rhythmische Ord-
nung, denn Rhythmus ist ein Hausgesetz unseres psycho-physischen Organismus.
Schmarsow hat seine Anschauungen im wesentlichen von der Architektur her
entwickelt, und damit hängt es auch zusammen, daß ihre Anwendung auf Plastik
und Malerei Schwierigkeiten bereitet. Seine kunstphilosophische Haltung ist dabei
ein ausgesprochener Begriffsabsolutismus. Mit äußerster Strenge wird alles definiert,
er arbeitet mit Diagrammen und Wurzelzeichen, um zu Abgrenzungen von mathe-
matischer Schärfe zu gelangen; es ist beinahe ein Verfahren, more geometrico ein
System zu konstruieren. Wer in dieses logische Kunstwerk eindringt, der wird oft
auf tiefste Einsichten stoßen, er wird aber auch Konstruktionen treffen, die nur
logisch, nicht durch ein in ihnen sich spiegelndes Erlebnis legitimiert erscheinen.
Fragen wir, wie der Vertreter einer historischen Disziplin, als die die Kunstwissen-
schaft doch zu gelten hat, zu so strenger Systematik kam, so stoßen wir auf eine
eben nicht weiter zu erklärende Grundhaltung. Mit reichen Erlebnismöglichkeiten
ausgestattet, blieb Schmarsow doch selten beim Erlebnis stehen; er wollte das Flie-
ßende und das Verfließende, das ihm den Akzent des Subjektiven zu tragen schien,
bannen, verfestigen, klären und dadurch seiner Subjektivität entkleiden. Daher liebte
er auch Werturteile nicht. Er war ständig bereit, die Kunstwissenschaft als Wissen-
schaft zu verteidigen und glaubte, sie gegen jede Grenzverletzung, gegen jedes
Abgleiten in bloße Kunstschriftstellerei sichern zu müssen.
Wer vor der Strenge der Begriffsbildung zurückschreckt, dem wird der Zugang
zum theoretischen Werke Schmarsows, das noch dazu in eine herbe und eigenwillige
sprachliche Form gekleidet ist, schwer werden; wer ihn aber findet, dem werden sich
Erkenntnisse zeigen, mit denen sich unsere Wissenschaft überhaupt erst noch aus-
einanderzusetzen haben wird.
181
mag. Daß wir in diesem Interesse für Komposition auch wieder eine Auswirkung sei-
ner Ganzheitsbetrachtung zu sehen haben, ist bereits angedeutet worden.
Die Ausmaße seiner Persönlichkeit werden aber erst dann völlig sichtbar, wenn
man an seine theoretischen Werke herangeht, als deren hauptsächlichstes die Unter-
suchung über die „Grundbegriffe der Kunstwissenschaft am Übergang vom Altertum
zum Mittelalter" (1905) zu gelten hat; es stellt eine Auseinandersetzung mit der Be-
griffswelt dar, die in dem einige Jahre zuvor erschienenen Werke Alois Riegls „Die
spätrömische Kunstindustrie" entwickelt ist. — Was ist Kunst? Schmarsows Ant-
wort lautet: Kunst ist eine schöpferische Auseinandersetzung des Menschen mit der
Welt, in die er gestellt ist. Diese Auseinandersetzung geht in einer aufzeigbaren
Gesetzmäßigkeit vor sich, die aber nur begriffen werden kann, wenn wir sie als Aus-
wirkung unserer eigenen gesetzmäßigen Organisation nachweisen, und zwar nicht
nur unserer rein geistigen, sondern auch, und vor allem unserer körperlichen.
Namentlich durch Analyse der Gliederung mittelalterlicher Kirchenräume hat
Schmarsow immer wieder zu zeigen versucht, wie unsere Tastempfindungen, das
Körpergefühl, das Atmung und Herzschlag begleitet, der Rhythmus des Schreitens
— kurz, unser körperlicher Organismus den Organismus des Kunstwerkes entschei-
dend bestimmt hat. Nach der doppelten Anschauungsform, die uns Menschen gege-
ben ist, der zeitlichen und der räumlichen, scheiden sich auch die Künste in die zeit-
lichen, die musischen, die in sukzessiver Ordnung unsere Vorstellungen und Gefühle
offenbaren, und in die räumlichen, die bildenden, die der Spiegelung der Außenwelt in
simultaner Anschauung dienen. Beiden Reichen gemeinsam ist die rhythmische Ord-
nung, denn Rhythmus ist ein Hausgesetz unseres psycho-physischen Organismus.
Schmarsow hat seine Anschauungen im wesentlichen von der Architektur her
entwickelt, und damit hängt es auch zusammen, daß ihre Anwendung auf Plastik
und Malerei Schwierigkeiten bereitet. Seine kunstphilosophische Haltung ist dabei
ein ausgesprochener Begriffsabsolutismus. Mit äußerster Strenge wird alles definiert,
er arbeitet mit Diagrammen und Wurzelzeichen, um zu Abgrenzungen von mathe-
matischer Schärfe zu gelangen; es ist beinahe ein Verfahren, more geometrico ein
System zu konstruieren. Wer in dieses logische Kunstwerk eindringt, der wird oft
auf tiefste Einsichten stoßen, er wird aber auch Konstruktionen treffen, die nur
logisch, nicht durch ein in ihnen sich spiegelndes Erlebnis legitimiert erscheinen.
Fragen wir, wie der Vertreter einer historischen Disziplin, als die die Kunstwissen-
schaft doch zu gelten hat, zu so strenger Systematik kam, so stoßen wir auf eine
eben nicht weiter zu erklärende Grundhaltung. Mit reichen Erlebnismöglichkeiten
ausgestattet, blieb Schmarsow doch selten beim Erlebnis stehen; er wollte das Flie-
ßende und das Verfließende, das ihm den Akzent des Subjektiven zu tragen schien,
bannen, verfestigen, klären und dadurch seiner Subjektivität entkleiden. Daher liebte
er auch Werturteile nicht. Er war ständig bereit, die Kunstwissenschaft als Wissen-
schaft zu verteidigen und glaubte, sie gegen jede Grenzverletzung, gegen jedes
Abgleiten in bloße Kunstschriftstellerei sichern zu müssen.
Wer vor der Strenge der Begriffsbildung zurückschreckt, dem wird der Zugang
zum theoretischen Werke Schmarsows, das noch dazu in eine herbe und eigenwillige
sprachliche Form gekleidet ist, schwer werden; wer ihn aber findet, dem werden sich
Erkenntnisse zeigen, mit denen sich unsere Wissenschaft überhaupt erst noch aus-
einanderzusetzen haben wird.