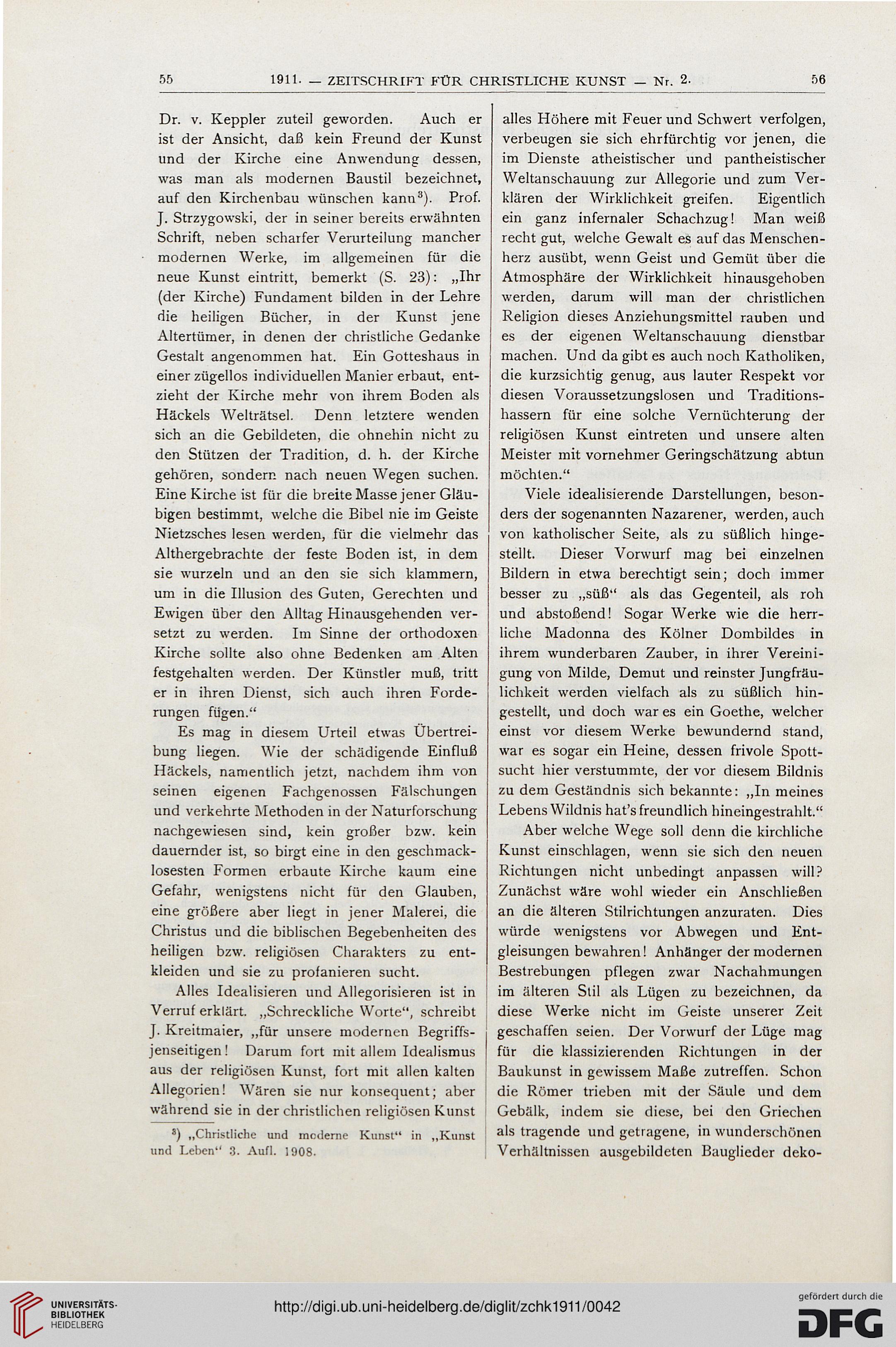55
1911. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
56
Dr. v. Keppler zuteil geworden. Auch er
ist der Ansicht, daß kein Freund der Kunst
und der Kirche eine Anwendung dessen,
was man als modernen Baustil bezeichnet,
auf den Kirchenbau wünschen kann3). Prof.
J. Strzygowski, der in seiner bereits erwähnten
Schrift, neben scharfer Verurteilung mancher
modernen Werke, im allgemeinen für die
neue Kunst eintritt, bemerkt (S. 23): „Ihr
(der Kirche) Fundament bilden in der Lehre
die heiligen Bücher, in der Kunst jene
Altertümer, in denen der christliche Gedanke
Gestalt angenommen hat. Ein Gotteshaus in
einer zügellos individuellen Manier erbaut, ent-
zieht der Kirche mehr von ihrem Boden als
Häckels Welträtsel. Denn letztere wenden
sich an die Gebildeten, die ohnehin nicht zu
den Stützen der Tradition, d. h. der Kirche
gehören, sondern nach neuen Wegen suchen.
Eine Kirche ist für die breite Masse jener Gläu-
bigen bestimmt, welche die Bibel nie im Geiste
Nietzsches lesen werden, für die vielmehr das
Althergebrachte der feste Boden ist, in dem
sie wurzeln und an den sie sich klammern,
um in die Illusion des Guten, Gerechten und
Ewigen über den Alltag Hinausgehenden ver-
setzt zu werden. Im Sinne der orthodoxen
Kirche sollte also ohne Bedenken am Alten
festgehalten werden. Der Künstler muß, tritt
er in ihren Dienst, sich auch ihren Forde-
rungen fügen."
Es mag in diesem Urteil etwas Übertrei-
bung liegen. Wie der schädigende Einfluß
Häckels, namentlich jetzt, nachdem ihm von
seinen eigenen Fachgenossen Fälschungen
und verkehrte Methoden in der Naturforschung
nachgewiesen sind, kein großer bzw. kein
dauernder ist, so birgt eine in den geschmack-
losesten Formen erbaute Kirche kaum eine
Gefahr, wenigstens nicht für den Glauben,
eine größere aber liegt in jener Malerei, die
Christus und die biblischen Begebenheiten des
heiligen bzw. religiösen Charakters zu ent-
kleiden und sie zu profanieren sucht.
Alles Idealisieren und Allegorisieren ist in
Verruf erklärt. „Schreckliche Worte", schreibt
J. Kreitmaier, „für unsere modernen Begriffs-
jenseitigen ! Darum fort mit allem Idealismus
aus der religiösen Kunst, fort mit allen kalten
Allegorien! Wären sie nur konsequent; aber
während sie in der christlichen religiösen Kunst
a) „Christliche und moderne Kunst" in „Kunst
und Leben" 3. Aufl. 1908.
alles Höhere mit Feuer und Schwert verfolgen,
verbeugen sie sich ehrfürchtig vor jenen, die
im Dienste atheistischer und pantheistischer
Weltanschauung zur Allegorie und zum Ver-
klären der Wirklichkeit greifen. Eigentlich
ein ganz infernaler Schachzug! Man weiß
recht gut, welche Gewalt es auf das Menschen-
herz ausübt, wenn Geist und Gemüt über die
Atmosphäre der Wirklichkeit hinausgehoben
werden, darum will man der christlichen
Religion dieses Anziehungsmittel rauben und
es der eigenen Weltanschauung dienstbar
machen. Und da gibt es auch noch Katholiken,
die kurzsichtig genug, aus lauter Respekt vor
diesen Voraussetzungslosen und Traditions-
hassern für eine solche Vernüchterung der
religiösen Kunst eintreten und unsere alten
Meister mit vornehmer Geringschätzung abtun
möchten."
Viele idealisierende Darstellungen, beson-
ders der sogenannten Nazarener, werden, auch
von katholischer Seite, als zu süßlich hinge-
stellt. Dieser Vorwurf mag bei einzelnen
Bildern in etwa berechtigt sein; doch immer
besser zu „süß" als das Gegenteil, als roh
und abstoßend! Sogar Werke wie die herr-
liche Madonna des Kölner Dombildes in
ihrem wunderbaren Zauber, in ihrer Vereini-
gung von Milde, Demut und reinster Jungfräu-
lichkeit werden vielfach als zu süßlich hin-
gestellt, und doch war es ein Goethe, welcher
einst vor diesem Werke bewundernd stand,
war es sogar ein Heine, dessen frivole Spott-
sucht hier verstummte, der vor diesem Bildnis
zu dem Geständnis sich bekannte: „In meines
Lebens Wildnis hat's freundlich hineingestrahlt."
Aber welche Wege soll denn die kirchliche
Kunst einschlagen, wenn sie sich den neuen
Richtungen nicht unbedingt anpassen will?
Zunächst wäre wohl wieder ein Anschließen
an die älteren Stilrichtungen anzuraten. Dies
würde wenigstens vor Abwegen und Ent-
gleisungen bewahren! Anhänger der modernen
Bestrebungen pflegen zwar Nachahmungen
im älteren Stil als Lügen zu bezeichnen, da
diese Werke nicht im Geiste unserer Zeit
geschaffen seien. Der Vorwurf der Lüge mag
für die klassizierenden Richtungen in der
Baukunst in gewissem Maße zutreffen. Schon
die Römer trieben mit der Säule und dem
Gebälk, indem sie diese, bei den Griechen
als tragende und getragene, in wunderschönen
Verhältnissen ausgebildeten Bauglieder deko-
1911. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
56
Dr. v. Keppler zuteil geworden. Auch er
ist der Ansicht, daß kein Freund der Kunst
und der Kirche eine Anwendung dessen,
was man als modernen Baustil bezeichnet,
auf den Kirchenbau wünschen kann3). Prof.
J. Strzygowski, der in seiner bereits erwähnten
Schrift, neben scharfer Verurteilung mancher
modernen Werke, im allgemeinen für die
neue Kunst eintritt, bemerkt (S. 23): „Ihr
(der Kirche) Fundament bilden in der Lehre
die heiligen Bücher, in der Kunst jene
Altertümer, in denen der christliche Gedanke
Gestalt angenommen hat. Ein Gotteshaus in
einer zügellos individuellen Manier erbaut, ent-
zieht der Kirche mehr von ihrem Boden als
Häckels Welträtsel. Denn letztere wenden
sich an die Gebildeten, die ohnehin nicht zu
den Stützen der Tradition, d. h. der Kirche
gehören, sondern nach neuen Wegen suchen.
Eine Kirche ist für die breite Masse jener Gläu-
bigen bestimmt, welche die Bibel nie im Geiste
Nietzsches lesen werden, für die vielmehr das
Althergebrachte der feste Boden ist, in dem
sie wurzeln und an den sie sich klammern,
um in die Illusion des Guten, Gerechten und
Ewigen über den Alltag Hinausgehenden ver-
setzt zu werden. Im Sinne der orthodoxen
Kirche sollte also ohne Bedenken am Alten
festgehalten werden. Der Künstler muß, tritt
er in ihren Dienst, sich auch ihren Forde-
rungen fügen."
Es mag in diesem Urteil etwas Übertrei-
bung liegen. Wie der schädigende Einfluß
Häckels, namentlich jetzt, nachdem ihm von
seinen eigenen Fachgenossen Fälschungen
und verkehrte Methoden in der Naturforschung
nachgewiesen sind, kein großer bzw. kein
dauernder ist, so birgt eine in den geschmack-
losesten Formen erbaute Kirche kaum eine
Gefahr, wenigstens nicht für den Glauben,
eine größere aber liegt in jener Malerei, die
Christus und die biblischen Begebenheiten des
heiligen bzw. religiösen Charakters zu ent-
kleiden und sie zu profanieren sucht.
Alles Idealisieren und Allegorisieren ist in
Verruf erklärt. „Schreckliche Worte", schreibt
J. Kreitmaier, „für unsere modernen Begriffs-
jenseitigen ! Darum fort mit allem Idealismus
aus der religiösen Kunst, fort mit allen kalten
Allegorien! Wären sie nur konsequent; aber
während sie in der christlichen religiösen Kunst
a) „Christliche und moderne Kunst" in „Kunst
und Leben" 3. Aufl. 1908.
alles Höhere mit Feuer und Schwert verfolgen,
verbeugen sie sich ehrfürchtig vor jenen, die
im Dienste atheistischer und pantheistischer
Weltanschauung zur Allegorie und zum Ver-
klären der Wirklichkeit greifen. Eigentlich
ein ganz infernaler Schachzug! Man weiß
recht gut, welche Gewalt es auf das Menschen-
herz ausübt, wenn Geist und Gemüt über die
Atmosphäre der Wirklichkeit hinausgehoben
werden, darum will man der christlichen
Religion dieses Anziehungsmittel rauben und
es der eigenen Weltanschauung dienstbar
machen. Und da gibt es auch noch Katholiken,
die kurzsichtig genug, aus lauter Respekt vor
diesen Voraussetzungslosen und Traditions-
hassern für eine solche Vernüchterung der
religiösen Kunst eintreten und unsere alten
Meister mit vornehmer Geringschätzung abtun
möchten."
Viele idealisierende Darstellungen, beson-
ders der sogenannten Nazarener, werden, auch
von katholischer Seite, als zu süßlich hinge-
stellt. Dieser Vorwurf mag bei einzelnen
Bildern in etwa berechtigt sein; doch immer
besser zu „süß" als das Gegenteil, als roh
und abstoßend! Sogar Werke wie die herr-
liche Madonna des Kölner Dombildes in
ihrem wunderbaren Zauber, in ihrer Vereini-
gung von Milde, Demut und reinster Jungfräu-
lichkeit werden vielfach als zu süßlich hin-
gestellt, und doch war es ein Goethe, welcher
einst vor diesem Werke bewundernd stand,
war es sogar ein Heine, dessen frivole Spott-
sucht hier verstummte, der vor diesem Bildnis
zu dem Geständnis sich bekannte: „In meines
Lebens Wildnis hat's freundlich hineingestrahlt."
Aber welche Wege soll denn die kirchliche
Kunst einschlagen, wenn sie sich den neuen
Richtungen nicht unbedingt anpassen will?
Zunächst wäre wohl wieder ein Anschließen
an die älteren Stilrichtungen anzuraten. Dies
würde wenigstens vor Abwegen und Ent-
gleisungen bewahren! Anhänger der modernen
Bestrebungen pflegen zwar Nachahmungen
im älteren Stil als Lügen zu bezeichnen, da
diese Werke nicht im Geiste unserer Zeit
geschaffen seien. Der Vorwurf der Lüge mag
für die klassizierenden Richtungen in der
Baukunst in gewissem Maße zutreffen. Schon
die Römer trieben mit der Säule und dem
Gebälk, indem sie diese, bei den Griechen
als tragende und getragene, in wunderschönen
Verhältnissen ausgebildeten Bauglieder deko-