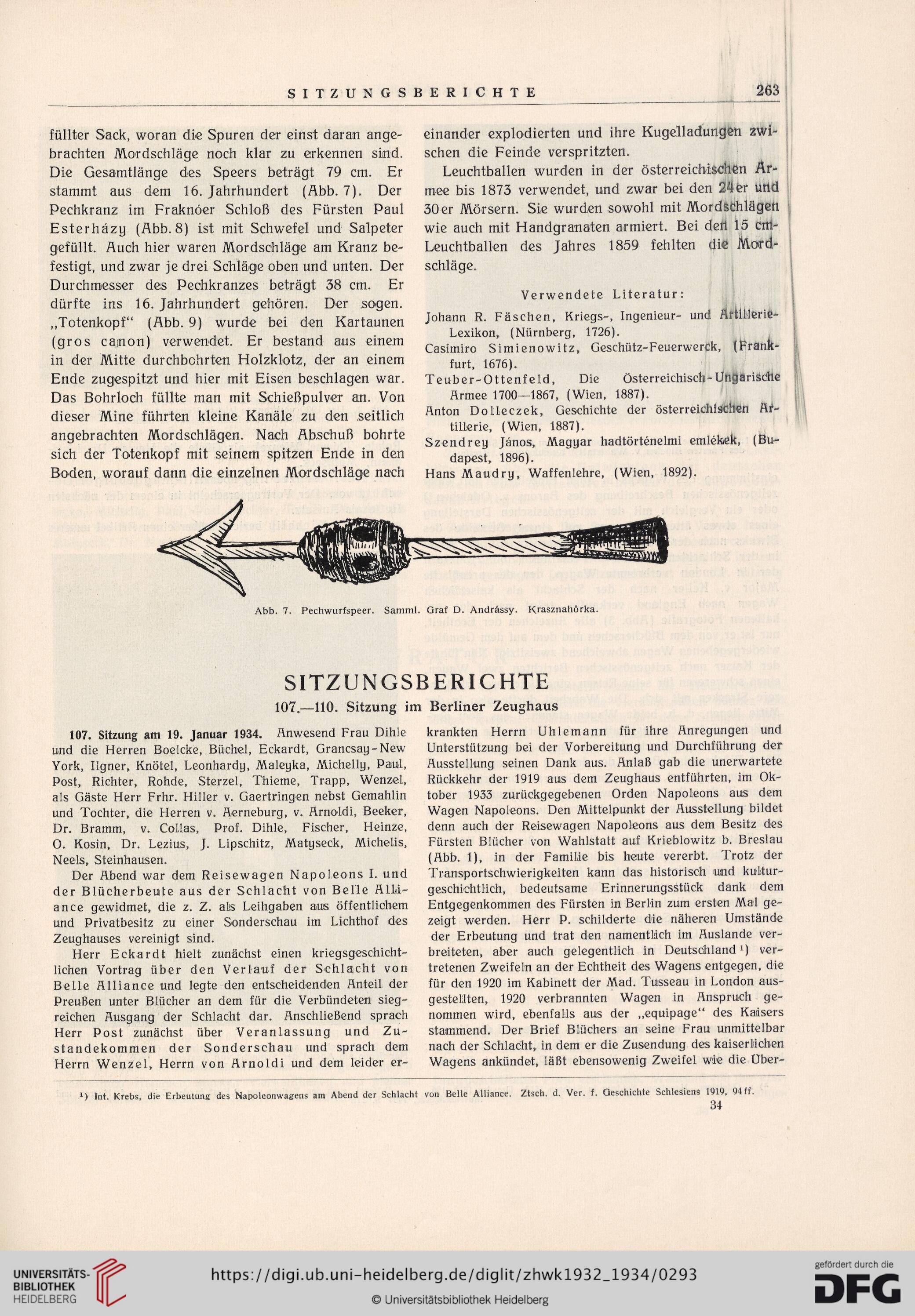SITZUNGSBERICHTE
263
füllter Sack, woran die Spuren der einst daran ange-
brachten Mordschläge noch klar zu erkennen sind.
Die Gesamtlänge des Speers beträgt 79 cm. Er
stammt aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 7). Der
Pechkranz im Fraknoer Schloß des Fürsten Paul
Esterhazy (Abb. 8) ist mit Schwefel und Salpeter
gefüllt. Auch hier waren Mordschläge am Kranz be-
festigt, und zwar je drei Schläge oben und unten. Der
Durchmesser des Pechkranzes beträgt 38 cm. Er
dürfte ins 16. Jahrhundert gehören. Der sogen.
„Totenkopf" (Abb. 9) wurde bei den Kartaunen
(gros cainon) verwendet. Er bestand aus einem
in der Mitte durchbohrten Holzklotz, der an einem
Ende zugespitzt und hier mit Eisen beschlagen war.
Das Bohrloch füllte man mit Schießpulver an. Von
dieser Mine führten kleine Kanäle zu den seitlich
angebrachten Mordschlägen. Nach Abschuß bohrte
sich der Totenkopf mit seinem spitzen Ende in den
Boden, worauf dann die einzelnen Mordschläge nach
einander explodierten und ihre Kugelladungen zwi-
schen die Feinde verspritzten.
Leuchtballen wurden in der österreichischen Ar-
mee bis 1873 verwendet, und zwar bei den 24er utld
30er Mörsern. Sie wurden sowohl mit Mordschlägen
wie auch mit Handgranaten armiert. Bei der! 15 crtl-
Leuchtballen des Jahres 1859 fehlten die Mord-
schläge.
Verwendete Literatur:
Johann R. Fäschen, Kriegs-, Ingenieur- und Artillerie-
Lexikon, (Nürnberg, 1726).
Casimiro Simienowitz, Geschütz-Feuerwerck, (Frank-
furt, 1676).
Teuber-Ottenfeld, Die Österreichisch- Ungarische
Armee 1700—1867, (Wien, 1887).
Anton Dolleczek, Geschichte der österreichischen Ar-
tillerie, (Wien, 1887).
Szendrey Jänos, Magyar hadtörtenelmi emlekek, (Bu-
dapest, 1896).
Hans Maudry, Waffenlehre, (Wien, 1892).
Abb. 7. Pechwurfspeer. Sammi. Graf D. Andrässy. Krasznahörka.
SITZUNGSBERICHTE
107.—110. Sitzung im Berliner Zeughaus
107. Sitzung am 19. Januar 1934. Anwesend Frau Dihle
und die Herren Boelcke, Büchel, Eckardt, Grancsay-New
York, Ilgner, Knötel, Leonhardy, Maleyka, Michelly, Paul,
Post, Richter, Rohde, Sterzel, Thieme, Trapp, Wenzel,
als Gäste Herr Frhr. Hiller v. Gaertringen nebst Gemahlin
und Tochter, die Herren v. Aerneburg, v. Arnoldi, Beeker,
Dr. Bramm, v. Collas, Prof. Dihle, Fischer, Heinze,
0. Kosin, Dr. Lezius, J. Lipschitz, Matyseck, Michelis,
Neels, Steinhausen.
Der Abend war dem Reisewagen Napoleons I. und
der Blücherbeute aus der Schlacht von Belle Alli-
ance gewidmet, die z. Z. als Leihgaben aus öffentlichem
und Privatbesitz zu einer Sonderschau im Lichthof des
Zeughauses vereinigt sind.
Herr Eckardt hielt zunächst einen kriegsgeschicht-
lichen Vortrag über den Verlauf der Schlacht von
Belle Alliance und legte den entscheidenden Anteil der
Preußen unter Blücher an dem für die Verbündeten sieg-
reichen Ausgang der Schlacht dar. Anschließend sprach
Herr Post zunächst über Veranlassung und Zu-
standekommen der Sonderschau und sprach dem
Herrn Wenzel, Herrn von Arnoldi und dem leider er-
krankten Herrn Uhlemann für ihre Anregungen und
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der
Ausstellung seinen Dank aus. Anlaß gab die unerwartete
Rückkehr der 1919 aus dem Zeughaus entführten, im Ok-
tober 1933 zurückgegebenen Orden Napoleons aus dem
Wagen Napoleons. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet
denn auch der Reisewagen Napoleons aus dem Besitz des
Fürsten Blücher von Wahlstatt auf Krieblowitz b. Breslau
(Abb. 1), in der Familie bis heute vererbt. Trotz der
Transportschwierigkeiten kann das historisch und kultur-
geschichtlich, bedeutsame Erinnerungsstück dank dem
Entgegenkommen des Fürsten in Berlin zum ersten Mal ge-
zeigt werden. Herr P. schilderte die näheren Umstände
der Erbeutung und trat den namentlich im Auslande ver-
breiteten, aber auch gelegentlich in Deutschland 9 ver-
tretenen Zweifeln an der Echtheit des Wagens entgegen, die
für den 1920 im Kabinett der Mad. Tusseau in London aus-
gestellten, 1920 verbrannten Wagen in Anspruch ge-
nommen wird, ebenfalls aus der „equipage" des Kaisers
stammend. Der Brief Blüchers an seine Frau unmittelbar
nach der Schlacht, in dem er die Zusendung des kaiserlichen
Wagens ankündet, läßt ebensowenig Zweifel wie die Uber-
') Int. Krebs, die Erbeutung des Napoleonwagens am Abend der Schlacht von Belle Alliance. Ztsch. d. Ver. f. Geschichte Schlesiens 1919, 94 ff.
34
263
füllter Sack, woran die Spuren der einst daran ange-
brachten Mordschläge noch klar zu erkennen sind.
Die Gesamtlänge des Speers beträgt 79 cm. Er
stammt aus dem 16. Jahrhundert (Abb. 7). Der
Pechkranz im Fraknoer Schloß des Fürsten Paul
Esterhazy (Abb. 8) ist mit Schwefel und Salpeter
gefüllt. Auch hier waren Mordschläge am Kranz be-
festigt, und zwar je drei Schläge oben und unten. Der
Durchmesser des Pechkranzes beträgt 38 cm. Er
dürfte ins 16. Jahrhundert gehören. Der sogen.
„Totenkopf" (Abb. 9) wurde bei den Kartaunen
(gros cainon) verwendet. Er bestand aus einem
in der Mitte durchbohrten Holzklotz, der an einem
Ende zugespitzt und hier mit Eisen beschlagen war.
Das Bohrloch füllte man mit Schießpulver an. Von
dieser Mine führten kleine Kanäle zu den seitlich
angebrachten Mordschlägen. Nach Abschuß bohrte
sich der Totenkopf mit seinem spitzen Ende in den
Boden, worauf dann die einzelnen Mordschläge nach
einander explodierten und ihre Kugelladungen zwi-
schen die Feinde verspritzten.
Leuchtballen wurden in der österreichischen Ar-
mee bis 1873 verwendet, und zwar bei den 24er utld
30er Mörsern. Sie wurden sowohl mit Mordschlägen
wie auch mit Handgranaten armiert. Bei der! 15 crtl-
Leuchtballen des Jahres 1859 fehlten die Mord-
schläge.
Verwendete Literatur:
Johann R. Fäschen, Kriegs-, Ingenieur- und Artillerie-
Lexikon, (Nürnberg, 1726).
Casimiro Simienowitz, Geschütz-Feuerwerck, (Frank-
furt, 1676).
Teuber-Ottenfeld, Die Österreichisch- Ungarische
Armee 1700—1867, (Wien, 1887).
Anton Dolleczek, Geschichte der österreichischen Ar-
tillerie, (Wien, 1887).
Szendrey Jänos, Magyar hadtörtenelmi emlekek, (Bu-
dapest, 1896).
Hans Maudry, Waffenlehre, (Wien, 1892).
Abb. 7. Pechwurfspeer. Sammi. Graf D. Andrässy. Krasznahörka.
SITZUNGSBERICHTE
107.—110. Sitzung im Berliner Zeughaus
107. Sitzung am 19. Januar 1934. Anwesend Frau Dihle
und die Herren Boelcke, Büchel, Eckardt, Grancsay-New
York, Ilgner, Knötel, Leonhardy, Maleyka, Michelly, Paul,
Post, Richter, Rohde, Sterzel, Thieme, Trapp, Wenzel,
als Gäste Herr Frhr. Hiller v. Gaertringen nebst Gemahlin
und Tochter, die Herren v. Aerneburg, v. Arnoldi, Beeker,
Dr. Bramm, v. Collas, Prof. Dihle, Fischer, Heinze,
0. Kosin, Dr. Lezius, J. Lipschitz, Matyseck, Michelis,
Neels, Steinhausen.
Der Abend war dem Reisewagen Napoleons I. und
der Blücherbeute aus der Schlacht von Belle Alli-
ance gewidmet, die z. Z. als Leihgaben aus öffentlichem
und Privatbesitz zu einer Sonderschau im Lichthof des
Zeughauses vereinigt sind.
Herr Eckardt hielt zunächst einen kriegsgeschicht-
lichen Vortrag über den Verlauf der Schlacht von
Belle Alliance und legte den entscheidenden Anteil der
Preußen unter Blücher an dem für die Verbündeten sieg-
reichen Ausgang der Schlacht dar. Anschließend sprach
Herr Post zunächst über Veranlassung und Zu-
standekommen der Sonderschau und sprach dem
Herrn Wenzel, Herrn von Arnoldi und dem leider er-
krankten Herrn Uhlemann für ihre Anregungen und
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der
Ausstellung seinen Dank aus. Anlaß gab die unerwartete
Rückkehr der 1919 aus dem Zeughaus entführten, im Ok-
tober 1933 zurückgegebenen Orden Napoleons aus dem
Wagen Napoleons. Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet
denn auch der Reisewagen Napoleons aus dem Besitz des
Fürsten Blücher von Wahlstatt auf Krieblowitz b. Breslau
(Abb. 1), in der Familie bis heute vererbt. Trotz der
Transportschwierigkeiten kann das historisch und kultur-
geschichtlich, bedeutsame Erinnerungsstück dank dem
Entgegenkommen des Fürsten in Berlin zum ersten Mal ge-
zeigt werden. Herr P. schilderte die näheren Umstände
der Erbeutung und trat den namentlich im Auslande ver-
breiteten, aber auch gelegentlich in Deutschland 9 ver-
tretenen Zweifeln an der Echtheit des Wagens entgegen, die
für den 1920 im Kabinett der Mad. Tusseau in London aus-
gestellten, 1920 verbrannten Wagen in Anspruch ge-
nommen wird, ebenfalls aus der „equipage" des Kaisers
stammend. Der Brief Blüchers an seine Frau unmittelbar
nach der Schlacht, in dem er die Zusendung des kaiserlichen
Wagens ankündet, läßt ebensowenig Zweifel wie die Uber-
') Int. Krebs, die Erbeutung des Napoleonwagens am Abend der Schlacht von Belle Alliance. Ztsch. d. Ver. f. Geschichte Schlesiens 1919, 94 ff.
34