Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
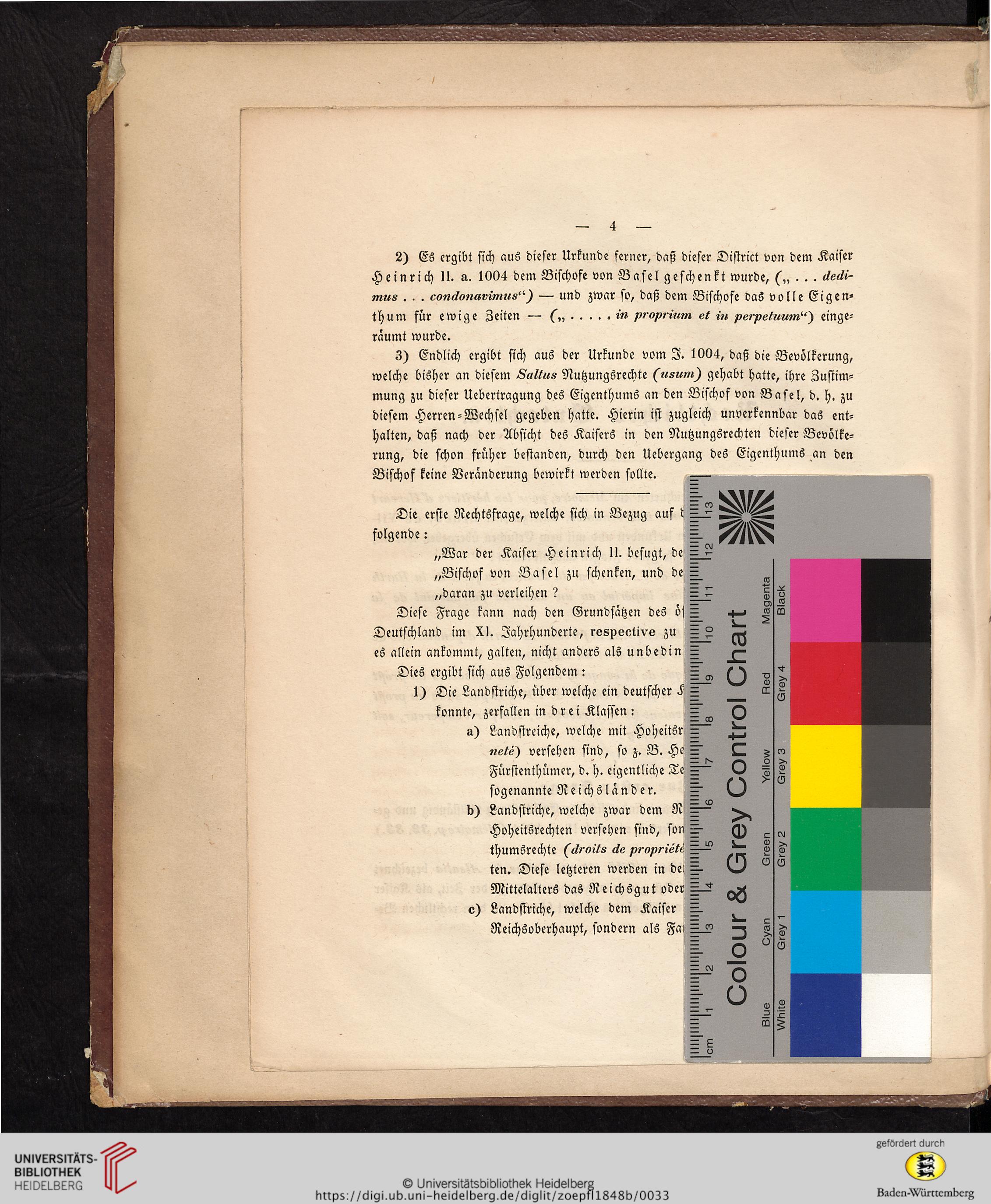
4
2) Es ergibt sich aus dieser Urkunde ferner, daß dieser District von dem Kaiser
Heinrich II. a. 1004 dem Bischöfe von Basel geschenkt wurde, („ . . .
— und zwar so, daß dem Bischöfe das volle Eigen-
thum für ewige Zeiten — („ einge-
raumt wurde.
3) Endlich ergibt sich aus der Urkunde vom I. 1004, daß die Bevölkerung,
welche bisher an diesem Nutzungsrechte gehabt hatte, ihre Zustim¬
mung zu dieser Uebertragung des Eigcnthums an den Bischof von Basel, d. h. zu
diesem Herren-Wechsel gegeben hatte. Hierin ist zugleich unverkennbar das ent-
halten, daß nach der Absicht des Kaisers in den Nutzungsrechten dieser Bevölke-
rung, die schon früher bestanden, durch den Uebergang des Eigenthums an den
Bischof keine Veränderung bewirkt werden sollte.
Die erste Rechtsfrage, welche sich in Bezug auf t
folgende:
„War der Kaiser Heinrich II. befugt, de
„Bischof von Basel zu schenken, und de
„daran zu verleihen?
Diese Frage kann nach den Grundsätzen des ö>
Deutschland im XI. Jahrhunderte, rospoativs zu
es allein ankommt, galten, nicht anders als unbedin
Dies ergibt sich aus Folgendem:
1) Die Landstriche, über welche ein deutscher F
konnte, zerfallen in drei Klassen:
») Landstreiche, welche mit Hoheitsr
versehen sind, so z. B. He
Fürstenthümer, d. h. eigentliche Te
sogenannte Neichslander.
k) Landstriche, welche zwar dem R
Hoheitsrechten versehen sind, son
thumsrechte ('-// oi/s e/e
ten. Diese letzteren werden in de^
Mittelalters das Reichsgut oder
v) Landstriche, welche dem Kaiser
Reichsoberhaupt, sondern als Fcu
2) Es ergibt sich aus dieser Urkunde ferner, daß dieser District von dem Kaiser
Heinrich II. a. 1004 dem Bischöfe von Basel geschenkt wurde, („ . . .
— und zwar so, daß dem Bischöfe das volle Eigen-
thum für ewige Zeiten — („ einge-
raumt wurde.
3) Endlich ergibt sich aus der Urkunde vom I. 1004, daß die Bevölkerung,
welche bisher an diesem Nutzungsrechte gehabt hatte, ihre Zustim¬
mung zu dieser Uebertragung des Eigcnthums an den Bischof von Basel, d. h. zu
diesem Herren-Wechsel gegeben hatte. Hierin ist zugleich unverkennbar das ent-
halten, daß nach der Absicht des Kaisers in den Nutzungsrechten dieser Bevölke-
rung, die schon früher bestanden, durch den Uebergang des Eigenthums an den
Bischof keine Veränderung bewirkt werden sollte.
Die erste Rechtsfrage, welche sich in Bezug auf t
folgende:
„War der Kaiser Heinrich II. befugt, de
„Bischof von Basel zu schenken, und de
„daran zu verleihen?
Diese Frage kann nach den Grundsätzen des ö>
Deutschland im XI. Jahrhunderte, rospoativs zu
es allein ankommt, galten, nicht anders als unbedin
Dies ergibt sich aus Folgendem:
1) Die Landstriche, über welche ein deutscher F
konnte, zerfallen in drei Klassen:
») Landstreiche, welche mit Hoheitsr
versehen sind, so z. B. He
Fürstenthümer, d. h. eigentliche Te
sogenannte Neichslander.
k) Landstriche, welche zwar dem R
Hoheitsrechten versehen sind, son
thumsrechte ('-// oi/s e/e
ten. Diese letzteren werden in de^
Mittelalters das Reichsgut oder
v) Landstriche, welche dem Kaiser
Reichsoberhaupt, sondern als Fcu



