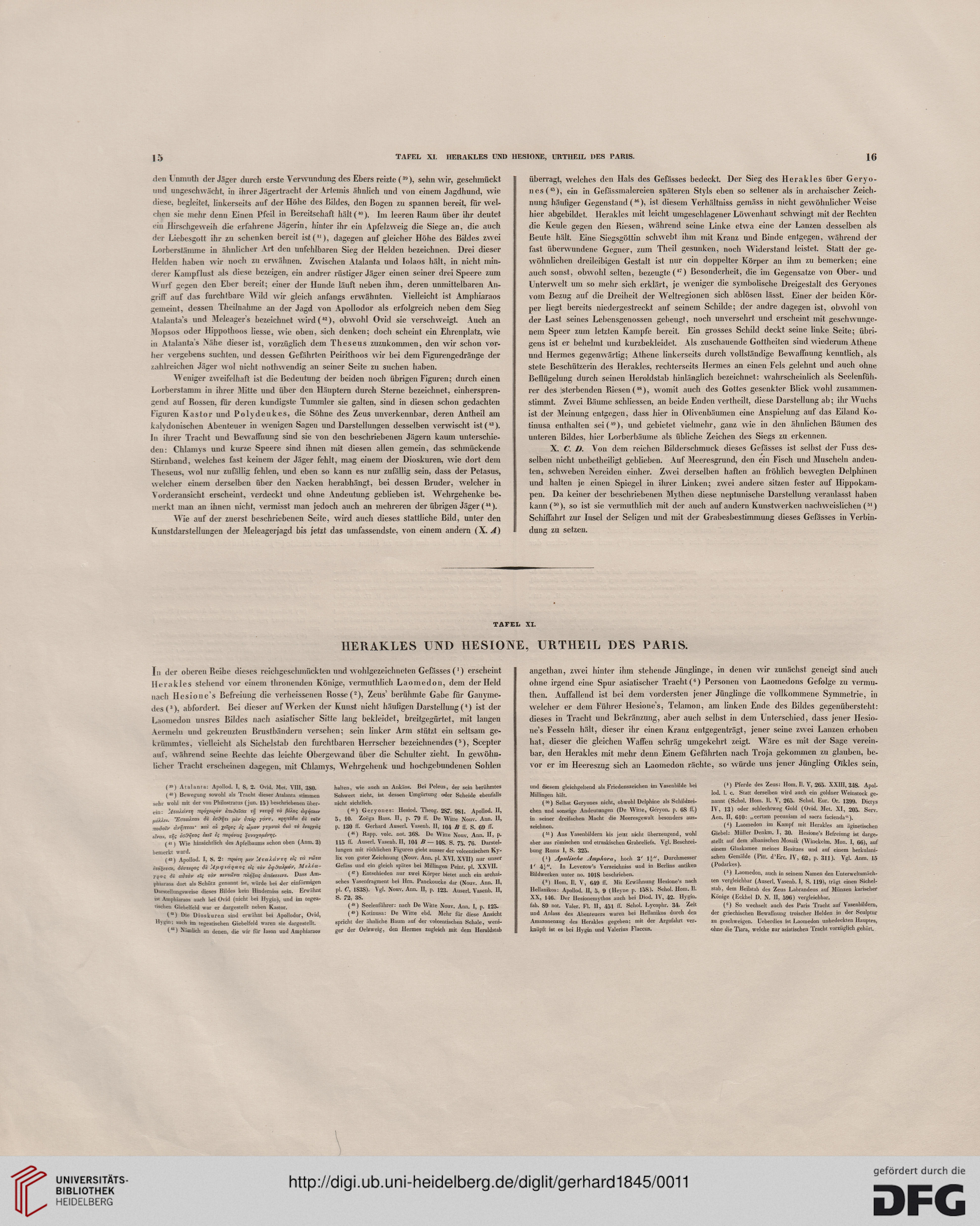15
TAFEL XI. HERAKLES UND HESIONE, URTHEIL DES PARIS.
16
den Unmuth der Jager durch erste Verwundung des Ebers reizte (39), sehn wir, geschmückt
und ungeschwächt, in ihrer Jägertracht der Artemis ähnlich und von einem Jagdhund, wie
diese, begleitet, linkerseits auf der Höhe des Bildes, den Bogen zu spannen bereit, für wel-
chen sie mehr denn Einen Pfeil in Bereitschaft hält (40). Im leeren Raum über ihr deutet
ein Hirschgeweih die erfahrene Jägerin, hinter ihr ein Apfelzweig die Siege an, die auch
der Liebesgott ihr zu schenken bereit ist (41), dagegen auf gleicher Höhe des Bildes zwei
Lorberstämme in ähnlicher Art den unfehlbaren Sieg der Helden bezeichnen. Drei dieser
Helden haben wir noch zu erwähnen. Zwischen Atalanta und Iolaos hält, in nicht min-
derer Kampflust als diese bezeigen, ein andrer rüstiger Jäger einen seiner drei Speere zum
Wurf gegen den Eber bereit; einer der Hunde läuft neben ihm, deren unmittelbaren An-
griff auf das furchtbare Wild wir gleich anfangs erwähnten. Vielleicht ist Amphiaraos
gemeint, dessen Theilnahme an der Jagd von Apollodor als erfolgreich neben dem Sieg
Atalanta's und Meleager's bezeichnet wird(42), obwohl Ovid sie verschweigt. Auch an
Mopsos oder Hippothoos Hesse, wie oben, sich denken; doch scheint ein Ehrenplatz, wie
in Atalanta's Nähe dieser ist, vorzüglich dem Theseus zuzukommen, den wir schon vor-
her vergebens suchten, und dessen Gefährten Peirithoos wir bei dem Figurengedränge der
zahlreichen Jäger wol nicht nothwendig an seiner Seite zu suchen haben.
Weniger zweifelhaft ist die Bedeutung der beiden noch übrigen Figuren; durch einen
Lorberstamm in ihrer Mitte und über den Häuptern durch Sterne bezeichnet, einherspren-
gend auf Rossen, für deren kundigste Tümmler sie galten, sind in diesen schon gedachten
Figuren Kastor und Polydeukes, die Söhne des Zeus unverkennbar, deren Antheil am
kalydonischen Abenteuer in wenigen Sagen und Darstellungen desselben verwischt ist(43).
In ihrer Tracht und Bewaffnung sind sie von den beschriebenen Jägern kaum unterschie-
den: Chlamys und kurze Speere sind ihnen mit diesen allen gemein, das schmückende
Stirnband, welches fast keinem der Jäger fehlt, mag einem der Dioskuren, wie dort dem
Theseus, wol nur zufällig fehlen, und eben so kann es nur zufällig sein, dass der Petasus,
welcher einem derselben über den Nacken herabhängt, bei dessen Bruder, welcher in
Vorderansicht erscheint, verdeckt und ohne Andeutung geblieben ist. Wehrgehenke be-
merkt man an ihnen nicht, vermisst man jedoch auch an mehreren der übrigen Jäger (u).
Wie auf der zuerst beschriebenen Seite, wird auch dieses stattliche Bild, unter den
Kunstdarstellungen der Meleagerjagd bis jetzt das umfassendste, von einem andern (X. A)
überragt, welches den Hals des Gefässes bedeckt. Der Sieg des Herakles über Geryo-
nes^), ein in Gefässmalereien späteren Styls eben so seltener als in archaischer Zeich-
nung häufiger Gegenstand (M), ist diesem Verhältniss gemäss in nicht gewöhnlicher Weise
hier abgebildet. Herakles mit leicht umgeschlagener Löwenhaut schwingt mit der Rechten
die Keule gegen den Riesen, während seine Linke etwa eine der Lanzen desselben als
Beute hält. Eine Siegsgöttin schwebt ihm mit Kranz und Binde entgegen, während der
fast überwundene Gegner, zum Theil gesunken, noch Widerstand leistet, Statt der ge-
wöhnlichen dreileibigen Gestalt ist nur ein doppelter Körper an ihm zu bemerken; eine
auch sonst, obwohl selten, bezeugte (*7) Besonderheit, die im Gegensatze von Ober- und
Unterwelt um so mehr sich erklärt, je weniger die symbolische Dreigestalt des Geryones
vom Bezug auf die Dreiheit der Weltregionen sich ablösen lässt. Einer der beiden Kör-
per liegt bereits niedergestreckt auf seinem Schilde; der andre dagegen ist, obwohl von
der Last seines Lebensgenossen gebeugt, noch unversehrt und erscheint mit geschwunge-
nem Speer zum letzten Kampfe bereit. Ein grosses Schild deckt seine linke Seite; übri-
gens ist er behelmt und kurzbekleidet. Als zuschauende Gottheiten sind wiederum Athene
und Hermes gegenwärtig; Athene linkerseits durch vollständige Bewaffnung kenntlich, als
stete Beschützerin des Herakles, rechterseits Hermes an einen Fels gelehnt und auch ohne
Beflügelung durch seinen Heroldstab hinlänglich bezeichnet: wahrscheinlich als Seelenfüh-
rer des isterbenden Riesen (48), womit auch des Gottes gesenkter Blick wohl zusammen-
stimmt. Zwei Bäume schliessen, an beide Enden vertheilt, diese Darstellung ab; ihr Wuchs
ist der Meinung entgegen, dass hier in Olivenbäumen eine Anspielung auf das Eiland Ko-
tinusa enthalten sei(49), und gebietet vielmehr, ganz wie in den ähnlichen Bäumen des
unteren Bildes, hier Lorberbäume als übliche Zeichen des Siegs zu erkennen.
X. C. D. Von dem reichen Bilderschmuck dieses Gefässes ist selbst der Fuss des-
selben nicht unbetheiligt geblieben. Auf Meeresgrund, den ein Fisch und Muscheln andeu-
ten, schweben Nereiden einher. Zwei derselben haften an fröhlich bewegten Delphinen
und halten je einen Spiegel in ihrer Linken; zwei andere sitzen fester auf Hippokam-
pen. Da keiner der beschriebenen Mythen diese neptunische Darstellung veranlasst haben
kann(50), so ist sie vermuthlich mit der auch auf andern Kunstwerken nachweislichen (5I)
Schiffahrt zur Insel der Seligen und mit der Grabesbestimmung dieses Gefässes in Verbin-
dung zu setzen.
TAFEL XL
HERAKLES UND HESIONE, URTHEIL DES PARIS.
In der oberen Reihe dieses reichgeschmückten und wohlgezeichneten Gefässes (1) erscheint
Herakles stehend vor einem thronenden Könige, vermuthlich Laomedon, dem der Held
nach Hesione's Befreiung die verheissenen Rosse (2), Zeus' berühmte Gabe für Ganyme-
des(3), abfordert. Bei dieser auf Werken der Kunst nicht häufigen Darstellung (4) ist der
Laomedon unsres Bildes nach asiatischer Sitte lang bekleidet, breitgegürtet, mit langen
Aermeln und gekreuzten Brustbändern versehen; sein linker Arm stützt ein seltsam ge-
krümmtes, vielleicht als Sichelstab den furchtbaren Herrscher bezeichnendes (5), Scepter
auf, während seine Rechte das leichte Obergewand über die Schulter zieht. In gewöhn-
licher Tracht erscheinen dagegen, mit Chlamys, Wehrgehenk und hochgebundenen Sohlen
(*>) Atalanta: Apollod. I, 8, 2. Ovid. Met. VIII, 3S0.
(*>) Bewegung sowohl als Tracht dieser Atalanta stimmen
sehr wohl mit der von Philostratus (jun. 15) beschriebenen über-
ein: liralävTri 71qö%si,q6v snt&sXCa Tg vsvqq ro ßskog ä<p^asiv
ueXlei. "EtSralrai 6s iadiJTi (isv vnsg yovv, xQrpüöa. 6s tqXv
noöotv ävtJTtTctr xal al zstgeg ig mfiov yv\ivca 6iä rd ivsqyäg
sivai, rfs iG&ijrog ixst ig neqövag ^vvsxo{iiv^g.
(«) Wie hinsichtlich des Apfelbaums schon oben (Anm. 3)
bemerkt ward.
(42) Apollod. I, 8, 2: nqoärri PiV UtaXävtii slg ra vmta
erö&vos, SevtsQog 6s l4(i<piäQaog slg rdv oydalpöv, MsXsa-
YQog 6s avrdv stg rdv xevsüva. nXfäccg änsxxsivs. Dass Am-
phiaraos dort als Schütz genannt ist, würde bei der einförmigen
Darstellungsweise dieses Bildes kein Hinderniss sein. Erwähnt
ist Amphiaraos auch hei Ovid (nicht bei Hygin), und im tegea-
tischen Giebelfeld war er dargestellt neben Kastor.
(4S) Die Dioskuren sind erwähnt bei Apollodor, Ovid,
Hygin; auch im tegeatischen Giebelfeld waren sie dargestellt.
( ) Nämlich an denen, die wir für Iason und Amphiaraos
halten, wie auch an Ankäos. Bei Peleus, der sein berühmtes
Schwert zieht, ist dessen Umgürtung oder Scheide ebenfalls
nicht sichtlich.
(«) Geryones: Hesiod. Theog. 287. 981. Apollod. II,
5, 10. Zoega Bass. II, p. 79 ff. De Witte Nouv. Ann. II,
p. 130 ff- Gerhard Auserl. Vasenb. II, 104 B ff. S. 69 ff-
(■*«) Rapp. volc. not. 368. De Witte Nouv. Ann. II, p.
115 ff. Auserl. Vasenb. II, 104 B — 108. S. 75. 76. Darstel-
lungen mit röthlichen Figuren giebt ausser der volcentischen Ky-
lix von guter Zeichnung (Nouv. Ann. pl. XVI. XVII) nur unser
Gefäss und ein gleich spätes bei Millingen Peint. pl. XXVH.
(V) Entschieden nur zwei Körper bietet auch ein archai-
sches Vasenfragment bei Hrn. Panckoucke dar (Nouv. Ann. II,
pl. C, 1838). Vgl. Nouv. Ann. II, p. 123. Auserl. Vasenb. II,
S. 72, 38.
(■*8) Seelenführer: nach De Witte Nouv. Ann. I, p. 125.
(*>) Kotinusa: De Witte ebd. Mehr für diese Ansicht
spricht der ähnliche Baum auf der volcentischen Schale, weni-
ger der Oekweig, den Hermes zugleich mit dem Heroldstab
angethan, zwei hinter ihm stehende Jünglinge, in denen wir zunächst geneigt sind auch
ohne irgend eine Spur asiatischer Tracht (6) Personen von Laomedons Gefolge zu vermu-
then. Auffallend ist bei dem vordersten jener Jünglinge die vollkommene Symmetrie, in
welcher er dem Führer Hesione's, Telamon, am linken Ende des Bildes gegenübersteht:
dieses in Tracht und Bekränzung, aber auch selbst in dem Unterschied, dass jener Hesio-
ne's Fesseln hält, dieser ihr einen Kranz entgegenträgt, jener seine zwei Lanzen erhoben
hat, dieser die gleichen Waffen schräg umgekehrt zeigt. Wäre es mit der Sage verein-
bar, den Herakles mit mehr denn Einem Gefährten nach Troja gekommen zu glauben, be-
vor er im Heereszug sich an Laomedon rächte, so würde uns jener Jüngling Oikles sein,
und diesem gleichgeltend als Friedenszeichen im Vasenbilde bei
Millingen hält.
(M) Selbst Geryones nicht, obwohl Delphine als Schildzei-
chen und sonstige Andeutungen (De Witte, Geryon. p. 68 ff.)
in seiner dreifachen Macht die Meeresgewalt besonders aus-
zeichnen.
(51) Aus Vasenbildern bis jetzt nicht überzeugend, wohl
aber aus römischen und etruskischen Grabreliefs. Vgl. Beschrei-
bung Roms I, S. 325.
(!) Apultsc/te Amphora, hoch 3' lf", Durchmesser
1' 4J-". In Levezow's Verzeichniss und in Berlins antiken
Bildwerken unter no. 1018 beschrieben.
<2) Hom. II. V, 649 ff. Mit Erwähnung Hesione's nach
Hellanikos: Apollod. II, 5, 9 (Heyne p. 158). Schol. Hom. II.
XX, 146. Der Hesionemythos auch bei Diod. IV, 42. Hygin.
fab. 89 not. Valer. FL II, 451 ff. Schol. Lycophr. 34. Zeit
und Anlass des Abenteuers waren bei Hellanikos durch den
Amazonenzug des Herakles gegeben; mit der Argofahrt ver-
knüpft ist es bei Hygin und Valerius Flaccus.
(=>) Pferde des Zeus: Hom. II. V, 265. XXIII, 348. Apol-
lod. 1. c. Statt derselben wird auch ein goldner Weinstock ge-
nannt (Schol. Hom. IL V, 265. Schol. Eur. Or. 1399. Dictys
IV, 13) oder schlechtweg Gold (Ovid. Met. XI, 205. Serv.
Aen. II, 610= „certam peeuniam ad sacra facienda").
(4) Laomedon im Kampf mit Herakles am äginetischen
Giebel: Müller Denkm. I, 30. Hesione's Befreiung ist darge-
stellt auf dem albanischen Mosaik (Winckelm. Mon. I, 66), auf
einem Glaskamee meines Besitzes und auf einem herkulani-
schen Gemälde (Pitt. d'Erc. IV, 62, p. 311). Vgl. Anm. 15
(Podarkes).
(5) Laomedon, auch in seinem Namen den Unterweltsmäch-
ten vergleichbar (Auserl. Vasenb. I, S. 119), trägt einen Sichel-
stab, dem Beilstab des Zeus Labrandeus auf Münzen karischer
Könige (Eckhel D. N. II, 596) vergleichbar.
(6) So wechselt auch des Paris Tracht auf Vasenbildern,
der griechischen Bewaffnung troischer Helden in der Sculptur
zu geschweigen. Ueberdies ist Laomedon unbedeckten Hauptes,
ohne die Tiara, welche zur asiatischen Tracht vorzüglich gehört.
TAFEL XI. HERAKLES UND HESIONE, URTHEIL DES PARIS.
16
den Unmuth der Jager durch erste Verwundung des Ebers reizte (39), sehn wir, geschmückt
und ungeschwächt, in ihrer Jägertracht der Artemis ähnlich und von einem Jagdhund, wie
diese, begleitet, linkerseits auf der Höhe des Bildes, den Bogen zu spannen bereit, für wel-
chen sie mehr denn Einen Pfeil in Bereitschaft hält (40). Im leeren Raum über ihr deutet
ein Hirschgeweih die erfahrene Jägerin, hinter ihr ein Apfelzweig die Siege an, die auch
der Liebesgott ihr zu schenken bereit ist (41), dagegen auf gleicher Höhe des Bildes zwei
Lorberstämme in ähnlicher Art den unfehlbaren Sieg der Helden bezeichnen. Drei dieser
Helden haben wir noch zu erwähnen. Zwischen Atalanta und Iolaos hält, in nicht min-
derer Kampflust als diese bezeigen, ein andrer rüstiger Jäger einen seiner drei Speere zum
Wurf gegen den Eber bereit; einer der Hunde läuft neben ihm, deren unmittelbaren An-
griff auf das furchtbare Wild wir gleich anfangs erwähnten. Vielleicht ist Amphiaraos
gemeint, dessen Theilnahme an der Jagd von Apollodor als erfolgreich neben dem Sieg
Atalanta's und Meleager's bezeichnet wird(42), obwohl Ovid sie verschweigt. Auch an
Mopsos oder Hippothoos Hesse, wie oben, sich denken; doch scheint ein Ehrenplatz, wie
in Atalanta's Nähe dieser ist, vorzüglich dem Theseus zuzukommen, den wir schon vor-
her vergebens suchten, und dessen Gefährten Peirithoos wir bei dem Figurengedränge der
zahlreichen Jäger wol nicht nothwendig an seiner Seite zu suchen haben.
Weniger zweifelhaft ist die Bedeutung der beiden noch übrigen Figuren; durch einen
Lorberstamm in ihrer Mitte und über den Häuptern durch Sterne bezeichnet, einherspren-
gend auf Rossen, für deren kundigste Tümmler sie galten, sind in diesen schon gedachten
Figuren Kastor und Polydeukes, die Söhne des Zeus unverkennbar, deren Antheil am
kalydonischen Abenteuer in wenigen Sagen und Darstellungen desselben verwischt ist(43).
In ihrer Tracht und Bewaffnung sind sie von den beschriebenen Jägern kaum unterschie-
den: Chlamys und kurze Speere sind ihnen mit diesen allen gemein, das schmückende
Stirnband, welches fast keinem der Jäger fehlt, mag einem der Dioskuren, wie dort dem
Theseus, wol nur zufällig fehlen, und eben so kann es nur zufällig sein, dass der Petasus,
welcher einem derselben über den Nacken herabhängt, bei dessen Bruder, welcher in
Vorderansicht erscheint, verdeckt und ohne Andeutung geblieben ist. Wehrgehenke be-
merkt man an ihnen nicht, vermisst man jedoch auch an mehreren der übrigen Jäger (u).
Wie auf der zuerst beschriebenen Seite, wird auch dieses stattliche Bild, unter den
Kunstdarstellungen der Meleagerjagd bis jetzt das umfassendste, von einem andern (X. A)
überragt, welches den Hals des Gefässes bedeckt. Der Sieg des Herakles über Geryo-
nes^), ein in Gefässmalereien späteren Styls eben so seltener als in archaischer Zeich-
nung häufiger Gegenstand (M), ist diesem Verhältniss gemäss in nicht gewöhnlicher Weise
hier abgebildet. Herakles mit leicht umgeschlagener Löwenhaut schwingt mit der Rechten
die Keule gegen den Riesen, während seine Linke etwa eine der Lanzen desselben als
Beute hält. Eine Siegsgöttin schwebt ihm mit Kranz und Binde entgegen, während der
fast überwundene Gegner, zum Theil gesunken, noch Widerstand leistet, Statt der ge-
wöhnlichen dreileibigen Gestalt ist nur ein doppelter Körper an ihm zu bemerken; eine
auch sonst, obwohl selten, bezeugte (*7) Besonderheit, die im Gegensatze von Ober- und
Unterwelt um so mehr sich erklärt, je weniger die symbolische Dreigestalt des Geryones
vom Bezug auf die Dreiheit der Weltregionen sich ablösen lässt. Einer der beiden Kör-
per liegt bereits niedergestreckt auf seinem Schilde; der andre dagegen ist, obwohl von
der Last seines Lebensgenossen gebeugt, noch unversehrt und erscheint mit geschwunge-
nem Speer zum letzten Kampfe bereit. Ein grosses Schild deckt seine linke Seite; übri-
gens ist er behelmt und kurzbekleidet. Als zuschauende Gottheiten sind wiederum Athene
und Hermes gegenwärtig; Athene linkerseits durch vollständige Bewaffnung kenntlich, als
stete Beschützerin des Herakles, rechterseits Hermes an einen Fels gelehnt und auch ohne
Beflügelung durch seinen Heroldstab hinlänglich bezeichnet: wahrscheinlich als Seelenfüh-
rer des isterbenden Riesen (48), womit auch des Gottes gesenkter Blick wohl zusammen-
stimmt. Zwei Bäume schliessen, an beide Enden vertheilt, diese Darstellung ab; ihr Wuchs
ist der Meinung entgegen, dass hier in Olivenbäumen eine Anspielung auf das Eiland Ko-
tinusa enthalten sei(49), und gebietet vielmehr, ganz wie in den ähnlichen Bäumen des
unteren Bildes, hier Lorberbäume als übliche Zeichen des Siegs zu erkennen.
X. C. D. Von dem reichen Bilderschmuck dieses Gefässes ist selbst der Fuss des-
selben nicht unbetheiligt geblieben. Auf Meeresgrund, den ein Fisch und Muscheln andeu-
ten, schweben Nereiden einher. Zwei derselben haften an fröhlich bewegten Delphinen
und halten je einen Spiegel in ihrer Linken; zwei andere sitzen fester auf Hippokam-
pen. Da keiner der beschriebenen Mythen diese neptunische Darstellung veranlasst haben
kann(50), so ist sie vermuthlich mit der auch auf andern Kunstwerken nachweislichen (5I)
Schiffahrt zur Insel der Seligen und mit der Grabesbestimmung dieses Gefässes in Verbin-
dung zu setzen.
TAFEL XL
HERAKLES UND HESIONE, URTHEIL DES PARIS.
In der oberen Reihe dieses reichgeschmückten und wohlgezeichneten Gefässes (1) erscheint
Herakles stehend vor einem thronenden Könige, vermuthlich Laomedon, dem der Held
nach Hesione's Befreiung die verheissenen Rosse (2), Zeus' berühmte Gabe für Ganyme-
des(3), abfordert. Bei dieser auf Werken der Kunst nicht häufigen Darstellung (4) ist der
Laomedon unsres Bildes nach asiatischer Sitte lang bekleidet, breitgegürtet, mit langen
Aermeln und gekreuzten Brustbändern versehen; sein linker Arm stützt ein seltsam ge-
krümmtes, vielleicht als Sichelstab den furchtbaren Herrscher bezeichnendes (5), Scepter
auf, während seine Rechte das leichte Obergewand über die Schulter zieht. In gewöhn-
licher Tracht erscheinen dagegen, mit Chlamys, Wehrgehenk und hochgebundenen Sohlen
(*>) Atalanta: Apollod. I, 8, 2. Ovid. Met. VIII, 3S0.
(*>) Bewegung sowohl als Tracht dieser Atalanta stimmen
sehr wohl mit der von Philostratus (jun. 15) beschriebenen über-
ein: liralävTri 71qö%si,q6v snt&sXCa Tg vsvqq ro ßskog ä<p^asiv
ueXlei. "EtSralrai 6s iadiJTi (isv vnsg yovv, xQrpüöa. 6s tqXv
noöotv ävtJTtTctr xal al zstgeg ig mfiov yv\ivca 6iä rd ivsqyäg
sivai, rfs iG&ijrog ixst ig neqövag ^vvsxo{iiv^g.
(«) Wie hinsichtlich des Apfelbaums schon oben (Anm. 3)
bemerkt ward.
(42) Apollod. I, 8, 2: nqoärri PiV UtaXävtii slg ra vmta
erö&vos, SevtsQog 6s l4(i<piäQaog slg rdv oydalpöv, MsXsa-
YQog 6s avrdv stg rdv xevsüva. nXfäccg änsxxsivs. Dass Am-
phiaraos dort als Schütz genannt ist, würde bei der einförmigen
Darstellungsweise dieses Bildes kein Hinderniss sein. Erwähnt
ist Amphiaraos auch hei Ovid (nicht bei Hygin), und im tegea-
tischen Giebelfeld war er dargestellt neben Kastor.
(4S) Die Dioskuren sind erwähnt bei Apollodor, Ovid,
Hygin; auch im tegeatischen Giebelfeld waren sie dargestellt.
( ) Nämlich an denen, die wir für Iason und Amphiaraos
halten, wie auch an Ankäos. Bei Peleus, der sein berühmtes
Schwert zieht, ist dessen Umgürtung oder Scheide ebenfalls
nicht sichtlich.
(«) Geryones: Hesiod. Theog. 287. 981. Apollod. II,
5, 10. Zoega Bass. II, p. 79 ff. De Witte Nouv. Ann. II,
p. 130 ff- Gerhard Auserl. Vasenb. II, 104 B ff. S. 69 ff-
(■*«) Rapp. volc. not. 368. De Witte Nouv. Ann. II, p.
115 ff. Auserl. Vasenb. II, 104 B — 108. S. 75. 76. Darstel-
lungen mit röthlichen Figuren giebt ausser der volcentischen Ky-
lix von guter Zeichnung (Nouv. Ann. pl. XVI. XVII) nur unser
Gefäss und ein gleich spätes bei Millingen Peint. pl. XXVH.
(V) Entschieden nur zwei Körper bietet auch ein archai-
sches Vasenfragment bei Hrn. Panckoucke dar (Nouv. Ann. II,
pl. C, 1838). Vgl. Nouv. Ann. II, p. 123. Auserl. Vasenb. II,
S. 72, 38.
(■*8) Seelenführer: nach De Witte Nouv. Ann. I, p. 125.
(*>) Kotinusa: De Witte ebd. Mehr für diese Ansicht
spricht der ähnliche Baum auf der volcentischen Schale, weni-
ger der Oekweig, den Hermes zugleich mit dem Heroldstab
angethan, zwei hinter ihm stehende Jünglinge, in denen wir zunächst geneigt sind auch
ohne irgend eine Spur asiatischer Tracht (6) Personen von Laomedons Gefolge zu vermu-
then. Auffallend ist bei dem vordersten jener Jünglinge die vollkommene Symmetrie, in
welcher er dem Führer Hesione's, Telamon, am linken Ende des Bildes gegenübersteht:
dieses in Tracht und Bekränzung, aber auch selbst in dem Unterschied, dass jener Hesio-
ne's Fesseln hält, dieser ihr einen Kranz entgegenträgt, jener seine zwei Lanzen erhoben
hat, dieser die gleichen Waffen schräg umgekehrt zeigt. Wäre es mit der Sage verein-
bar, den Herakles mit mehr denn Einem Gefährten nach Troja gekommen zu glauben, be-
vor er im Heereszug sich an Laomedon rächte, so würde uns jener Jüngling Oikles sein,
und diesem gleichgeltend als Friedenszeichen im Vasenbilde bei
Millingen hält.
(M) Selbst Geryones nicht, obwohl Delphine als Schildzei-
chen und sonstige Andeutungen (De Witte, Geryon. p. 68 ff.)
in seiner dreifachen Macht die Meeresgewalt besonders aus-
zeichnen.
(51) Aus Vasenbildern bis jetzt nicht überzeugend, wohl
aber aus römischen und etruskischen Grabreliefs. Vgl. Beschrei-
bung Roms I, S. 325.
(!) Apultsc/te Amphora, hoch 3' lf", Durchmesser
1' 4J-". In Levezow's Verzeichniss und in Berlins antiken
Bildwerken unter no. 1018 beschrieben.
<2) Hom. II. V, 649 ff. Mit Erwähnung Hesione's nach
Hellanikos: Apollod. II, 5, 9 (Heyne p. 158). Schol. Hom. II.
XX, 146. Der Hesionemythos auch bei Diod. IV, 42. Hygin.
fab. 89 not. Valer. FL II, 451 ff. Schol. Lycophr. 34. Zeit
und Anlass des Abenteuers waren bei Hellanikos durch den
Amazonenzug des Herakles gegeben; mit der Argofahrt ver-
knüpft ist es bei Hygin und Valerius Flaccus.
(=>) Pferde des Zeus: Hom. II. V, 265. XXIII, 348. Apol-
lod. 1. c. Statt derselben wird auch ein goldner Weinstock ge-
nannt (Schol. Hom. IL V, 265. Schol. Eur. Or. 1399. Dictys
IV, 13) oder schlechtweg Gold (Ovid. Met. XI, 205. Serv.
Aen. II, 610= „certam peeuniam ad sacra facienda").
(4) Laomedon im Kampf mit Herakles am äginetischen
Giebel: Müller Denkm. I, 30. Hesione's Befreiung ist darge-
stellt auf dem albanischen Mosaik (Winckelm. Mon. I, 66), auf
einem Glaskamee meines Besitzes und auf einem herkulani-
schen Gemälde (Pitt. d'Erc. IV, 62, p. 311). Vgl. Anm. 15
(Podarkes).
(5) Laomedon, auch in seinem Namen den Unterweltsmäch-
ten vergleichbar (Auserl. Vasenb. I, S. 119), trägt einen Sichel-
stab, dem Beilstab des Zeus Labrandeus auf Münzen karischer
Könige (Eckhel D. N. II, 596) vergleichbar.
(6) So wechselt auch des Paris Tracht auf Vasenbildern,
der griechischen Bewaffnung troischer Helden in der Sculptur
zu geschweigen. Ueberdies ist Laomedon unbedeckten Hauptes,
ohne die Tiara, welche zur asiatischen Tracht vorzüglich gehört.