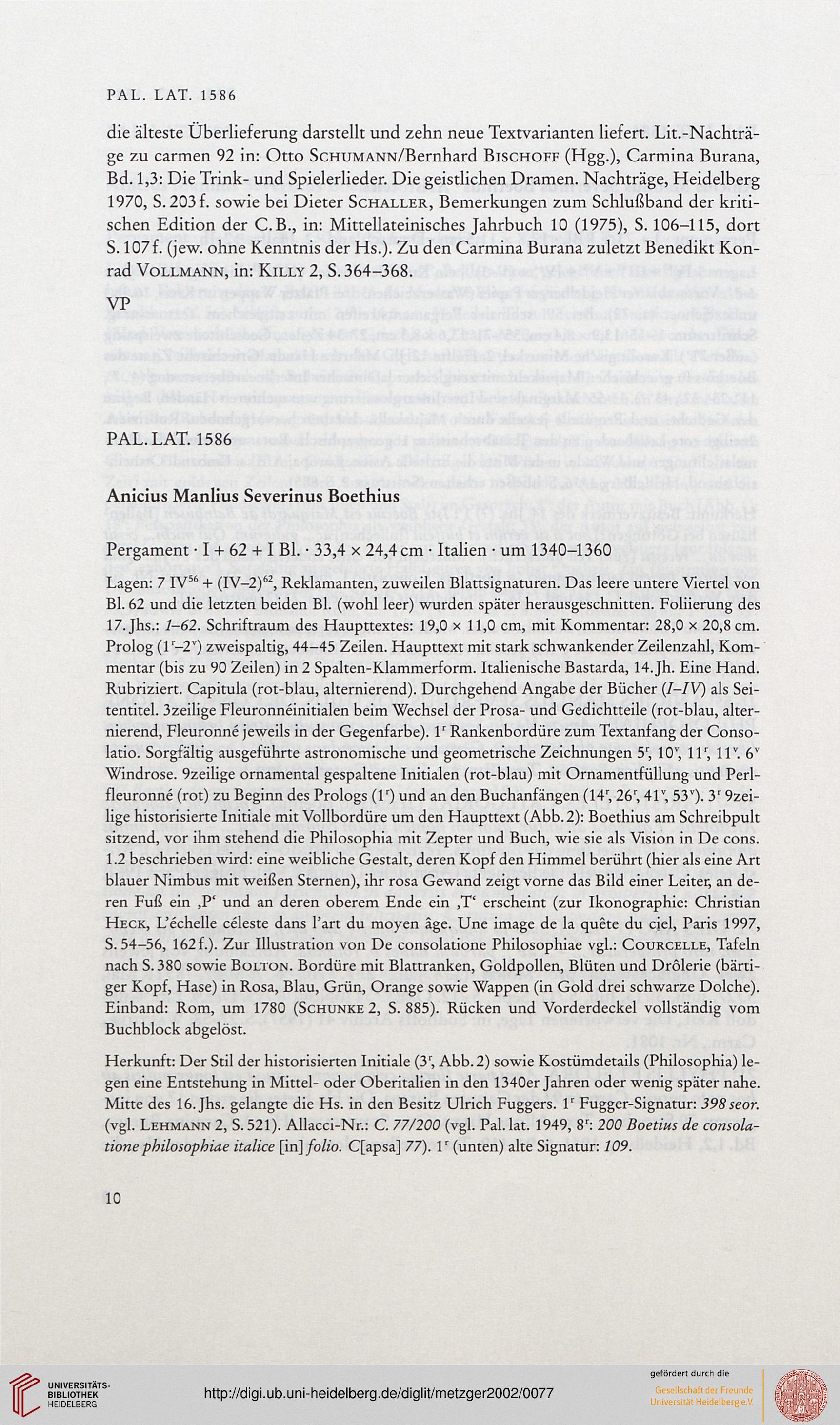PAL. LAT. 1586
die älteste Überlieferung darstellt und zehn neue Textvarianten liefert. Lit.-Nachträ-
ge zu Carmen 92 in: Otto ScHUMANN/Bernhard Bischoff (Hgg.), Carmina Burana,
Bd. 1,3: Die Trink- und Spielerlieder. Die geistlichen Dramen. Nachträge, Heidelberg
1970, S. 203 f. sowie bei Dieter Schaller, Bemerkungen zum Schlußband der kriti-
schen Edition der C.B., in: Mittellateinisches Jahrbuch 10 (1975), S. 106-115, dort
S. 107f. (jew. ohne Kenntnis der Hs.). Zu den Carmina Burana zuletzt Benedikt Kon-
rad Vollmann, in: Killy 2, S. 364-368.
VP
PAL. LAT. 1586
Anicius Manlius Severinus Boethius
Pergament • I + 62 + I Bl. • 33,4 x 24,4 cm • Italien • um 1340-1360
Lagen: 7 IV56 + (IV-2)62, Reklamanten, zuweilen Blattsignaturen. Das leere untere Viertel von
Bl. 62 und die letzten beiden Bl. (wohl leer) wurden später herausgeschnitten. Foliierung des
17. Jhs.: 1-62. Schriftraum des Haupttextes: 19,0 x 11,0 cm, mit Kommentar: 28,0 x 20,8 cm.
Prolog (lr-2v) zweispaltig, 44-45 Zeilen. Haupttext mit stark schwankender Zeilenzahl, Kom-
mentar (bis zu 90 Zeilen) in 2 Spalten-Klammerform. Italienische Bastarda, 14.Jh. Eine Hand.
Rubriziert. Capitula (rot-blau, alternierend). Durchgehend Angabe der Bücher (I-IV) als Sei-
tentitel. 3zeilige Fleuronneinitialen beim Wechsel der Prosa- und Gedichtteile (rot-blau, alter-
nierend, Fleuronne jeweils in der Gegenfarbe). 1' Rankenbordüre zum Textanfang der Conso-
latio. Sorgfältig ausgeführte astronomische und geometrische Zeichnungen 5r, 10v, llr, llv. 6"
Windrose. 9zeilige ornamental gespaltene Initialen (rot-blau) mit Ornamentfüllung und Perl-
fleuronne (rot) zu Beginn des Prologs (lr) und an den Buchanfängen (14r, 26r, 41", 53v). 3r 9zei-
lige historisierte Initiale mit Vollbordüre um den Haupttext (Abb. 2): Boethius am Schreibpult
sitzend, vor ihm stehend die Philosophia mit Zepter und Buch, wie sie als Vision in De cons.
1.2 beschrieben wird: eine weibliche Gestalt, deren Kopf den Himmel berührt (hier als eine Art
blauer Nimbus mit weißen Sternen), ihr rosa Gewand zeigt vorne das Bild einer Leiter, an de-
ren Fuß ein ,P' und an deren oberem Ende ein ,T' erscheint (zur Ikonographie: Christian
Heck, L'echelle Celeste dans l'art du moyen äge. Une image de la quete du ciel, Paris 1997,
S. 54-56, 162 f.). Zur Illustration von De consolatione Philosophiae vgl.: Courcelle, Tafeln
nach S.380 sowie Bolton. Bordüre mit Blattranken, Goldpollen, Blüten und Drolerie (bärti-
ger Kopf, Hase) in Rosa, Blau, Grün, Orange sowie Wappen (in Gold drei schwarze Dolche).
Einband: Rom, um 1780 (Schunke 2, S. 885). Rücken und Vorderdeckel vollständig vom
Buchblock abgelöst.
Herkunft: Der Stil der historisierten Initiale (3r, Abb. 2) sowie Kostümdetails (Philosophia) le-
gen eine Entstehung in Mittel- oder Oberitalien in den 1340er Jahren oder wenig später nahe.
Mitte des 16. Jhs. gelangte die Hs. in den Besitz Ulrich Fuggers. V Fugger-Signatur: 398 seor.
(vgl. Lehmann 2, S. 521). Allacci-Nr.: C. 77/200 (vgl. Pal. lat. 1949, 8r: 200 Boetius de consola-
tione philosophiae italice [in] folio. C[apsa] 77). V (unten) alte Signatur: 109.
10
die älteste Überlieferung darstellt und zehn neue Textvarianten liefert. Lit.-Nachträ-
ge zu Carmen 92 in: Otto ScHUMANN/Bernhard Bischoff (Hgg.), Carmina Burana,
Bd. 1,3: Die Trink- und Spielerlieder. Die geistlichen Dramen. Nachträge, Heidelberg
1970, S. 203 f. sowie bei Dieter Schaller, Bemerkungen zum Schlußband der kriti-
schen Edition der C.B., in: Mittellateinisches Jahrbuch 10 (1975), S. 106-115, dort
S. 107f. (jew. ohne Kenntnis der Hs.). Zu den Carmina Burana zuletzt Benedikt Kon-
rad Vollmann, in: Killy 2, S. 364-368.
VP
PAL. LAT. 1586
Anicius Manlius Severinus Boethius
Pergament • I + 62 + I Bl. • 33,4 x 24,4 cm • Italien • um 1340-1360
Lagen: 7 IV56 + (IV-2)62, Reklamanten, zuweilen Blattsignaturen. Das leere untere Viertel von
Bl. 62 und die letzten beiden Bl. (wohl leer) wurden später herausgeschnitten. Foliierung des
17. Jhs.: 1-62. Schriftraum des Haupttextes: 19,0 x 11,0 cm, mit Kommentar: 28,0 x 20,8 cm.
Prolog (lr-2v) zweispaltig, 44-45 Zeilen. Haupttext mit stark schwankender Zeilenzahl, Kom-
mentar (bis zu 90 Zeilen) in 2 Spalten-Klammerform. Italienische Bastarda, 14.Jh. Eine Hand.
Rubriziert. Capitula (rot-blau, alternierend). Durchgehend Angabe der Bücher (I-IV) als Sei-
tentitel. 3zeilige Fleuronneinitialen beim Wechsel der Prosa- und Gedichtteile (rot-blau, alter-
nierend, Fleuronne jeweils in der Gegenfarbe). 1' Rankenbordüre zum Textanfang der Conso-
latio. Sorgfältig ausgeführte astronomische und geometrische Zeichnungen 5r, 10v, llr, llv. 6"
Windrose. 9zeilige ornamental gespaltene Initialen (rot-blau) mit Ornamentfüllung und Perl-
fleuronne (rot) zu Beginn des Prologs (lr) und an den Buchanfängen (14r, 26r, 41", 53v). 3r 9zei-
lige historisierte Initiale mit Vollbordüre um den Haupttext (Abb. 2): Boethius am Schreibpult
sitzend, vor ihm stehend die Philosophia mit Zepter und Buch, wie sie als Vision in De cons.
1.2 beschrieben wird: eine weibliche Gestalt, deren Kopf den Himmel berührt (hier als eine Art
blauer Nimbus mit weißen Sternen), ihr rosa Gewand zeigt vorne das Bild einer Leiter, an de-
ren Fuß ein ,P' und an deren oberem Ende ein ,T' erscheint (zur Ikonographie: Christian
Heck, L'echelle Celeste dans l'art du moyen äge. Une image de la quete du ciel, Paris 1997,
S. 54-56, 162 f.). Zur Illustration von De consolatione Philosophiae vgl.: Courcelle, Tafeln
nach S.380 sowie Bolton. Bordüre mit Blattranken, Goldpollen, Blüten und Drolerie (bärti-
ger Kopf, Hase) in Rosa, Blau, Grün, Orange sowie Wappen (in Gold drei schwarze Dolche).
Einband: Rom, um 1780 (Schunke 2, S. 885). Rücken und Vorderdeckel vollständig vom
Buchblock abgelöst.
Herkunft: Der Stil der historisierten Initiale (3r, Abb. 2) sowie Kostümdetails (Philosophia) le-
gen eine Entstehung in Mittel- oder Oberitalien in den 1340er Jahren oder wenig später nahe.
Mitte des 16. Jhs. gelangte die Hs. in den Besitz Ulrich Fuggers. V Fugger-Signatur: 398 seor.
(vgl. Lehmann 2, S. 521). Allacci-Nr.: C. 77/200 (vgl. Pal. lat. 1949, 8r: 200 Boetius de consola-
tione philosophiae italice [in] folio. C[apsa] 77). V (unten) alte Signatur: 109.
10