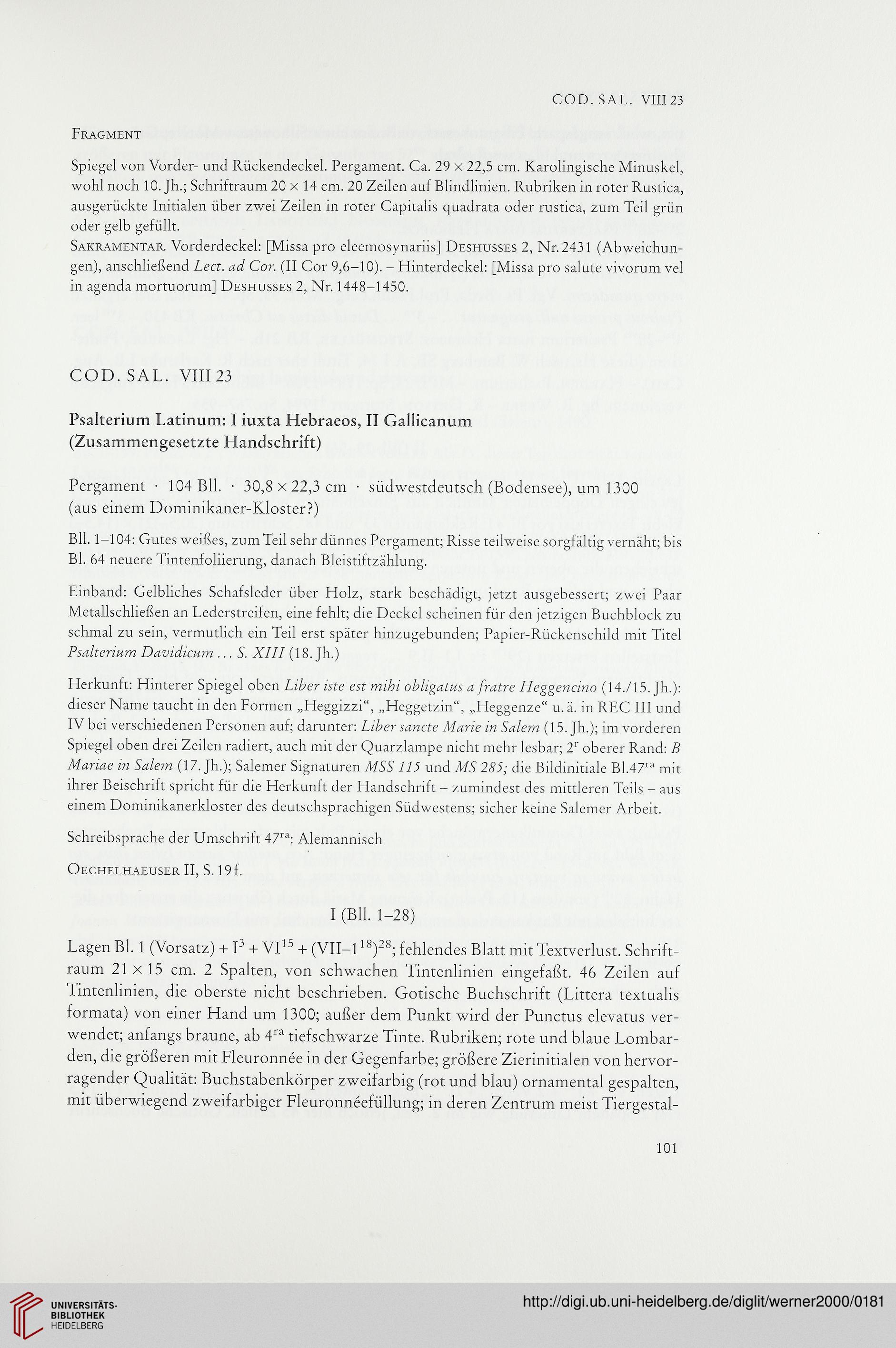COD. SAL. VIII 23
Fragment
Spiegel von Vorder- und Rückendeckel. Pergament. Ca. 29 x 22,5 cm. Karolingische Minuskel,
wohl noch 10. Jh.; Schriftraum 20 x 14 cm. 20 Zeilen auf Blindlinien. Rubriken in roter Rustica,
ausgerückte Initialen über zwei Zeilen in roter Capitalis quadrata oder rustica, zum Teil grün
oder gelb gefüllt.
Sakramentar. Vorderdeckel: [Missa pro eleemosynariis] Deshusses 2, Nr. 2431 (Abweichun-
gen), anschließend Lect. ad Cor. (II Cor 9,6-10). - Hinterdeckel: [Missa pro salute vivorum vel
in agenda mortuorum] Deshusses 2, Nr. 1448-1450.
COD. SAL. VIII 23
Psalterium Latinum: I iuxta Hebraeos, II Gallicanum
(Zusammengesetzte Handschrift)
Pergament ■ 104 Bll. • 30,8 x 22,3 cm • südwestdeutsch (Bodensee), um 1300
(aus einem Dominikaner-Kloster?)
Bll. 1-104: Gutes weißes, zum Teil sehr dünnes Pergament; Risse teilweise sorgfältig vernäht; bis
Bl. 64 neuere Tintenfoliierung, danach Bleistiftzählung.
Einband: Gelbliches Schafsleder über Holz, stark beschädigt, jetzt ausgebessert; zwei Paar
Metallschließen an Lederstreifen, eine fehlt; die Deckel scheinen für den jetzigen Buchblock zu
schmal zu sein, vermutlich ein Teil erst später hinzugebunden; Papier-Rückenschild mit Titel
Psalterium Davidicum ... S. XIII (18. Jh.)
Herkunft: Hinterer Spiegel oben Liber iste est mihi obligatus a fratre Heggencino (14./15. Jh.):
dieser Name taucht in den Formen „Heggizzi", „Heggetzin", „Heggenze" u. ä. in REC III und
IV bei verschiedenen Personen auf; darunter: Liber sancte Marie in Salem (15. Jh.); im vorderen
Spiegel oben drei Zeilen radiert, auch mit der Quarzlampe nicht mehr lesbar; 2r oberer Rand: B
Mariae in Salem (17. Jh.); Salemer Signaturen MSS 115 und MS 285; die Bildinitiale Bl.47ra mit
ihrer Beischrift spricht für die Herkunft der Handschrift - zumindest des mittleren Teils - aus
einem Dominikanerkloster des deutschsprachigen Südwestens; sicher keine Salemer Arbeit.
Schreibsprache der Umschrift 47ra: Alemannisch
Oechelhaeuser II, S. 19 f.
I (Bll. 1-28)
Lagen Bl. 1 (Vorsatz) + I3 + VI15 + (VII-118)28; fehlendes Blatt mit Textverlust. Schrift-
raum 21 x 15 cm. 2 Spalten, von schwachen Tintenlinien eingefaßt. 46 Zeilen auf
Tintenlinien, die oberste nicht beschrieben. Gotische Buchschrift (Littera textualis
formata) von einer Hand um 1300; außer dem Punkt wird der Punctus elevatus ver-
wendet; anfangs braune, ab 4ra tiefschwarze Tinte. Rubriken; rote und blaue Lombar-
den, die größeren mit Fleuronnee in der Gegenfarbe; größere Zierinitialen von hervor-
ragender Qualität: Buchstabenkörper zweifarbig (rot und blau) ornamental gespalten,
mit überwiegend zweifarbiger Fleuronneefüllung; in deren Zentrum meist Tiergestal-
101
Fragment
Spiegel von Vorder- und Rückendeckel. Pergament. Ca. 29 x 22,5 cm. Karolingische Minuskel,
wohl noch 10. Jh.; Schriftraum 20 x 14 cm. 20 Zeilen auf Blindlinien. Rubriken in roter Rustica,
ausgerückte Initialen über zwei Zeilen in roter Capitalis quadrata oder rustica, zum Teil grün
oder gelb gefüllt.
Sakramentar. Vorderdeckel: [Missa pro eleemosynariis] Deshusses 2, Nr. 2431 (Abweichun-
gen), anschließend Lect. ad Cor. (II Cor 9,6-10). - Hinterdeckel: [Missa pro salute vivorum vel
in agenda mortuorum] Deshusses 2, Nr. 1448-1450.
COD. SAL. VIII 23
Psalterium Latinum: I iuxta Hebraeos, II Gallicanum
(Zusammengesetzte Handschrift)
Pergament ■ 104 Bll. • 30,8 x 22,3 cm • südwestdeutsch (Bodensee), um 1300
(aus einem Dominikaner-Kloster?)
Bll. 1-104: Gutes weißes, zum Teil sehr dünnes Pergament; Risse teilweise sorgfältig vernäht; bis
Bl. 64 neuere Tintenfoliierung, danach Bleistiftzählung.
Einband: Gelbliches Schafsleder über Holz, stark beschädigt, jetzt ausgebessert; zwei Paar
Metallschließen an Lederstreifen, eine fehlt; die Deckel scheinen für den jetzigen Buchblock zu
schmal zu sein, vermutlich ein Teil erst später hinzugebunden; Papier-Rückenschild mit Titel
Psalterium Davidicum ... S. XIII (18. Jh.)
Herkunft: Hinterer Spiegel oben Liber iste est mihi obligatus a fratre Heggencino (14./15. Jh.):
dieser Name taucht in den Formen „Heggizzi", „Heggetzin", „Heggenze" u. ä. in REC III und
IV bei verschiedenen Personen auf; darunter: Liber sancte Marie in Salem (15. Jh.); im vorderen
Spiegel oben drei Zeilen radiert, auch mit der Quarzlampe nicht mehr lesbar; 2r oberer Rand: B
Mariae in Salem (17. Jh.); Salemer Signaturen MSS 115 und MS 285; die Bildinitiale Bl.47ra mit
ihrer Beischrift spricht für die Herkunft der Handschrift - zumindest des mittleren Teils - aus
einem Dominikanerkloster des deutschsprachigen Südwestens; sicher keine Salemer Arbeit.
Schreibsprache der Umschrift 47ra: Alemannisch
Oechelhaeuser II, S. 19 f.
I (Bll. 1-28)
Lagen Bl. 1 (Vorsatz) + I3 + VI15 + (VII-118)28; fehlendes Blatt mit Textverlust. Schrift-
raum 21 x 15 cm. 2 Spalten, von schwachen Tintenlinien eingefaßt. 46 Zeilen auf
Tintenlinien, die oberste nicht beschrieben. Gotische Buchschrift (Littera textualis
formata) von einer Hand um 1300; außer dem Punkt wird der Punctus elevatus ver-
wendet; anfangs braune, ab 4ra tiefschwarze Tinte. Rubriken; rote und blaue Lombar-
den, die größeren mit Fleuronnee in der Gegenfarbe; größere Zierinitialen von hervor-
ragender Qualität: Buchstabenkörper zweifarbig (rot und blau) ornamental gespalten,
mit überwiegend zweifarbiger Fleuronneefüllung; in deren Zentrum meist Tiergestal-
101