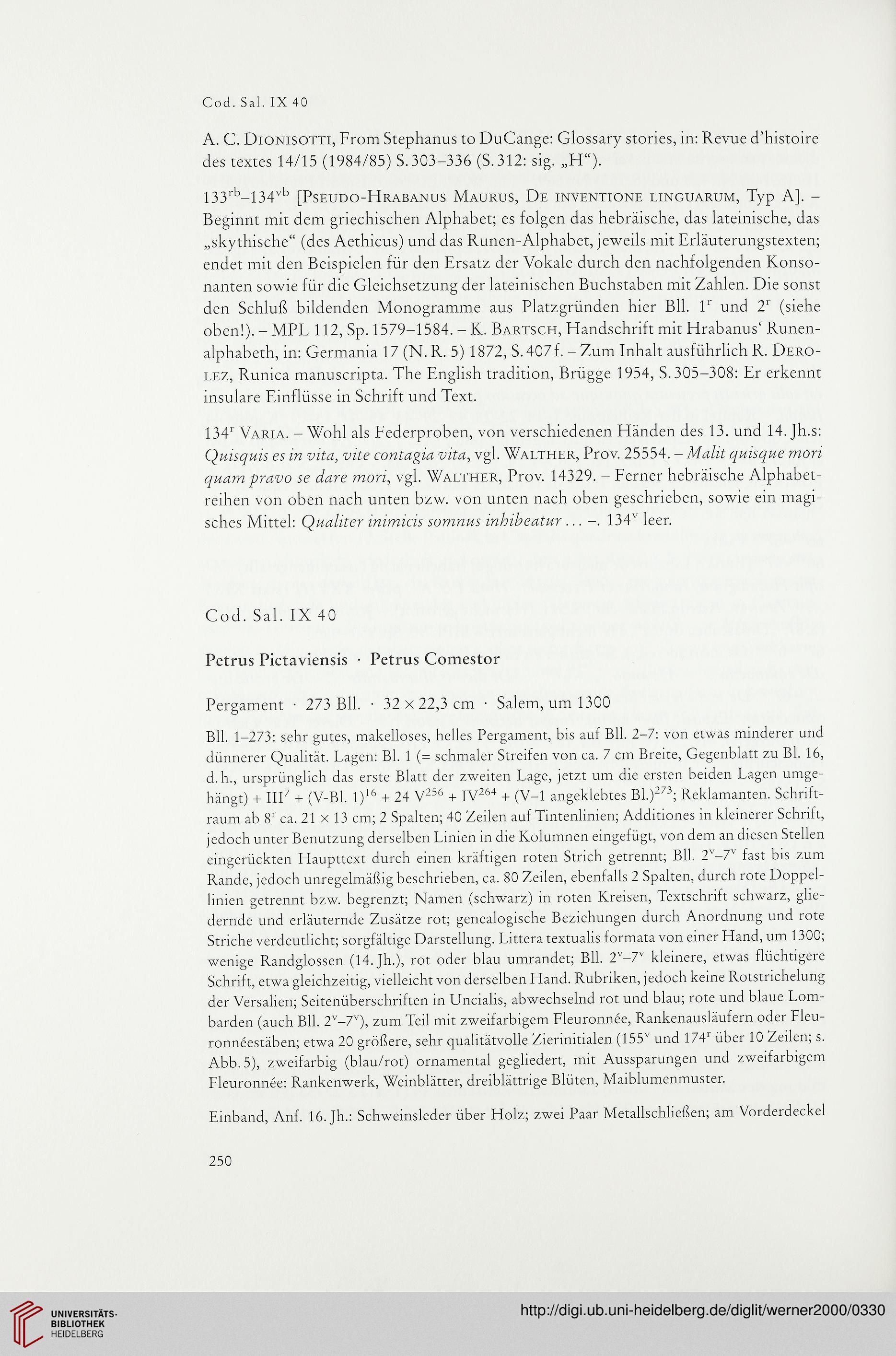Cod. Sal. IX 40
A. C. Dionisotti, From Stephanus to DuCange: Glossary stories, in: Revue d'histoire
des textes 14/15 (1984/85) S. 303-336 (S.312: sig. „H").
133 -134 [Pseudo-Hrabanus Maurus, De inventione linguarum, Typ A]. -
Beginnt mit dem griechischen Alphabet; es folgen das hebräische, das lateinische, das
„skythische" (des Aethicus) und das Runen-Alphabet, jeweils mit Erläuterungstexten;
endet mit den Beispielen für den Ersatz der Vokale durch den nachfolgenden Konso-
nanten sowie für die Gleichsetzung der lateinischen Buchstaben mit Zahlen. Die sonst
den Schluß bildenden Monogramme aus Platzgründen hier Bll. V und 2r (siehe
oben!). - MPL 112, Sp. 1579-1584. - K. Bartsch, Handschrift mit Hrabanus' Runen-
alphabeth, in: Germania 17 (N. R. 5) 1872, S. 407 f. - Zum Inhalt ausführlich R. Dero-
lez, Runica manuscripta. The English tradition, Brügge 1954, S. 305-308: Er erkennt
insulare Einflüsse in Schrift und Text.
134r Varia. - Wohl als Federproben, von verschiedenen Händen des 13. und 14. Jh.s:
Quisquis es in vita, vite contagia vita, vgl. Walther, Prov. 25554. - Malit quisque mon
quam pravo se dare mori, vgl. Walther, Prov. 14329. - Ferner hebräische Alphabet-
reihen von oben nach unten bzw. von unten nach oben geschrieben, sowie ein magi-
sches Mittel: Qualiter inimicis somnus inhibeatur ... -. 134v leer.
Cod. Sal. IX 40
Petrus Pictaviensis • Petrus Comestor
Pergament • 273 Bll. ■ 32 x 22,3 cm • Salem, um 1300
Bll. 1-273: sehr gutes, makelloses, helles Pergament, bis auf Bll. 2-7: von etwas minderer und
dünnerer Qualität. Lagen: Bl. 1 (= schmaler Streifen von ca. 7 cm Breite, Gegenblatt zu Bl. 16,
d.h., ursprünglich das erste Blatt der zweiten Lage, jetzt um die ersten beiden Lagen umge-
hängt) + III7 + (V-Bl. l)lf' + 24 V256 + IV264 + (V-l angeklebtes Bl.)273; Reklamanten. Schrift-
raum ab 8r ca. 21 x 13 cm; 2 Spalten; 40 Zeilen auf Tintenlinien; Additiones in kleinerer Schrift,
jedoch unter Benutzung derselben Linien in die Kolumnen eingefügt, von dem an diesen Stellen
eingerückten Haupttext durch einen kräftigen roten Strich getrennt; Bll. 2V-7V fast bis zum
Rande, jedoch unregelmäßig beschrieben, ca. 80 Zeilen, ebenfalls 2 Spalten, durch rote Doppel-
linien getrennt bzw. begrenzt; Namen (schwarz) in roten Kreisen, Textschrift schwarz, glie-
dernde und erläuternde Zusätze rot; genealogische Beziehungen durch Anordnung und rote
Striche verdeutlicht; sorgfältige Darstellung. Littera textualis formata von einer Hand, um 1300;
wenige Randglossen (14. Jh.), rot oder blau umrandet; Bll. 2V-7V kleinere, etwas flüchtigere
Schrift, etwa gleichzeitig, vielleicht von derselben Hand. Rubriken, jedoch keine Rotstrichelung
der Versalien; Seitenüberschriften in Uncialis, abwechselnd rot und blau; rote und blaue Lom-
barden (auch Bll. 2V-7V), zum Teil mit zweifarbigem Fleuronnee, Rankenausläufern oder Fleu-
ronneestäben; etwa 20 größere, sehr qualitätvolle Zierinitialen (155v und 174'" über 10 Zeilen; s.
Abb. 5), zweifarbig (blau/rot) ornamental gegliedert, mit Aussparungen und zweifarbigem
Fleuronnee: Rankenwerk, Weinblätter, dreiblättrige Blüten, Maiblumenmuster.
Einband, Anf. 16. Jh.: Schweinsleder über Holz; zwei Paar Metallschließen; am Vorderdeckel
250
A. C. Dionisotti, From Stephanus to DuCange: Glossary stories, in: Revue d'histoire
des textes 14/15 (1984/85) S. 303-336 (S.312: sig. „H").
133 -134 [Pseudo-Hrabanus Maurus, De inventione linguarum, Typ A]. -
Beginnt mit dem griechischen Alphabet; es folgen das hebräische, das lateinische, das
„skythische" (des Aethicus) und das Runen-Alphabet, jeweils mit Erläuterungstexten;
endet mit den Beispielen für den Ersatz der Vokale durch den nachfolgenden Konso-
nanten sowie für die Gleichsetzung der lateinischen Buchstaben mit Zahlen. Die sonst
den Schluß bildenden Monogramme aus Platzgründen hier Bll. V und 2r (siehe
oben!). - MPL 112, Sp. 1579-1584. - K. Bartsch, Handschrift mit Hrabanus' Runen-
alphabeth, in: Germania 17 (N. R. 5) 1872, S. 407 f. - Zum Inhalt ausführlich R. Dero-
lez, Runica manuscripta. The English tradition, Brügge 1954, S. 305-308: Er erkennt
insulare Einflüsse in Schrift und Text.
134r Varia. - Wohl als Federproben, von verschiedenen Händen des 13. und 14. Jh.s:
Quisquis es in vita, vite contagia vita, vgl. Walther, Prov. 25554. - Malit quisque mon
quam pravo se dare mori, vgl. Walther, Prov. 14329. - Ferner hebräische Alphabet-
reihen von oben nach unten bzw. von unten nach oben geschrieben, sowie ein magi-
sches Mittel: Qualiter inimicis somnus inhibeatur ... -. 134v leer.
Cod. Sal. IX 40
Petrus Pictaviensis • Petrus Comestor
Pergament • 273 Bll. ■ 32 x 22,3 cm • Salem, um 1300
Bll. 1-273: sehr gutes, makelloses, helles Pergament, bis auf Bll. 2-7: von etwas minderer und
dünnerer Qualität. Lagen: Bl. 1 (= schmaler Streifen von ca. 7 cm Breite, Gegenblatt zu Bl. 16,
d.h., ursprünglich das erste Blatt der zweiten Lage, jetzt um die ersten beiden Lagen umge-
hängt) + III7 + (V-Bl. l)lf' + 24 V256 + IV264 + (V-l angeklebtes Bl.)273; Reklamanten. Schrift-
raum ab 8r ca. 21 x 13 cm; 2 Spalten; 40 Zeilen auf Tintenlinien; Additiones in kleinerer Schrift,
jedoch unter Benutzung derselben Linien in die Kolumnen eingefügt, von dem an diesen Stellen
eingerückten Haupttext durch einen kräftigen roten Strich getrennt; Bll. 2V-7V fast bis zum
Rande, jedoch unregelmäßig beschrieben, ca. 80 Zeilen, ebenfalls 2 Spalten, durch rote Doppel-
linien getrennt bzw. begrenzt; Namen (schwarz) in roten Kreisen, Textschrift schwarz, glie-
dernde und erläuternde Zusätze rot; genealogische Beziehungen durch Anordnung und rote
Striche verdeutlicht; sorgfältige Darstellung. Littera textualis formata von einer Hand, um 1300;
wenige Randglossen (14. Jh.), rot oder blau umrandet; Bll. 2V-7V kleinere, etwas flüchtigere
Schrift, etwa gleichzeitig, vielleicht von derselben Hand. Rubriken, jedoch keine Rotstrichelung
der Versalien; Seitenüberschriften in Uncialis, abwechselnd rot und blau; rote und blaue Lom-
barden (auch Bll. 2V-7V), zum Teil mit zweifarbigem Fleuronnee, Rankenausläufern oder Fleu-
ronneestäben; etwa 20 größere, sehr qualitätvolle Zierinitialen (155v und 174'" über 10 Zeilen; s.
Abb. 5), zweifarbig (blau/rot) ornamental gegliedert, mit Aussparungen und zweifarbigem
Fleuronnee: Rankenwerk, Weinblätter, dreiblättrige Blüten, Maiblumenmuster.
Einband, Anf. 16. Jh.: Schweinsleder über Holz; zwei Paar Metallschließen; am Vorderdeckel
250