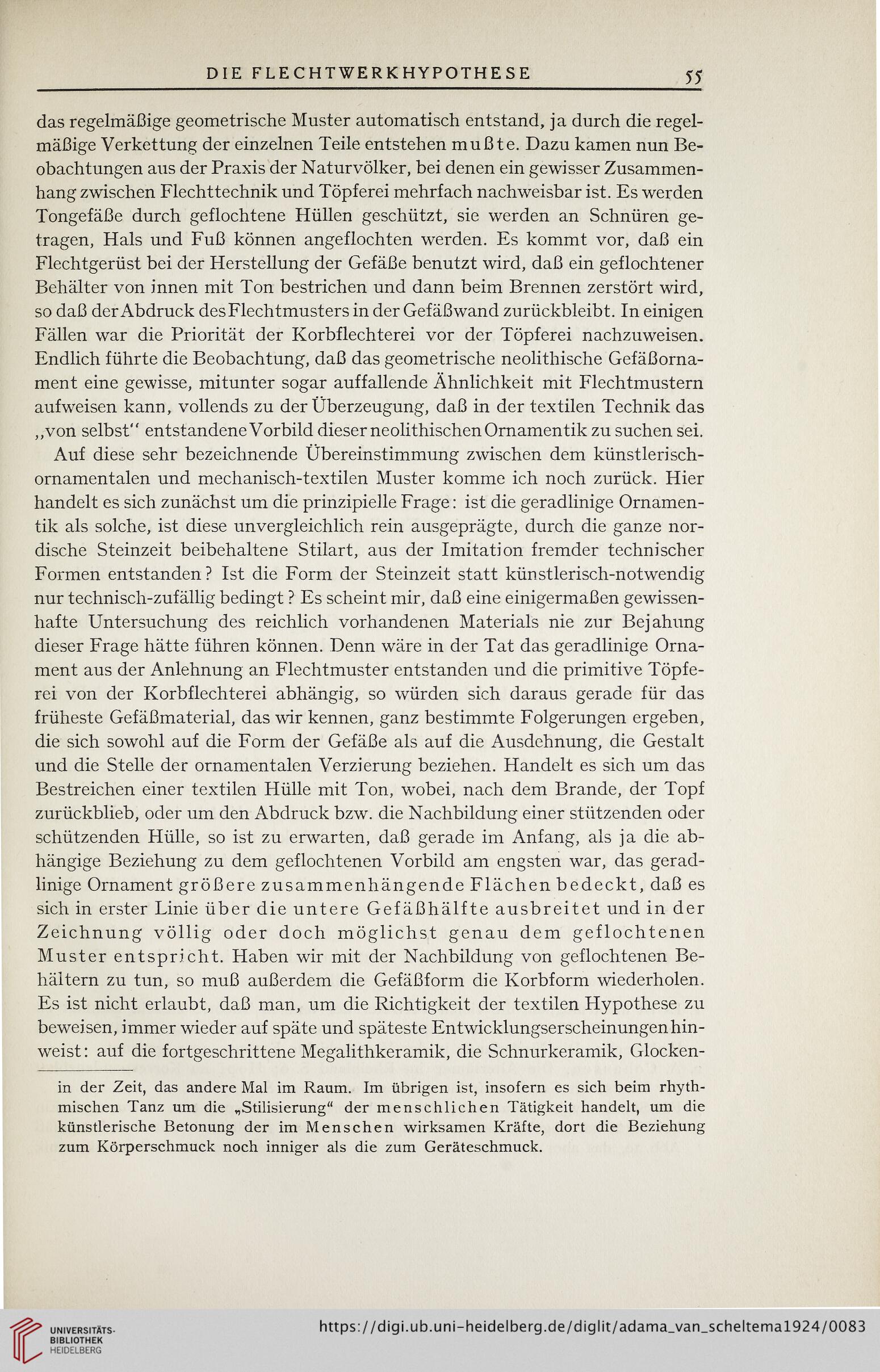DIE FLECHTWERKHYPOTHESE
55
das regelmäßige geometrische Muster automatisch entstand, ja durch die regel-
mäßige Verkettung der einzelnen Teile entstehen mußte. Dazu kamen nun Be-
obachtungen aus der Praxis der Naturvölker, bei denen ein gewisser Zusammen-
hang zwischen Flechttechnik und Töpferei mehrfach nachweisbar ist. Es werden
Tongefäße durch geflochtene Hüllen geschützt, sie werden an Schnüren ge-
tragen, Hals und Fuß können angeflochten werden. Es kommt vor, daß ein
Flechtgerüst bei der Herstellung der Gefäße benutzt wird, daß ein geflochtener
Behälter von innen mit Ton bestrichen und dann beim Brennen zerstört wird,
so daß der Abdruck des Flechtmusters in der Gefäßwand zurückbleibt. In einigen
Fällen war die Priorität der Korbflechterei vor der Töpferei nachzuweisen.
Endlich führte die Beobachtung, daß das geometrische neolithische Gefäßorna-
ment eine gewisse, mitunter sogar auffallende Ähnlichkeit mit Flechtmustern
aufweisen kann, vollends zu der Überzeugung, daß in der textilen Technik das
„von selbst" entstandene Vorbild dieser neolithischen Ornamentik zu suchen sei.
Auf diese sehr bezeichnende Übereinstimmung zwischen dem künstlerisch-
ornamentalen und mechanisch-textilen Muster komme ich noch zurück. Hier
handelt es sich zunächst um die prinzipielle Frage: ist die geradlinige Ornamen-
tik als solche, ist diese unvergleichlich rein ausgeprägte, durch die ganze nor-
dische Steinzeit beibehaltene Stilart, aus der Imitation fremder technischer
Formen entstanden? Ist die Form der Steinzeit statt künstlerisch-notwendig
nur technisch-zufällig bedingt ? Es scheint mir, daß eine einigermaßen gewissen-
hafte Untersuchung des reichlich vorhandenen Materials nie zur Bejahung
dieser Frage hätte führen können. Denn wäre in der Tat das geradlinige Orna-
ment aus der Anlehnung an Flechtmuster entstanden und die primitive Töpfe-
rei von der Korbflechterei abhängig, so würden sich daraus gerade für das
früheste Gefäßmaterial, das wir kennen, ganz bestimmte Folgerungen ergeben,
die sich sowohl auf die Form der Gefäße als auf die Ausdehnung, die Gestalt
und die Stelle der ornamentalen Verzierung beziehen. Handelt es sich um das
Bestreichen einer textilen Hülle mit Ton, wobei, nach dem Brande, der Topf
zurückblieb, oder um den Abdruck bzw. die Nachbildung einer stützenden oder
schützenden Hülle, so ist zu erwarten, daß gerade im Anfang, als ja die ab-
hängige Beziehung zu dem geflochtenen Vorbild am engsten war, das gerad-
linige Ornament größere zusammenhängende Flächen bedeckt, daß es
sich in erster Linie über die untere Gefäßhälfte ausbreitet und in der
Zeichnung völlig oder doch möglichst genau dem geflochtenen
Muster entspricht. Haben wir mit der Nachbildung von geflochtenen Be-
hältern zu tun, so muß außerdem die Gefäßform die Korbform wiederholen.
Es ist nicht erlaubt, daß man, um die Richtigkeit der textilen Hypothese zu
beweisen, immer wieder auf späte und späteste Entwicklungserscheinungen hin-
weist : auf die fortgeschrittene Megalithkeramik, die Schnurkeramik, Glocken-
in der Zeit, das andere Mal im Raum. Im übrigen ist, insofern es sich beim rhyth-
mischen Tanz um die „Stilisierung“ der menschlichen Tätigkeit handelt, um die
künstlerische Betonung der im Menschen wirksamen Kräfte, dort die Beziehung
zum Körperschmuck noch inniger als die zum Geräteschmuck.
55
das regelmäßige geometrische Muster automatisch entstand, ja durch die regel-
mäßige Verkettung der einzelnen Teile entstehen mußte. Dazu kamen nun Be-
obachtungen aus der Praxis der Naturvölker, bei denen ein gewisser Zusammen-
hang zwischen Flechttechnik und Töpferei mehrfach nachweisbar ist. Es werden
Tongefäße durch geflochtene Hüllen geschützt, sie werden an Schnüren ge-
tragen, Hals und Fuß können angeflochten werden. Es kommt vor, daß ein
Flechtgerüst bei der Herstellung der Gefäße benutzt wird, daß ein geflochtener
Behälter von innen mit Ton bestrichen und dann beim Brennen zerstört wird,
so daß der Abdruck des Flechtmusters in der Gefäßwand zurückbleibt. In einigen
Fällen war die Priorität der Korbflechterei vor der Töpferei nachzuweisen.
Endlich führte die Beobachtung, daß das geometrische neolithische Gefäßorna-
ment eine gewisse, mitunter sogar auffallende Ähnlichkeit mit Flechtmustern
aufweisen kann, vollends zu der Überzeugung, daß in der textilen Technik das
„von selbst" entstandene Vorbild dieser neolithischen Ornamentik zu suchen sei.
Auf diese sehr bezeichnende Übereinstimmung zwischen dem künstlerisch-
ornamentalen und mechanisch-textilen Muster komme ich noch zurück. Hier
handelt es sich zunächst um die prinzipielle Frage: ist die geradlinige Ornamen-
tik als solche, ist diese unvergleichlich rein ausgeprägte, durch die ganze nor-
dische Steinzeit beibehaltene Stilart, aus der Imitation fremder technischer
Formen entstanden? Ist die Form der Steinzeit statt künstlerisch-notwendig
nur technisch-zufällig bedingt ? Es scheint mir, daß eine einigermaßen gewissen-
hafte Untersuchung des reichlich vorhandenen Materials nie zur Bejahung
dieser Frage hätte führen können. Denn wäre in der Tat das geradlinige Orna-
ment aus der Anlehnung an Flechtmuster entstanden und die primitive Töpfe-
rei von der Korbflechterei abhängig, so würden sich daraus gerade für das
früheste Gefäßmaterial, das wir kennen, ganz bestimmte Folgerungen ergeben,
die sich sowohl auf die Form der Gefäße als auf die Ausdehnung, die Gestalt
und die Stelle der ornamentalen Verzierung beziehen. Handelt es sich um das
Bestreichen einer textilen Hülle mit Ton, wobei, nach dem Brande, der Topf
zurückblieb, oder um den Abdruck bzw. die Nachbildung einer stützenden oder
schützenden Hülle, so ist zu erwarten, daß gerade im Anfang, als ja die ab-
hängige Beziehung zu dem geflochtenen Vorbild am engsten war, das gerad-
linige Ornament größere zusammenhängende Flächen bedeckt, daß es
sich in erster Linie über die untere Gefäßhälfte ausbreitet und in der
Zeichnung völlig oder doch möglichst genau dem geflochtenen
Muster entspricht. Haben wir mit der Nachbildung von geflochtenen Be-
hältern zu tun, so muß außerdem die Gefäßform die Korbform wiederholen.
Es ist nicht erlaubt, daß man, um die Richtigkeit der textilen Hypothese zu
beweisen, immer wieder auf späte und späteste Entwicklungserscheinungen hin-
weist : auf die fortgeschrittene Megalithkeramik, die Schnurkeramik, Glocken-
in der Zeit, das andere Mal im Raum. Im übrigen ist, insofern es sich beim rhyth-
mischen Tanz um die „Stilisierung“ der menschlichen Tätigkeit handelt, um die
künstlerische Betonung der im Menschen wirksamen Kräfte, dort die Beziehung
zum Körperschmuck noch inniger als die zum Geräteschmuck.