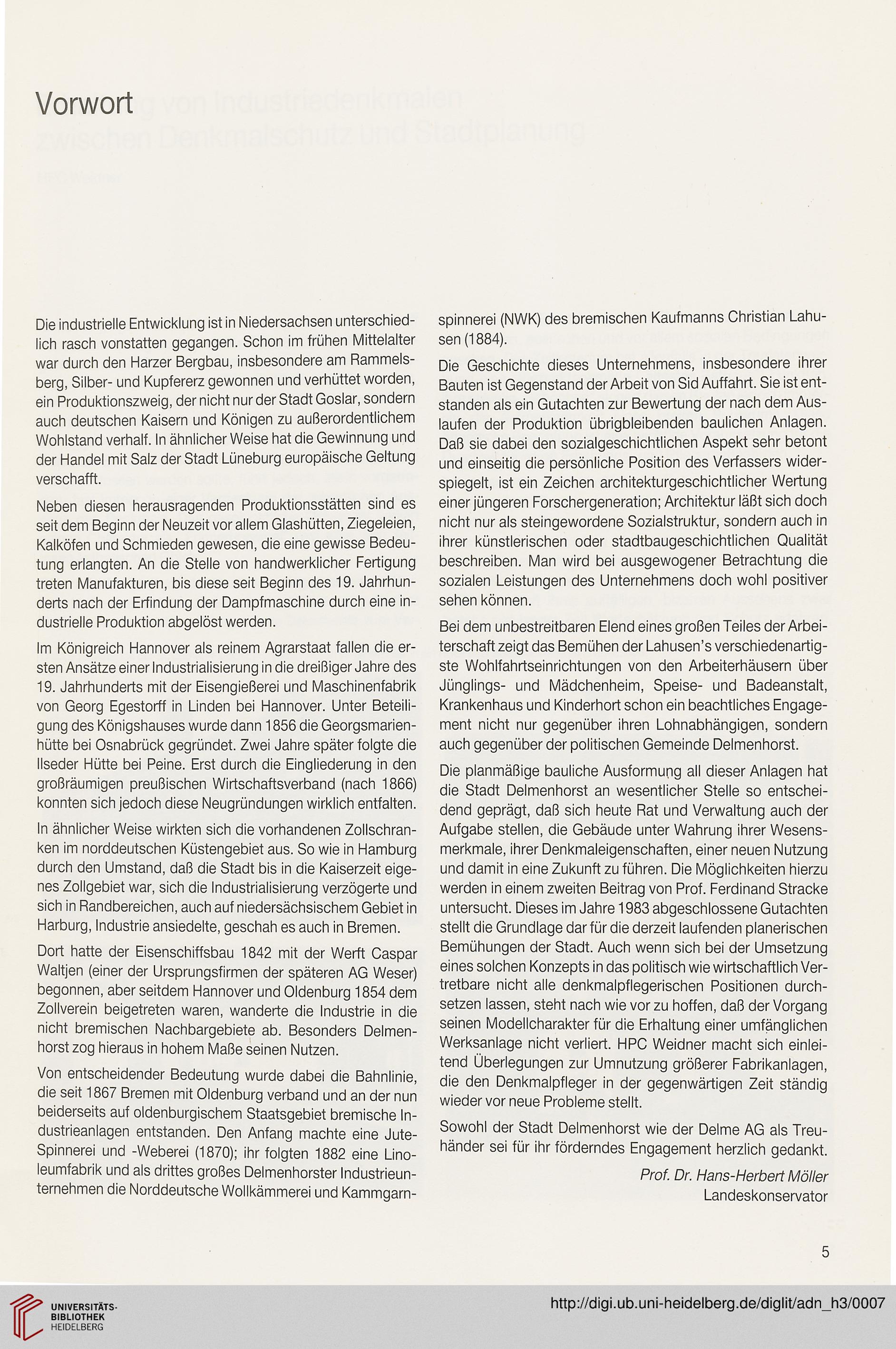Vorwort
Die industrielle Entwicklung ist in Niedersachsen unterschied-
lich rasch vonstatten gegangen. Schon im frühen Mittelalter
war durch den Harzer Bergbau, insbesondere am Rammeis-
berg, Silber- und Kupfererz gewonnen und verhüttet worden,
ein Produktionszweig, der nicht nur der Stadt Goslar, sondern
auch deutschen Kaisern und Königen zu außerordentlichem
Wohlstand verhalf. In ähnlicher Weise hat die Gewinnung und
der Handel mit Salz der Stadt Lüneburg europäische Geltung
verschafft.
Neben diesen herausragenden Produktionsstätten sind es
seit dem Beginn der Neuzeit vor allem Glashütten, Ziegeleien,
Kalkofen und Schmieden gewesen, die eine gewisse Bedeu-
tung erlangten. An die Stelle von handwerklicher Fertigung
treten Manufakturen, bis diese seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts nach der Erfindung der Dampfmaschine durch eine in-
dustrielle Produktion abgelöst werden.
Im Königreich Hannover als reinem Agrarstaat fallen die er-
sten Ansätze einer Industrialisierung in die dreißiger Jahre des
19. Jahrhunderts mit der Eisengießerei und Maschinenfabrik
von Georg Egestorff in Linden bei Hannover. Unter Beteili-
gung des Königshauses wurde dann 1856 die Georgsmarien-
hütte bei Osnabrück gegründet. Zwei Jahre später folgte die
llseder Hütte bei Peine. Erst durch die Eingliederung in den
großräumigen preußischen Wirtschaftsverband (nach 1866)
konnten sich jedoch diese Neugründungen wirklich entfalten.
In ähnlicher Weise wirkten sich die vorhandenen Zollschran-
ken im norddeutschen Küstengebiet aus. So wie in Hamburg
durch den Umstand, daß die Stadt bis in die Kaiserzeit eige-
nes Zollgebiet war, sich die Industrialisierung verzögerte und
sich in Randbereichen, auch auf niedersächsischem Gebiet in
Harburg, Industrie ansiedelte, geschah es auch in Bremen.
Dort hatte der Eisenschiffsbau 1842 mit der Werft Caspar
Waltjen (einer der Ursprungsfirmen der späteren AG Weser)
begonnen, aber seitdem Hannover und Oldenburg 1854 dem
Zollverein beigetreten waren, wanderte die Industrie in die
nicht bremischen Nachbargebiete ab. Besonders Delmen-
horst zog hieraus in hohem Maße seinen Nutzen.
Von entscheidender Bedeutung wurde dabei die Bahnlinie,
die seit 1867 Bremen mit Oldenburg verband und an der nun
beiderseits auf oldenburgischem Staatsgebiet bremische In-
dustrieanlagen entstanden. Den Anfang machte eine Jute-
Spinnerei und -Weberei (1870); ihr folgten 1882 eine Lino-
leumfabrik und als drittes großes Delmenhorster Industrieun-
ternehmen die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarn-
spinnerei (NWK) des bremischen Kaufmanns Christian Lahu-
sen (1884).
Die Geschichte dieses Unternehmens, insbesondere ihrer
Bauten ist Gegenstand der Arbeit von Sid Auffahrt. Sie ist ent-
standen als ein Gutachten zur Bewertung der nach dem Aus-
laufen der Produktion übrigbleibenden baulichen Anlagen.
Daß sie dabei den sozialgeschichtlichen Aspekt sehr betont
und einseitig die persönliche Position des Verfassers wider-
spiegelt, ist ein Zeichen architekturgeschichtlicher Wertung
einer jüngeren Forschergeneration; Architektur läßt sich doch
nicht nur als steingewordene Sozialstruktur, sondern auch in
ihrer künstlerischen oder stadtbaugeschichtlichen Qualität
beschreiben. Man wird bei ausgewogener Betrachtung die
sozialen Leistungen des Unternehmens doch wohl positiver
sehen können.
Bei dem unbestreitbaren Elend eines großen Teiles der Arbei-
terschaft zeigt das Bemühen der Lahusen’s verschiedenartig-
ste Wohlfahrtseinrichtungen von den Arbeiterhäusern über
Jünglings- und Mädchenheim, Speise- und Badeanstalt,
Krankenhaus und Kinderhort schon ein beachtliches Engage-
ment nicht nur gegenüber ihren Lohnabhängigen, sondern
auch gegenüber der politischen Gemeinde Delmenhorst.
Die planmäßige bauliche Ausformung all dieser Anlagen hat
die Stadt Delmenhorst an wesentlicher Stelle so entschei-
dend geprägt, daß sich heute Rat und Verwaltung auch der
Aufgabe stellen, die Gebäude unter Wahrung ihrer Wesens-
merkmale, ihrer Denkmaleigenschaften, einer neuen Nutzung
und damit in eine Zukunft zu führen. Die Möglichkeiten hierzu
werden in einem zweiten Beitrag von Prof. Ferdinand Stracke
untersucht. Dieses im Jahre 1983 abgeschlossene Gutachten
stellt die Grundlage dar für die derzeit laufenden planerischen
Bemühungen der Stadt. Auch wenn sich bei der Umsetzung
eines solchen Konzepts in das politisch wie wirtschaftlich Ver-
tretbare nicht alle denkmalpflegerischen Positionen durch-
setzen lassen, steht nach wie vor zu hoffen, daß der Vorgang
seinen Modellcharakter für die Erhaltung einer umfänglichen
Werksanlage nicht verliert. HPC Weidner macht sich einlei-
tend Überlegungen zur Umnutzung größerer Fabrikanlagen,
die den Denkmalpfleger in der gegenwärtigen Zeit ständig
wieder vor neue Probleme stellt.
Sowohl der Stadt Delmenhorst wie der Delme AG als Treu-
händer sei für ihr förderndes Engagement herzlich gedankt.
Prof. Dr. Hans-Herbert Möller
Landeskonservator
5
Die industrielle Entwicklung ist in Niedersachsen unterschied-
lich rasch vonstatten gegangen. Schon im frühen Mittelalter
war durch den Harzer Bergbau, insbesondere am Rammeis-
berg, Silber- und Kupfererz gewonnen und verhüttet worden,
ein Produktionszweig, der nicht nur der Stadt Goslar, sondern
auch deutschen Kaisern und Königen zu außerordentlichem
Wohlstand verhalf. In ähnlicher Weise hat die Gewinnung und
der Handel mit Salz der Stadt Lüneburg europäische Geltung
verschafft.
Neben diesen herausragenden Produktionsstätten sind es
seit dem Beginn der Neuzeit vor allem Glashütten, Ziegeleien,
Kalkofen und Schmieden gewesen, die eine gewisse Bedeu-
tung erlangten. An die Stelle von handwerklicher Fertigung
treten Manufakturen, bis diese seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts nach der Erfindung der Dampfmaschine durch eine in-
dustrielle Produktion abgelöst werden.
Im Königreich Hannover als reinem Agrarstaat fallen die er-
sten Ansätze einer Industrialisierung in die dreißiger Jahre des
19. Jahrhunderts mit der Eisengießerei und Maschinenfabrik
von Georg Egestorff in Linden bei Hannover. Unter Beteili-
gung des Königshauses wurde dann 1856 die Georgsmarien-
hütte bei Osnabrück gegründet. Zwei Jahre später folgte die
llseder Hütte bei Peine. Erst durch die Eingliederung in den
großräumigen preußischen Wirtschaftsverband (nach 1866)
konnten sich jedoch diese Neugründungen wirklich entfalten.
In ähnlicher Weise wirkten sich die vorhandenen Zollschran-
ken im norddeutschen Küstengebiet aus. So wie in Hamburg
durch den Umstand, daß die Stadt bis in die Kaiserzeit eige-
nes Zollgebiet war, sich die Industrialisierung verzögerte und
sich in Randbereichen, auch auf niedersächsischem Gebiet in
Harburg, Industrie ansiedelte, geschah es auch in Bremen.
Dort hatte der Eisenschiffsbau 1842 mit der Werft Caspar
Waltjen (einer der Ursprungsfirmen der späteren AG Weser)
begonnen, aber seitdem Hannover und Oldenburg 1854 dem
Zollverein beigetreten waren, wanderte die Industrie in die
nicht bremischen Nachbargebiete ab. Besonders Delmen-
horst zog hieraus in hohem Maße seinen Nutzen.
Von entscheidender Bedeutung wurde dabei die Bahnlinie,
die seit 1867 Bremen mit Oldenburg verband und an der nun
beiderseits auf oldenburgischem Staatsgebiet bremische In-
dustrieanlagen entstanden. Den Anfang machte eine Jute-
Spinnerei und -Weberei (1870); ihr folgten 1882 eine Lino-
leumfabrik und als drittes großes Delmenhorster Industrieun-
ternehmen die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarn-
spinnerei (NWK) des bremischen Kaufmanns Christian Lahu-
sen (1884).
Die Geschichte dieses Unternehmens, insbesondere ihrer
Bauten ist Gegenstand der Arbeit von Sid Auffahrt. Sie ist ent-
standen als ein Gutachten zur Bewertung der nach dem Aus-
laufen der Produktion übrigbleibenden baulichen Anlagen.
Daß sie dabei den sozialgeschichtlichen Aspekt sehr betont
und einseitig die persönliche Position des Verfassers wider-
spiegelt, ist ein Zeichen architekturgeschichtlicher Wertung
einer jüngeren Forschergeneration; Architektur läßt sich doch
nicht nur als steingewordene Sozialstruktur, sondern auch in
ihrer künstlerischen oder stadtbaugeschichtlichen Qualität
beschreiben. Man wird bei ausgewogener Betrachtung die
sozialen Leistungen des Unternehmens doch wohl positiver
sehen können.
Bei dem unbestreitbaren Elend eines großen Teiles der Arbei-
terschaft zeigt das Bemühen der Lahusen’s verschiedenartig-
ste Wohlfahrtseinrichtungen von den Arbeiterhäusern über
Jünglings- und Mädchenheim, Speise- und Badeanstalt,
Krankenhaus und Kinderhort schon ein beachtliches Engage-
ment nicht nur gegenüber ihren Lohnabhängigen, sondern
auch gegenüber der politischen Gemeinde Delmenhorst.
Die planmäßige bauliche Ausformung all dieser Anlagen hat
die Stadt Delmenhorst an wesentlicher Stelle so entschei-
dend geprägt, daß sich heute Rat und Verwaltung auch der
Aufgabe stellen, die Gebäude unter Wahrung ihrer Wesens-
merkmale, ihrer Denkmaleigenschaften, einer neuen Nutzung
und damit in eine Zukunft zu führen. Die Möglichkeiten hierzu
werden in einem zweiten Beitrag von Prof. Ferdinand Stracke
untersucht. Dieses im Jahre 1983 abgeschlossene Gutachten
stellt die Grundlage dar für die derzeit laufenden planerischen
Bemühungen der Stadt. Auch wenn sich bei der Umsetzung
eines solchen Konzepts in das politisch wie wirtschaftlich Ver-
tretbare nicht alle denkmalpflegerischen Positionen durch-
setzen lassen, steht nach wie vor zu hoffen, daß der Vorgang
seinen Modellcharakter für die Erhaltung einer umfänglichen
Werksanlage nicht verliert. HPC Weidner macht sich einlei-
tend Überlegungen zur Umnutzung größerer Fabrikanlagen,
die den Denkmalpfleger in der gegenwärtigen Zeit ständig
wieder vor neue Probleme stellt.
Sowohl der Stadt Delmenhorst wie der Delme AG als Treu-
händer sei für ihr förderndes Engagement herzlich gedankt.
Prof. Dr. Hans-Herbert Möller
Landeskonservator
5