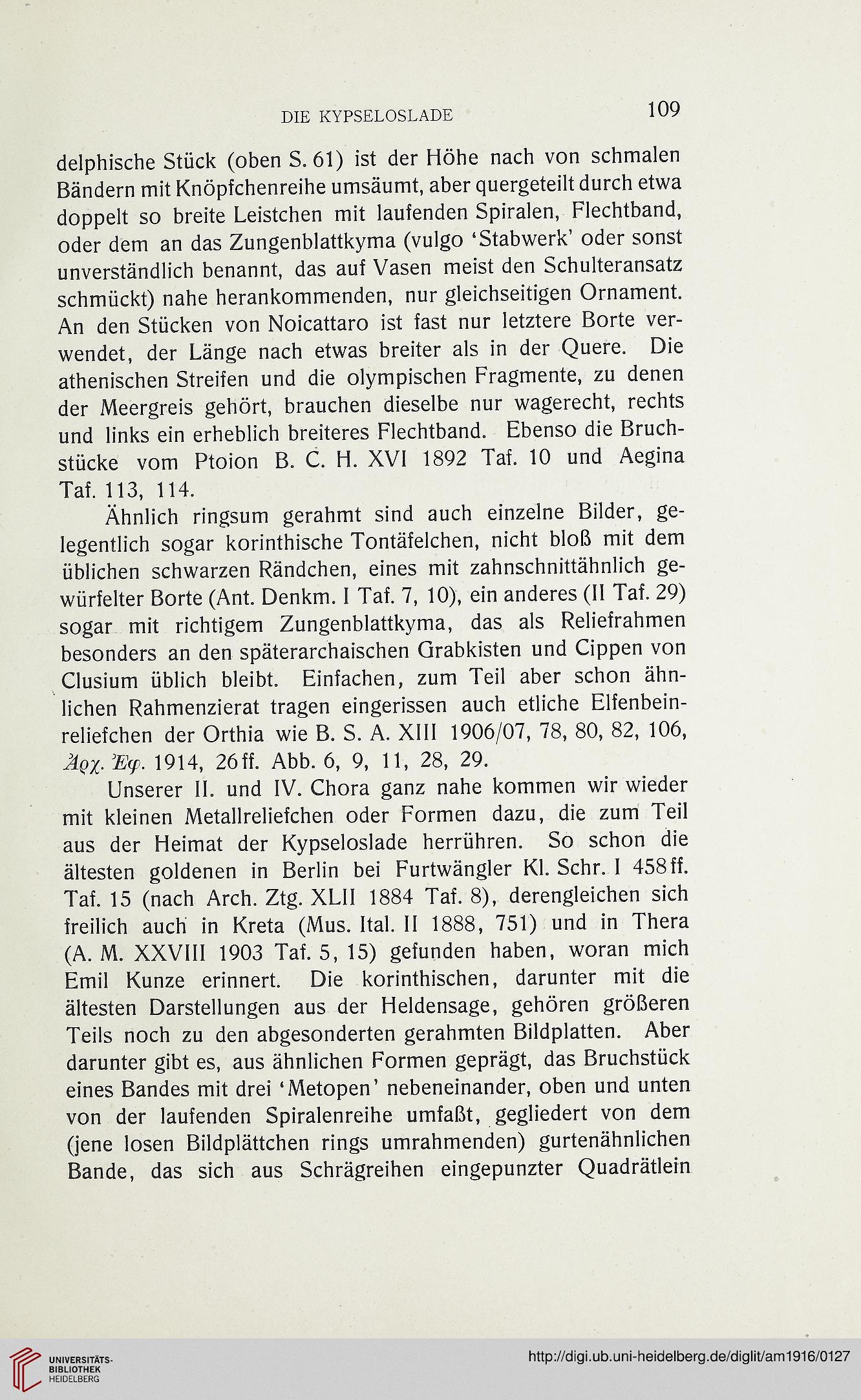DIE KYPSELOSLADE
109
delphische Stück (oben S. 61) ist der Höhe nach von schmalen
Bändern mit Knöpfchenreihe umsäumt, aber quergeteilt durch etwa
doppelt so breite Leistchen mit laufenden Spiralen, Flechtband,
oder dem an das Zungenblattkyma (vulgo ‘Stabwerk’ oder sonst
unverständlich benannt, das auf Vasen meist den Schulteransatz
schmückt) nahe herankommenden, nur gleichseitigen Ornament.
An den Stücken von Noicattaro ist fast nur letztere Borte ver-
wendet, der Länge nach etwas breiter als in der Quere. Die
athenischen Streifen und die olympischen Fragmente, zu denen
der Meergreis gehört, brauchen dieselbe nur wagerecht, rechts
und links ein erheblich breiteres Flechtband. Ebenso die Bruch-
stücke vom Ptoion B. C. H. XVI 1892 Taf. 10 und Aegina
Taf. 113, 114.
Ähnlich ringsum gerahmt sind auch einzelne Bilder, ge-
legentlich sogar korinthische Tontäfelchen, nicht bloß mit dem
üblichen schwarzen Rändchen, eines mit zahnschnittähnlich ge-
würfelter Borte (Ant. Denkm. I Taf. 7, 10), ein anderes (II Taf. 29)
sogar mit richtigem Zungenblattkyma, das als Reliefrahmen
besonders an den späterarchaischen Grabkisten und Cippen von
Clusium üblich bleibt. Einfachen, zum Teil aber schon ähn-
lichen Rahmenzierat tragen eingerissen auch etliche Elfenbein-
reliefchen der Orthia wie B. S. A. XIII 1906/07, 78, 80, 82, 106,
äqx. Ecp. 1914, 26 ff. Abb. 6, 9, 11, 28, 29.
Unserer II. und IV. Chora ganz nahe kommen wir wieder
mit kleinen Metallreliefchen oder Formen dazu, die zum Teil
aus der Heimat der Kypseloslade herrühren. So schon die
ältesten goldenen in Berlin bei Furtwängler Kl. Sehr. I 458ff.
Taf. 15 (nach Arch. Ztg. XLII 1884 Taf. 8), derengleichen sich
freilich auch in Kreta (Mus. Ital. II 1888, 751) und in Thera
(A. M. XXVIII 1903 Taf. 5, 15) gefunden haben, woran mich
Emil Kunze erinnert. Die korinthischen, darunter mit die
ältesten Darstellungen aus der Heldensage, gehören größeren
Teils noch zu den abgesonderten gerahmten Bildplatten. Aber
darunter gibt es, aus ähnlichen Formen geprägt, das Bruchstück
eines Bandes mit drei ‘Metopen’ nebeneinander, oben und unten
von der laufenden Spiralenreihe umfaßt, gegliedert von dem
(jene losen Bildplättchen rings umrahmenden) gurtenähnlichen
Bande, das sich aus Schrägreihen eingepunzter Quadrätlein
109
delphische Stück (oben S. 61) ist der Höhe nach von schmalen
Bändern mit Knöpfchenreihe umsäumt, aber quergeteilt durch etwa
doppelt so breite Leistchen mit laufenden Spiralen, Flechtband,
oder dem an das Zungenblattkyma (vulgo ‘Stabwerk’ oder sonst
unverständlich benannt, das auf Vasen meist den Schulteransatz
schmückt) nahe herankommenden, nur gleichseitigen Ornament.
An den Stücken von Noicattaro ist fast nur letztere Borte ver-
wendet, der Länge nach etwas breiter als in der Quere. Die
athenischen Streifen und die olympischen Fragmente, zu denen
der Meergreis gehört, brauchen dieselbe nur wagerecht, rechts
und links ein erheblich breiteres Flechtband. Ebenso die Bruch-
stücke vom Ptoion B. C. H. XVI 1892 Taf. 10 und Aegina
Taf. 113, 114.
Ähnlich ringsum gerahmt sind auch einzelne Bilder, ge-
legentlich sogar korinthische Tontäfelchen, nicht bloß mit dem
üblichen schwarzen Rändchen, eines mit zahnschnittähnlich ge-
würfelter Borte (Ant. Denkm. I Taf. 7, 10), ein anderes (II Taf. 29)
sogar mit richtigem Zungenblattkyma, das als Reliefrahmen
besonders an den späterarchaischen Grabkisten und Cippen von
Clusium üblich bleibt. Einfachen, zum Teil aber schon ähn-
lichen Rahmenzierat tragen eingerissen auch etliche Elfenbein-
reliefchen der Orthia wie B. S. A. XIII 1906/07, 78, 80, 82, 106,
äqx. Ecp. 1914, 26 ff. Abb. 6, 9, 11, 28, 29.
Unserer II. und IV. Chora ganz nahe kommen wir wieder
mit kleinen Metallreliefchen oder Formen dazu, die zum Teil
aus der Heimat der Kypseloslade herrühren. So schon die
ältesten goldenen in Berlin bei Furtwängler Kl. Sehr. I 458ff.
Taf. 15 (nach Arch. Ztg. XLII 1884 Taf. 8), derengleichen sich
freilich auch in Kreta (Mus. Ital. II 1888, 751) und in Thera
(A. M. XXVIII 1903 Taf. 5, 15) gefunden haben, woran mich
Emil Kunze erinnert. Die korinthischen, darunter mit die
ältesten Darstellungen aus der Heldensage, gehören größeren
Teils noch zu den abgesonderten gerahmten Bildplatten. Aber
darunter gibt es, aus ähnlichen Formen geprägt, das Bruchstück
eines Bandes mit drei ‘Metopen’ nebeneinander, oben und unten
von der laufenden Spiralenreihe umfaßt, gegliedert von dem
(jene losen Bildplättchen rings umrahmenden) gurtenähnlichen
Bande, das sich aus Schrägreihen eingepunzter Quadrätlein