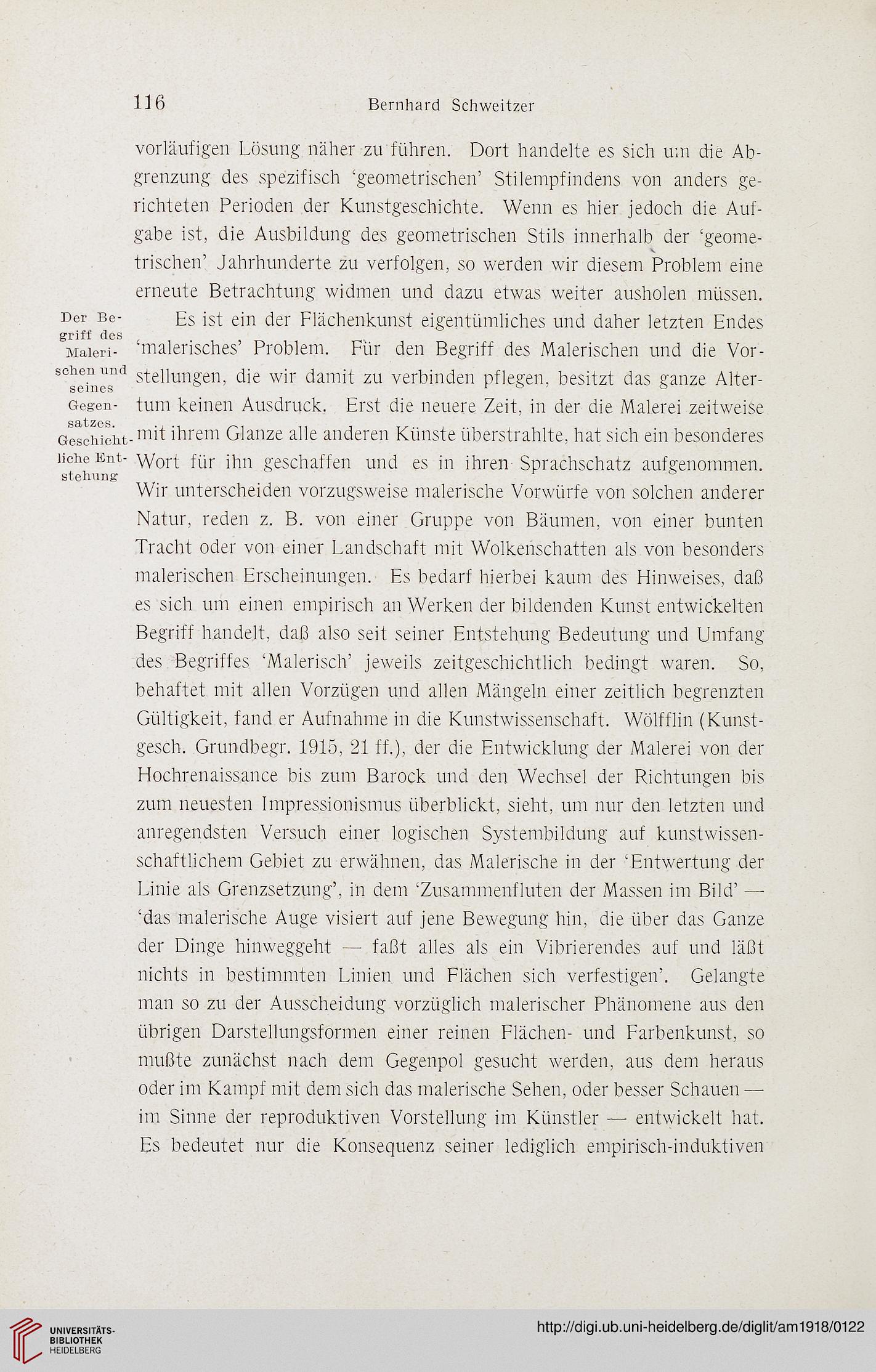116
Bernhard Schweitzer
vorläufigen Lösung näher zu führen. Dort handelte es sich um die Ab-
grenzung des spezifisch 'geometrischen' Stilempfindens von anders ge-
richteten Perioden der Kunstgeschichte. Wenn es hier jedoch die Auf-
gabe ist, die Ausbildung des geometrischen Stils innerhalb der 'geome-
trischen' Jahrhunderte zu verfolgen, so werden wir diesem Problem eine
erneute Betrachtung widmen und dazu etwas weiter ausholen müssen.
Der Be- Es ist ein der Flächenkunst eigentümliches und daher letzten Endes
Maieri- 'malerisches' Problem. Für den Begriff des Malerischen und die Vor-
Stellungen, die wir damit zu verbinden pflegen, besitzt das ganze Alter-
Gegen- tum keinen Ausdruck. Erst die neuere Zeit, in der die Malerei zeitweise
Gescheht-rmt ihrem Glanze alle anderen Künste überstrahlte, hat sich ein besonderes
liehe Ent- Wort für ihn geschaffen und es in ihren Sprachschatz aufgenommen.
stehung
Wir unterscheiden vorzugsweise malerische Vorwürfe von solchen anderer
Natur, reden z. B. von einer Gruppe von Bäumen, von einer bunten
Tracht oder von einer Landschaft mit Wolkenschatten als von besonders
malerischen Erscheinungen. Es bedarf hierbei kaum des Hinweises, daß
es sich um einen empirisch an Werken der bildenden Kunst entwickelten
Begriff handelt, daß also seit seiner Entstehung Bedeutung und Umfang
des Begriffes 'Malerisch' jeweils zeitgeschichtlich bedingt waren. So,
behaftet mit allen Vorzügen und allen Mängeln einer zeitlich begrenzten
Gültigkeit, fand er Aufnahme in die Kunstwissenschaft. Wölfflin (Kunst -
gesch. Grundbegr. 1915, 21 ff.), der die Entwicklung der Malerei von der
Hochrenaissance bis zum Barock und den Wechsel der Richtungen bis
zum neuesten Impressionismus überblickt, sieht, um nur den letzten und
anregendsten Versuch einer logischen Systembildung auf kunstwissen-
schaftlichem Gebiet zu erwähnen, das Malerische in der 'Entwertung der
Linie als Grenzsetzung', in dem 'Zusammenfluten der Massen im Bild' —-
'das malerische Auge visiert auf jene Bewegung hin, die über das Ganze
der Dinge hinweggeht — faßt alles als ein Vibrierendes auf und läßt
nichts in bestimmten Linien und Flächen sich verfestigen'. Gelangte
man so zu der Ausscheidung vorzüglich malerischer Phänomene aus den
übrigen Darstellungsformen einer reinen Flächen- und Farbenkunst, so
mußte zunächst nach dem Gegenpol gesucht werden, aus dem heraus
oder im Kampf mit dem sich das malerische Sehen, oder besser Schauen —
im Sinne der reproduktiven Vorstellung im Künstler — entwickelt hat.
Es bedeutet nur die Konsequenz seiner lediglich empirisch-induktiven
Bernhard Schweitzer
vorläufigen Lösung näher zu führen. Dort handelte es sich um die Ab-
grenzung des spezifisch 'geometrischen' Stilempfindens von anders ge-
richteten Perioden der Kunstgeschichte. Wenn es hier jedoch die Auf-
gabe ist, die Ausbildung des geometrischen Stils innerhalb der 'geome-
trischen' Jahrhunderte zu verfolgen, so werden wir diesem Problem eine
erneute Betrachtung widmen und dazu etwas weiter ausholen müssen.
Der Be- Es ist ein der Flächenkunst eigentümliches und daher letzten Endes
Maieri- 'malerisches' Problem. Für den Begriff des Malerischen und die Vor-
Stellungen, die wir damit zu verbinden pflegen, besitzt das ganze Alter-
Gegen- tum keinen Ausdruck. Erst die neuere Zeit, in der die Malerei zeitweise
Gescheht-rmt ihrem Glanze alle anderen Künste überstrahlte, hat sich ein besonderes
liehe Ent- Wort für ihn geschaffen und es in ihren Sprachschatz aufgenommen.
stehung
Wir unterscheiden vorzugsweise malerische Vorwürfe von solchen anderer
Natur, reden z. B. von einer Gruppe von Bäumen, von einer bunten
Tracht oder von einer Landschaft mit Wolkenschatten als von besonders
malerischen Erscheinungen. Es bedarf hierbei kaum des Hinweises, daß
es sich um einen empirisch an Werken der bildenden Kunst entwickelten
Begriff handelt, daß also seit seiner Entstehung Bedeutung und Umfang
des Begriffes 'Malerisch' jeweils zeitgeschichtlich bedingt waren. So,
behaftet mit allen Vorzügen und allen Mängeln einer zeitlich begrenzten
Gültigkeit, fand er Aufnahme in die Kunstwissenschaft. Wölfflin (Kunst -
gesch. Grundbegr. 1915, 21 ff.), der die Entwicklung der Malerei von der
Hochrenaissance bis zum Barock und den Wechsel der Richtungen bis
zum neuesten Impressionismus überblickt, sieht, um nur den letzten und
anregendsten Versuch einer logischen Systembildung auf kunstwissen-
schaftlichem Gebiet zu erwähnen, das Malerische in der 'Entwertung der
Linie als Grenzsetzung', in dem 'Zusammenfluten der Massen im Bild' —-
'das malerische Auge visiert auf jene Bewegung hin, die über das Ganze
der Dinge hinweggeht — faßt alles als ein Vibrierendes auf und läßt
nichts in bestimmten Linien und Flächen sich verfestigen'. Gelangte
man so zu der Ausscheidung vorzüglich malerischer Phänomene aus den
übrigen Darstellungsformen einer reinen Flächen- und Farbenkunst, so
mußte zunächst nach dem Gegenpol gesucht werden, aus dem heraus
oder im Kampf mit dem sich das malerische Sehen, oder besser Schauen —
im Sinne der reproduktiven Vorstellung im Künstler — entwickelt hat.
Es bedeutet nur die Konsequenz seiner lediglich empirisch-induktiven