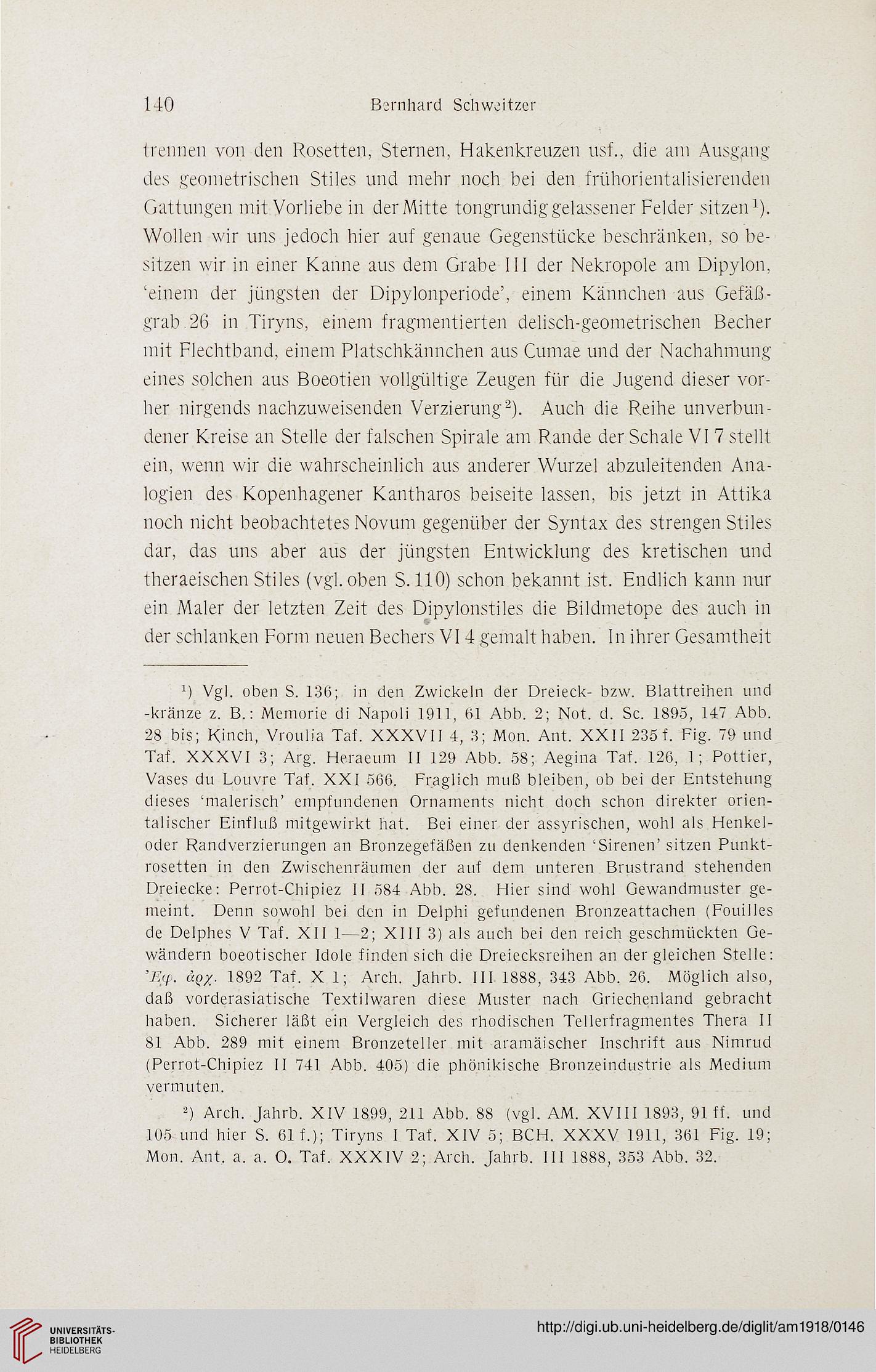140
Bernhard Schweitzer
trennen von den Rosetten, Sternen. Hakenkreuzen usf., die am Ausgang
des geometrischen Stiles und mehr noch bei den frühorientalisierenden
Gattungen mit Vorliebe in der Mitte tongrundig gelassener Felder sitzen i).
Wollen wir uns jedoch hier auf genaue Gegenstücke beschränken, so be-
sitzen wir in einer Kanne aus dem Grabe Hl der Nekropole am Dipylon,
'einem der jüngsten der Dipylonperiode', einem Kännchen aus Gefäß -
grab 26 in Tiryns, einem fragmentierten delisch-geometrischen Becher
mit Flechtband, einem Platschkännchen aus Cumae und der Nachahmung
eines solchen aus Boeotien vollgültige Zeugen für die Jugend dieser vor-
her nirgends nachzuweisenden Verzierung^). Auch die Reihe unverbun-
dener Kreise an Stelle der falschen Spirale am Rande der Schale VI 7 stellt
ein, wenn wir die wahrscheinlich aus anderer Wurzel abzuleitenden Ana-
logien des Kopenhagener Kantharos beiseite lassen, bis jetzt in Attika
noch nicht beobachtetes Novum gegenüber der Syntax des strengen Stiles
dar, das uns aber aus der jüngsten Entwicklung des kretischen und
theraeischen Stiles (vgl. oben S. 110) schon bekannt ist. Endlich kann nur
ein Maler der letzten Zeit des Dipylonstiles die Bildmetope des auch in
der schlanken Form neuen Bechers VI 4 gemalt haben, ln ihrer Gesamtheit
0 Vgl. oben S. 136; üi den Zwickein der Dreieck- bzw. Biattreihen und
-kränze z. B.: Memorie di Napoli 1911, 61 Abb. 2; Not. d. Sc. 1895, 147 Abb.
28 bis; Rinch, Vrouiia Tat. XXXVH 4, 3; Mon. Ant. XXH 235 f. Fig. 79 und
Tat. XXXVi 3; Arg. Heraeum ]] 129 Abb. 58; Aegina Tat. 126, 1; Pottier,
Vases du Louvre Tat. XXi 566. Fraglich muß bieiben, ob bei der Entstehung
dieses 'maierisch' empfundenen Ornaments nicht doch schon direkter orien-
talischer Einfluß mitgewirkt hat. Bei einer der assyrischen, wohl als Henkel-
oder Randverzierungen an Bronzegefäßen zu denkenden 'Sirenen' sitzen Punkt-
rosetten in den Zwischenräumen der auf dem unteren Brustrand stehenden
Dreiecke: Perrot-Chipiez 11 584 Abb. 28. Hier sind wohl Oewandmuster ge-
meint. Denn sowohl bei den in Delphi gefundenen Bronzeattachen (Fouilles
de Delphes V Tat. XI! 1—2; X1H 3) als auch bei den reich geschmückten Ge-
wändern boeotischer Idole finden sich die Dreiecksreihen an der gleichen Stelle:
'7^. 1892 Tat. X 1; Arch. Jahrb. 111 1888, 343 Abb. 26. Möglich also,
daß vorderasiatische Textilwaren diese Muster nach Griechenland gebracht
haben. Sicherer läßt ein Vergleich des rhodischen Telierfragmentes Thera 11
81 Abb. 289 mit einem Bronzeteller mit aramäischer Inschrift aus Nimrud
(Perrot-Chipiez H 741 Abb. 405) die phönikische Bronzeindustrie als Medium
vermuten.
0 Arch. Jahrb. XIV 1899, 211 Abb. 88 (vgl. AM. XV111 1893, 91 ff. und
105 und hier S. 61 f.); Tiryns 1 Taf. XIV 5; BCH. XXXV 1911, 361 Fig. 19;
Mon. Ant. a. a. O. Taf. XXXIV 2; Arch. Jahrb. 111 1888, 353 Abb. 32.
Bernhard Schweitzer
trennen von den Rosetten, Sternen. Hakenkreuzen usf., die am Ausgang
des geometrischen Stiles und mehr noch bei den frühorientalisierenden
Gattungen mit Vorliebe in der Mitte tongrundig gelassener Felder sitzen i).
Wollen wir uns jedoch hier auf genaue Gegenstücke beschränken, so be-
sitzen wir in einer Kanne aus dem Grabe Hl der Nekropole am Dipylon,
'einem der jüngsten der Dipylonperiode', einem Kännchen aus Gefäß -
grab 26 in Tiryns, einem fragmentierten delisch-geometrischen Becher
mit Flechtband, einem Platschkännchen aus Cumae und der Nachahmung
eines solchen aus Boeotien vollgültige Zeugen für die Jugend dieser vor-
her nirgends nachzuweisenden Verzierung^). Auch die Reihe unverbun-
dener Kreise an Stelle der falschen Spirale am Rande der Schale VI 7 stellt
ein, wenn wir die wahrscheinlich aus anderer Wurzel abzuleitenden Ana-
logien des Kopenhagener Kantharos beiseite lassen, bis jetzt in Attika
noch nicht beobachtetes Novum gegenüber der Syntax des strengen Stiles
dar, das uns aber aus der jüngsten Entwicklung des kretischen und
theraeischen Stiles (vgl. oben S. 110) schon bekannt ist. Endlich kann nur
ein Maler der letzten Zeit des Dipylonstiles die Bildmetope des auch in
der schlanken Form neuen Bechers VI 4 gemalt haben, ln ihrer Gesamtheit
0 Vgl. oben S. 136; üi den Zwickein der Dreieck- bzw. Biattreihen und
-kränze z. B.: Memorie di Napoli 1911, 61 Abb. 2; Not. d. Sc. 1895, 147 Abb.
28 bis; Rinch, Vrouiia Tat. XXXVH 4, 3; Mon. Ant. XXH 235 f. Fig. 79 und
Tat. XXXVi 3; Arg. Heraeum ]] 129 Abb. 58; Aegina Tat. 126, 1; Pottier,
Vases du Louvre Tat. XXi 566. Fraglich muß bieiben, ob bei der Entstehung
dieses 'maierisch' empfundenen Ornaments nicht doch schon direkter orien-
talischer Einfluß mitgewirkt hat. Bei einer der assyrischen, wohl als Henkel-
oder Randverzierungen an Bronzegefäßen zu denkenden 'Sirenen' sitzen Punkt-
rosetten in den Zwischenräumen der auf dem unteren Brustrand stehenden
Dreiecke: Perrot-Chipiez 11 584 Abb. 28. Hier sind wohl Oewandmuster ge-
meint. Denn sowohl bei den in Delphi gefundenen Bronzeattachen (Fouilles
de Delphes V Tat. XI! 1—2; X1H 3) als auch bei den reich geschmückten Ge-
wändern boeotischer Idole finden sich die Dreiecksreihen an der gleichen Stelle:
'7^. 1892 Tat. X 1; Arch. Jahrb. 111 1888, 343 Abb. 26. Möglich also,
daß vorderasiatische Textilwaren diese Muster nach Griechenland gebracht
haben. Sicherer läßt ein Vergleich des rhodischen Telierfragmentes Thera 11
81 Abb. 289 mit einem Bronzeteller mit aramäischer Inschrift aus Nimrud
(Perrot-Chipiez H 741 Abb. 405) die phönikische Bronzeindustrie als Medium
vermuten.
0 Arch. Jahrb. XIV 1899, 211 Abb. 88 (vgl. AM. XV111 1893, 91 ff. und
105 und hier S. 61 f.); Tiryns 1 Taf. XIV 5; BCH. XXXV 1911, 361 Fig. 19;
Mon. Ant. a. a. O. Taf. XXXIV 2; Arch. Jahrb. 111 1888, 353 Abb. 32.