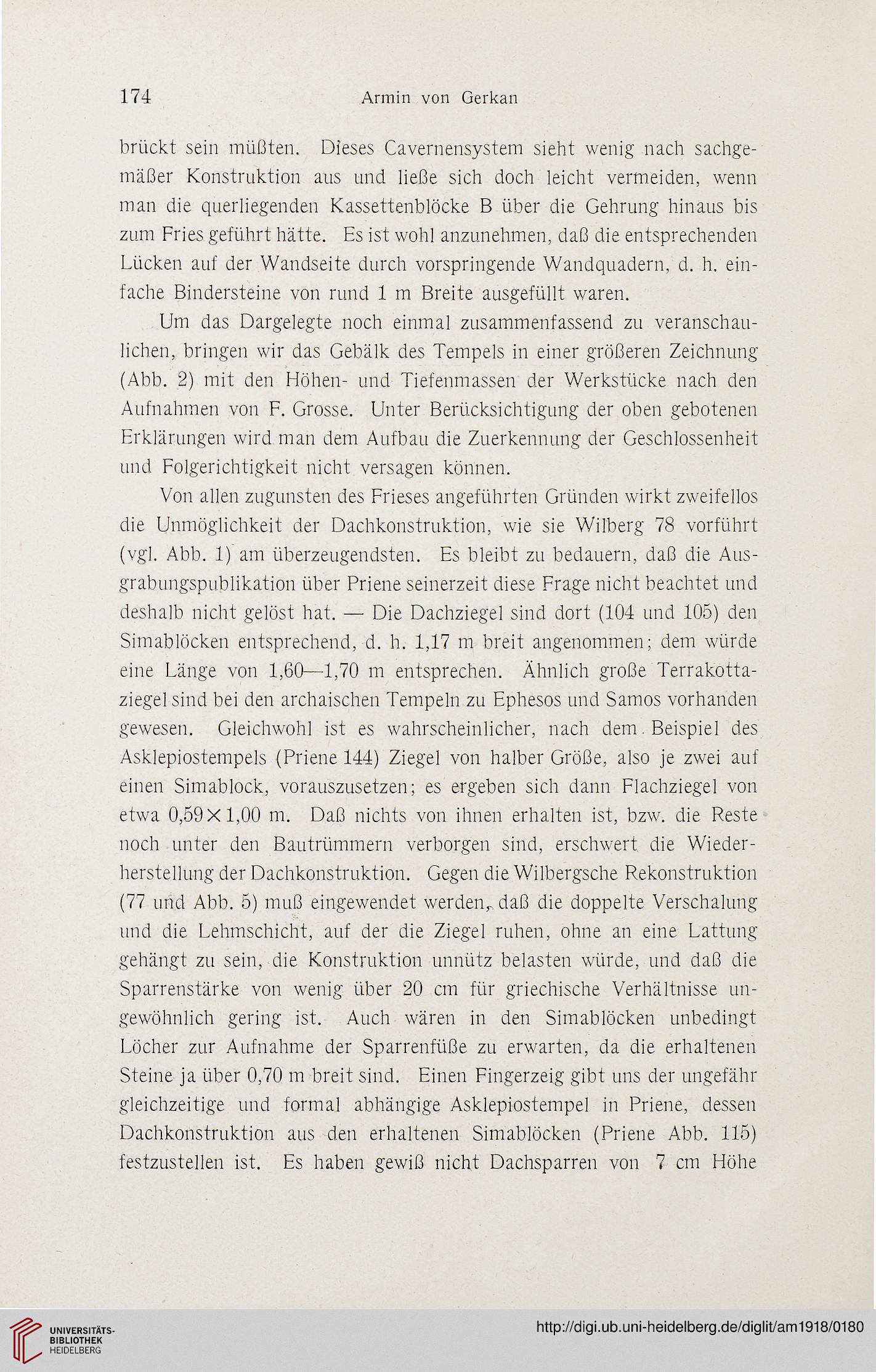174
Armin von Cerkan
brückt sein müßten. Dieses Cavernensystem sieht wenig nach sachge-
mäßer Konstruktion aus und iieße sich doch ieicht vermeiden, wenn
man die querhegenden Kassettenbiöcke B über die Gehrung hinaus bis
zum Fries geführt hätte. Es ist wohi anzunehmen, daß die entsprechenden
Lücken auf der Wandseite durch vorspringende Wandquadern, d. h. ein-
fache Bindersteine von rund 1 m Breite ausgefüht waren.
Um das Dargeiegte noch einmai zusammenfassend zu veranschau-
iichen, bringen wir das Gebäik des Tempeis in einer größeren Zeichnung
(Abb. 2) mit den Höhen- und Tiefenmassen der Werkstücke nach den
Aufnahmen von F. Grosse. Unter Berücksichtigung der oben gebotenen
Erkiärungen wird man dem Aufbau die Zuerkennung der Geschlossenheit
und Foigerichtigkeit nicht versagen können.
Von alien zugunsten des Frieses angeführten Gründen wirkt zweifellos
die Unmöglichkeit der Dachkonstruktion, wie sie Wilberg 78 vorführt
(vgl. Abb. 1) am überzeugendsten. Es bleibt zu bedauern, daß die Aus-
grabungspublikation über Priene seinerzeit diese Frage nicht beachtet und
deshalb nicht gelöst hat. — Die Dachziegel sind dort (104 und 105) den
Simablöcken entsprechend, d. h. 1,17 m breit angenommen; dem würde
eine Länge von 1,60—1,70 m entsprechen. Ähnlich große Terrakotta-
ziegel sind bei den archaischen Tempeln zu Ephesos und Samos vorhanden
gewesen. Gleichwohl ist es wahrscheinlicher, nach dem Beispiel des
Asklepiostempels (Priene 144) Ziegel von halber Größe, also je zwei auf
einen Simablock, vorauszusetzen; es ergeben sich dann Flachziegel von
etwa 0,59X1,00 m. Daß nichts von ihnen erhalten ist, bzw. die Reste
noch unter den Bautrümmern verborgen sind, erschwert die Wieder-
herstellung der Dachkonstruktion. Gegen die Wilbergsche Rekonstruktion
(77 und Abb. 5) muß eingewendet werden,- daß die doppelte Verschalung
und die Lehmschicht, auf der die Ziegel ruhen, ohne an eine Lattung
gehängt zu sein, die Konstruktion unnütz belasten würde, und daß die
Sparrenstärke von wenig über 20 cm für griechische Verhältnisse un-
gewöhnlich gering ist. Auch wären in den Simablöcken unbedingt
Löcher zur Aufnahme der Sparrenfüße zu erwarten, da die erhaltenen
Steine ja über 0,70 m breit sind. Einen Fingerzeig gibt uns der ungefähr
gleichzeitige und formal abhängige Asklepiostempel in Priene, dessen
Dachkonstruktion aus den erhaltenen Simablöcken (Priene Abb. 115)
festzustellen ist. Es haben gewiß nicht Dachsparren von 7 cm Höhe
Armin von Cerkan
brückt sein müßten. Dieses Cavernensystem sieht wenig nach sachge-
mäßer Konstruktion aus und iieße sich doch ieicht vermeiden, wenn
man die querhegenden Kassettenbiöcke B über die Gehrung hinaus bis
zum Fries geführt hätte. Es ist wohi anzunehmen, daß die entsprechenden
Lücken auf der Wandseite durch vorspringende Wandquadern, d. h. ein-
fache Bindersteine von rund 1 m Breite ausgefüht waren.
Um das Dargeiegte noch einmai zusammenfassend zu veranschau-
iichen, bringen wir das Gebäik des Tempeis in einer größeren Zeichnung
(Abb. 2) mit den Höhen- und Tiefenmassen der Werkstücke nach den
Aufnahmen von F. Grosse. Unter Berücksichtigung der oben gebotenen
Erkiärungen wird man dem Aufbau die Zuerkennung der Geschlossenheit
und Foigerichtigkeit nicht versagen können.
Von alien zugunsten des Frieses angeführten Gründen wirkt zweifellos
die Unmöglichkeit der Dachkonstruktion, wie sie Wilberg 78 vorführt
(vgl. Abb. 1) am überzeugendsten. Es bleibt zu bedauern, daß die Aus-
grabungspublikation über Priene seinerzeit diese Frage nicht beachtet und
deshalb nicht gelöst hat. — Die Dachziegel sind dort (104 und 105) den
Simablöcken entsprechend, d. h. 1,17 m breit angenommen; dem würde
eine Länge von 1,60—1,70 m entsprechen. Ähnlich große Terrakotta-
ziegel sind bei den archaischen Tempeln zu Ephesos und Samos vorhanden
gewesen. Gleichwohl ist es wahrscheinlicher, nach dem Beispiel des
Asklepiostempels (Priene 144) Ziegel von halber Größe, also je zwei auf
einen Simablock, vorauszusetzen; es ergeben sich dann Flachziegel von
etwa 0,59X1,00 m. Daß nichts von ihnen erhalten ist, bzw. die Reste
noch unter den Bautrümmern verborgen sind, erschwert die Wieder-
herstellung der Dachkonstruktion. Gegen die Wilbergsche Rekonstruktion
(77 und Abb. 5) muß eingewendet werden,- daß die doppelte Verschalung
und die Lehmschicht, auf der die Ziegel ruhen, ohne an eine Lattung
gehängt zu sein, die Konstruktion unnütz belasten würde, und daß die
Sparrenstärke von wenig über 20 cm für griechische Verhältnisse un-
gewöhnlich gering ist. Auch wären in den Simablöcken unbedingt
Löcher zur Aufnahme der Sparrenfüße zu erwarten, da die erhaltenen
Steine ja über 0,70 m breit sind. Einen Fingerzeig gibt uns der ungefähr
gleichzeitige und formal abhängige Asklepiostempel in Priene, dessen
Dachkonstruktion aus den erhaltenen Simablöcken (Priene Abb. 115)
festzustellen ist. Es haben gewiß nicht Dachsparren von 7 cm Höhe