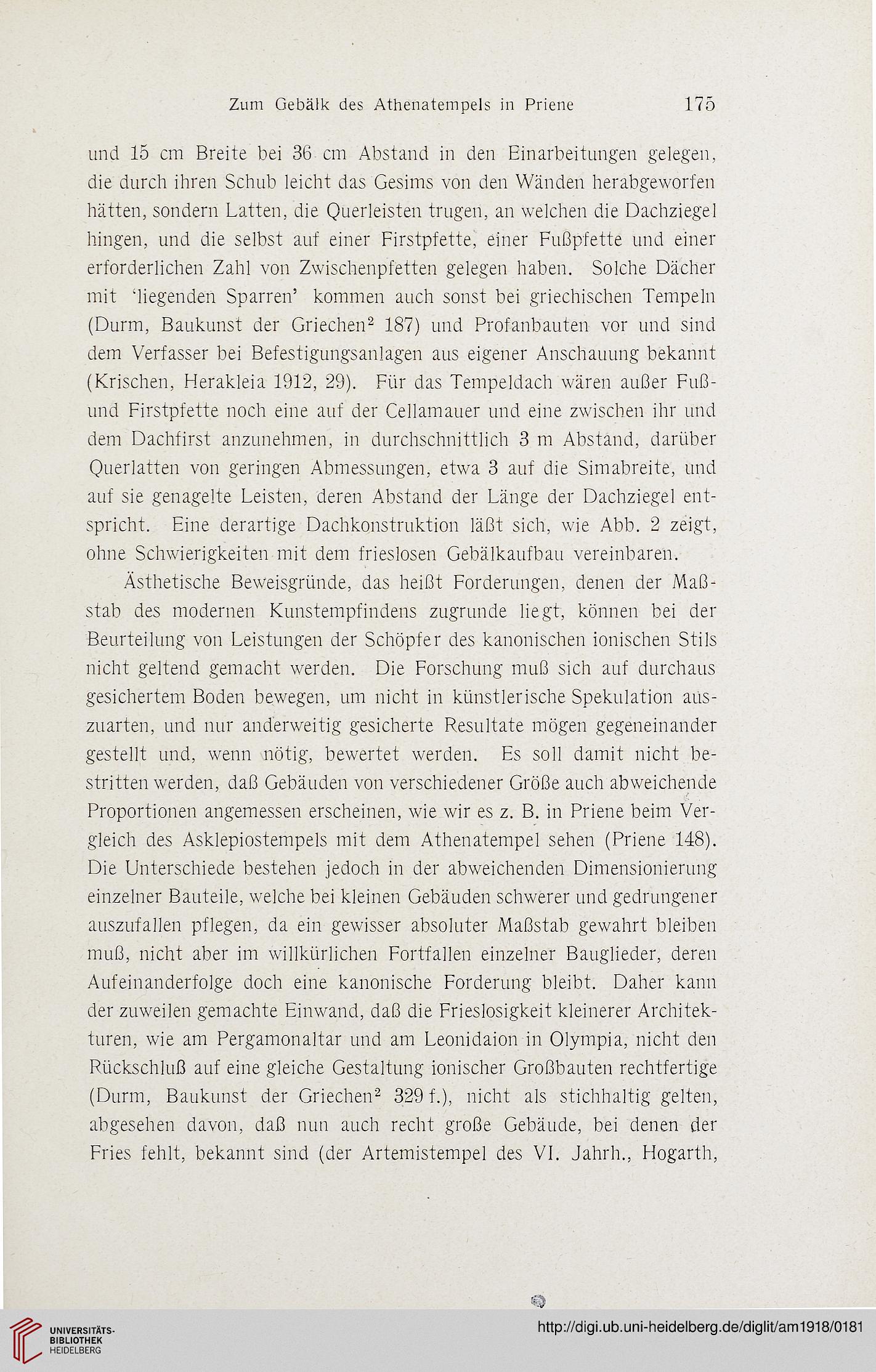Zum Gebäik des Athenatempels in Priene
175
und 15 cm Breite bei 36 cm Abstand in den Einarbeitungen gelegen,
die durch ihren Schub leicht das Gesims von den Wänden herabgeworfen
hätten, sondern Latten, die Querleisten trugen, an welchen die Dachziegel
hingen, und die selbst auf einer Firstpfette, einer Fußpfette und einer
erforderlichen Zahl von Zwischenpfetten gelegen haben. Solche Dächer
mit liegenden Sparren' kommen auch sonst bei griechischen Tempeln
(Durm, Baukunst der Griechen^ 187) und Profanbauten vor und sind
dem Verfasser bei Befestigungsanlagen aus eigener Anschauung bekannt
(Krischen, Herakleia 1912, 29). Für das Tempeldach wären außer Fuß-
und Firstpfette noch eine auf der Cellamauer und eine zwischen ihr und
dem Dachfirst anzunehmen, in durchschnittlich 3 m Abstand, darüber
Querlatten von geringen Abmessungen, etwa 3 auf die Simabreite, und
auf sie genagelte Leisten, deren Abstand der Länge der Dachziegel ent-
spricht. Eine derartige Dachkonstruktion läßt sich, wie Abb. 2 zeigt,
ohne Schwierigkeiten mit dem frieslosen Gebälkaufbau vereinbaren.
Ästhetische Beweisgründe, das heißt Forderungen, denen der Maß-
stab des modernen Kunstempfindens zugrunde liegt, können bei der
Beurteilung von Leistungen der Schöpfer des kanonischen ionischen Stils
nicht geltend gemacht werden. Die Forschung muß sich auf durchaus
gesichertem Boden bewegen, um nicht in künstlerische Spekulation aüs-
zuarten, und nur anderweitig gesicherte Resultate mögen gegeneinander
gestellt und, wenn nötig, bewertet werden. Es soll damit nicht be-
stritten werden, daß Gebäuden von verschiedener Größe auch abweichende
Proportionen angemessen erscheinen, wie wir es z. B. in Priene beim Ver-
gleich des Asklepiostempels mit dem Athenatempel sehen (Priene 148).
Die Unterschiede bestehen jedoch in der abweichenden Dimensionierung
einzelner Bauteile, welche bei kleinen Gebäuden schwerer und gedrungener
auszufallen pflegen, da ein gewisser absoluter Maßstab gewahrt bleiben
muß, nicht aber im willkürlichen Fortfallen einzelner Bauglieder, deren
Aufeinanderfolge doch eine kanonische Forderung bleibt. Daher kann
der zuweilen gemachte Einwand, daß die Frieslosigkeit kleinerer Architek-
turen, wie am Pergamonaltar und am Leonidaion in Olympia, nicht den
Rückschluß auf eine gleiche Gestaltung ionischer Großbauten rechtfertige
(Durm, Baukunst der Griechen^ 329 f.), nicht als stichhaltig gelten,
abgesehen davon, daß nun auch recht große Gebäude, bei denen der
Fries fehlt, bekannt sind (der Artemistempei des VI. Jahrh., Hogarth,
175
und 15 cm Breite bei 36 cm Abstand in den Einarbeitungen gelegen,
die durch ihren Schub leicht das Gesims von den Wänden herabgeworfen
hätten, sondern Latten, die Querleisten trugen, an welchen die Dachziegel
hingen, und die selbst auf einer Firstpfette, einer Fußpfette und einer
erforderlichen Zahl von Zwischenpfetten gelegen haben. Solche Dächer
mit liegenden Sparren' kommen auch sonst bei griechischen Tempeln
(Durm, Baukunst der Griechen^ 187) und Profanbauten vor und sind
dem Verfasser bei Befestigungsanlagen aus eigener Anschauung bekannt
(Krischen, Herakleia 1912, 29). Für das Tempeldach wären außer Fuß-
und Firstpfette noch eine auf der Cellamauer und eine zwischen ihr und
dem Dachfirst anzunehmen, in durchschnittlich 3 m Abstand, darüber
Querlatten von geringen Abmessungen, etwa 3 auf die Simabreite, und
auf sie genagelte Leisten, deren Abstand der Länge der Dachziegel ent-
spricht. Eine derartige Dachkonstruktion läßt sich, wie Abb. 2 zeigt,
ohne Schwierigkeiten mit dem frieslosen Gebälkaufbau vereinbaren.
Ästhetische Beweisgründe, das heißt Forderungen, denen der Maß-
stab des modernen Kunstempfindens zugrunde liegt, können bei der
Beurteilung von Leistungen der Schöpfer des kanonischen ionischen Stils
nicht geltend gemacht werden. Die Forschung muß sich auf durchaus
gesichertem Boden bewegen, um nicht in künstlerische Spekulation aüs-
zuarten, und nur anderweitig gesicherte Resultate mögen gegeneinander
gestellt und, wenn nötig, bewertet werden. Es soll damit nicht be-
stritten werden, daß Gebäuden von verschiedener Größe auch abweichende
Proportionen angemessen erscheinen, wie wir es z. B. in Priene beim Ver-
gleich des Asklepiostempels mit dem Athenatempel sehen (Priene 148).
Die Unterschiede bestehen jedoch in der abweichenden Dimensionierung
einzelner Bauteile, welche bei kleinen Gebäuden schwerer und gedrungener
auszufallen pflegen, da ein gewisser absoluter Maßstab gewahrt bleiben
muß, nicht aber im willkürlichen Fortfallen einzelner Bauglieder, deren
Aufeinanderfolge doch eine kanonische Forderung bleibt. Daher kann
der zuweilen gemachte Einwand, daß die Frieslosigkeit kleinerer Architek-
turen, wie am Pergamonaltar und am Leonidaion in Olympia, nicht den
Rückschluß auf eine gleiche Gestaltung ionischer Großbauten rechtfertige
(Durm, Baukunst der Griechen^ 329 f.), nicht als stichhaltig gelten,
abgesehen davon, daß nun auch recht große Gebäude, bei denen der
Fries fehlt, bekannt sind (der Artemistempei des VI. Jahrh., Hogarth,