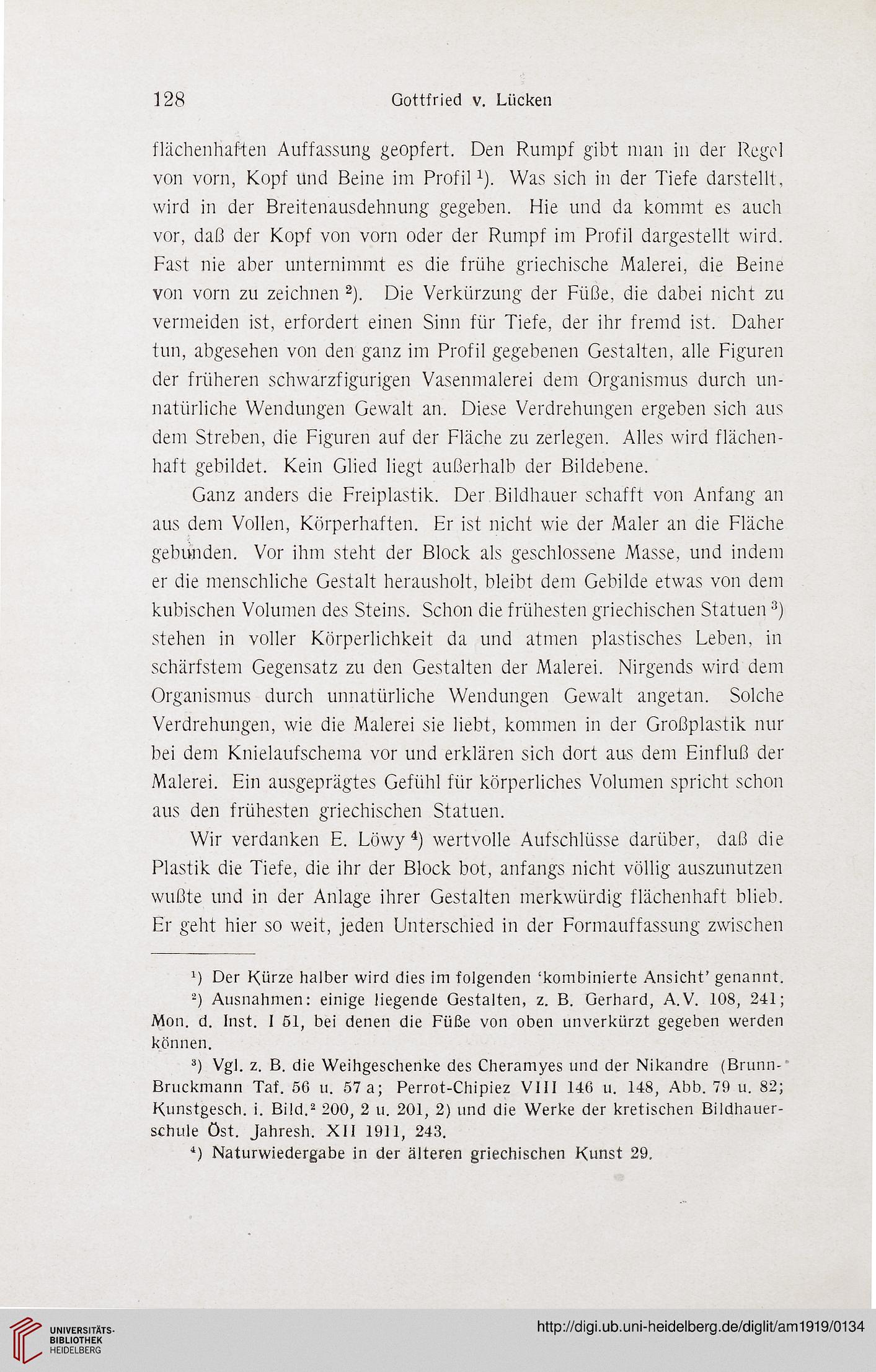128
Gottfried v. Lücken
flächenhaf-ten Auffassung geopfert. Den Rumpf gibt man in der Regel
von vorn, Kopf und Beine im ProfiO). Was sich in der Tiefe darsteHt,
wird in der Breitenausdehnung gegeben. Hie und da kommt es auch
vor, daß der Kopf von vorn oder der Rumpf im Profil dargestellt wird.
Fast nie aber unternimmt es die frühe griechische Malerei, die Beine
von vorn zu zeichnen 2). Die Verkürzung der Füße, die dabei nicht zu
vermeiden ist, erfordert einen Sinn für Tiefe, der ihr fremd ist. Daher
tun, abgesehen von den ganz im Profil gegebenen Gestalten, alle Figuren
der früheren schwarzfigurigen Vasenmalerei dem Organismus durch un-
natürliche Wendungen Gewalt an. Diese Verdrehungen ergeben sich aus
dem Streben, die Figuren auf der Fläche zu zerlegen. Alles wird flächen-
haft gebildet. Kein Glied liegt außerhalb der Bildebene.
Ganz anders die Freiplastik. Der Bildhauer schafft von Anfang an
aus dem Vollen, Körperhaften. Er ist nicht wie der Maler an die Fläche
gebunden. Vor ihm steht der Block als geschlossene Masse, und indem
er die menschliche Gestalt herausholt, bleibt dem Gebilde etwas von dem
kubischen Volumen des Steins. Schon die frühesten griechischen Statuen 3)
stehen in voller Körperlichkeit da und atmen plastisches Leben, in
schärfstem Gegensatz zu den Gestalten der Malerei. Nirgends wird dem
Organismus durch unnatürliche Wendungen Gewalt angetan. Solche
Verdrehungen, wie die Malerei sie hebt, kommen in der Großplastik nur
bei dem Knielaufschema vor und erklären sich dort aus dem Einfluß der
Malerei. Ein ausgeprägtes Gefühl für körperliches Volumen spricht schon
aus den frühesten griechischen Statuen.
Wir verdanken E. Löwy*) wertvolle Aufschlüsse darüber, daß die
Plastik die Tiefe, die ihr der Block bot, anfangs nicht völlig auszunutzen
wußte und in der Anlage ihrer Gestalten merkwürdig flächenhaft blieb.
Er geht hier so weit, jeden Unterschied in der Formauffassung zwischen
1) Der Kürze haiber wird dies im foigertden 'kombinierte Ansicht' genannt.
2) Ausnahmen: einige hegende Gestatten, z. B. Gerhard, A.V. 108, 241;
Mon. d. hist, 1 51, bei denen die Füße von oben unverkürzt gegeben werden
können.
s) Vgt. z. B. die Weihgeschenke des Cheramyes und der Nikandre (Brunn-
Bruckmann Tat. 56 u. 57 a; Perrot-Chipiez VH! 146 u. 148, Abb. 79 u. 82;
Runstgesch. i. Biid.^ 200, 2 u. 201, 2) und die Werke der kretischen Biidhauer-
schule Ost. Jahresh. XU 1911, 243.
') Naturwiedergabe in der äiteren griechischen Kunst 29.
Gottfried v. Lücken
flächenhaf-ten Auffassung geopfert. Den Rumpf gibt man in der Regel
von vorn, Kopf und Beine im ProfiO). Was sich in der Tiefe darsteHt,
wird in der Breitenausdehnung gegeben. Hie und da kommt es auch
vor, daß der Kopf von vorn oder der Rumpf im Profil dargestellt wird.
Fast nie aber unternimmt es die frühe griechische Malerei, die Beine
von vorn zu zeichnen 2). Die Verkürzung der Füße, die dabei nicht zu
vermeiden ist, erfordert einen Sinn für Tiefe, der ihr fremd ist. Daher
tun, abgesehen von den ganz im Profil gegebenen Gestalten, alle Figuren
der früheren schwarzfigurigen Vasenmalerei dem Organismus durch un-
natürliche Wendungen Gewalt an. Diese Verdrehungen ergeben sich aus
dem Streben, die Figuren auf der Fläche zu zerlegen. Alles wird flächen-
haft gebildet. Kein Glied liegt außerhalb der Bildebene.
Ganz anders die Freiplastik. Der Bildhauer schafft von Anfang an
aus dem Vollen, Körperhaften. Er ist nicht wie der Maler an die Fläche
gebunden. Vor ihm steht der Block als geschlossene Masse, und indem
er die menschliche Gestalt herausholt, bleibt dem Gebilde etwas von dem
kubischen Volumen des Steins. Schon die frühesten griechischen Statuen 3)
stehen in voller Körperlichkeit da und atmen plastisches Leben, in
schärfstem Gegensatz zu den Gestalten der Malerei. Nirgends wird dem
Organismus durch unnatürliche Wendungen Gewalt angetan. Solche
Verdrehungen, wie die Malerei sie hebt, kommen in der Großplastik nur
bei dem Knielaufschema vor und erklären sich dort aus dem Einfluß der
Malerei. Ein ausgeprägtes Gefühl für körperliches Volumen spricht schon
aus den frühesten griechischen Statuen.
Wir verdanken E. Löwy*) wertvolle Aufschlüsse darüber, daß die
Plastik die Tiefe, die ihr der Block bot, anfangs nicht völlig auszunutzen
wußte und in der Anlage ihrer Gestalten merkwürdig flächenhaft blieb.
Er geht hier so weit, jeden Unterschied in der Formauffassung zwischen
1) Der Kürze haiber wird dies im foigertden 'kombinierte Ansicht' genannt.
2) Ausnahmen: einige hegende Gestatten, z. B. Gerhard, A.V. 108, 241;
Mon. d. hist, 1 51, bei denen die Füße von oben unverkürzt gegeben werden
können.
s) Vgt. z. B. die Weihgeschenke des Cheramyes und der Nikandre (Brunn-
Bruckmann Tat. 56 u. 57 a; Perrot-Chipiez VH! 146 u. 148, Abb. 79 u. 82;
Runstgesch. i. Biid.^ 200, 2 u. 201, 2) und die Werke der kretischen Biidhauer-
schule Ost. Jahresh. XU 1911, 243.
') Naturwiedergabe in der äiteren griechischen Kunst 29.