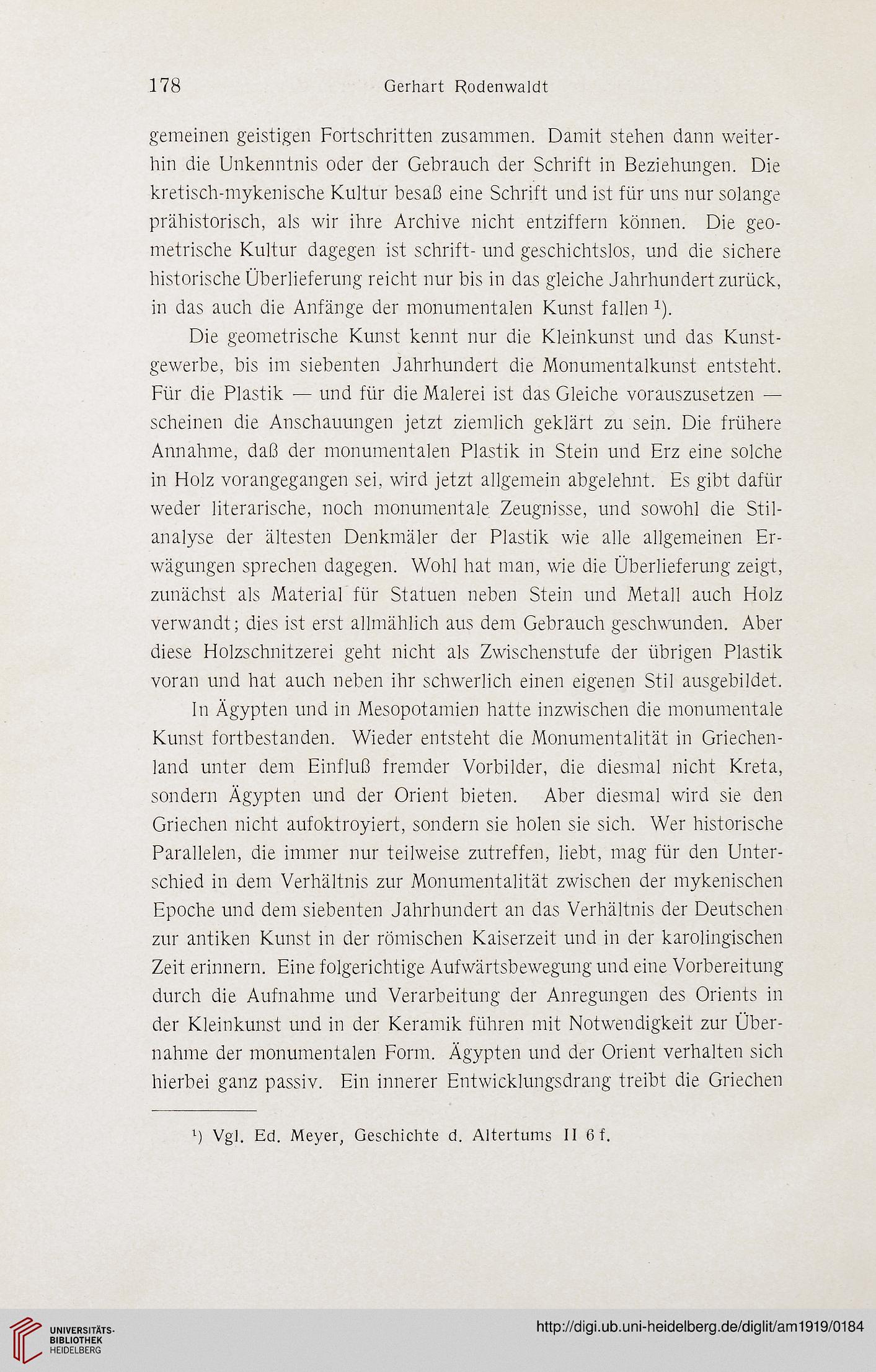178
Gerhart Rodenwaldt
gemeinen geistigen Fortschritten zusammen. Damit stehen dann weiter-
hin die Unkenntnis oder der Gebrauch der Schrift in Beziehungen. Die
kretisch-nrykenische Kultur besaß eine Schrift und ist für uns nur solange
prähistorisch, als wir ihre Archive nicht entziffern können. Die geo-
metrische Kultur dagegen ist schritt- und geschichtslos, und die sichere
historische Überlieferung reicht nur bis in das gleiche Jahrhundert zurück,
in das auch die Anfänge der monumentalen Kunst fallen i).
Die geometrische Kunst kennt nur die Kleinkunst und das Kunst-
gewerbe, bis im siebenten Jahrhundert die Monumentalkunst entsteht.
Für die Plastik — und für die Malerei ist das Gleiche vorauszusetzen —
scheinen die Anschauungen jetzt ziemlich geklärt zu sein. Die frühere
Annahme, daß der monumentalen Plastik in Stein und Erz eine solche
in Holz vorangegangen sei, wird jetzt allgemein abgelehnt. Es gibt dafür
weder literarische, noch monumentale Zeugnisse, und sowohl die Stil-
analyse der ältesten Denkmäler der Plastik wie alle allgemeinen Er-
wägungen sprechen dagegen. Wohl hat man, wie die Überlieferung zeigt,
zunächst als Material für Statuen neben Stein und Metall auch Holz
verwandt; dies ist erst allmählich aus dem Gebrauch geschwunden. Aber
diese Holzschnitzerei geht nicht als Zwischenstufe der übrigen Plastik
voran und hat auch neben ihr schwerlich einen eigenen Stil ausgebildet.
ln Ägypten und in Mesopotamien hatte inzwischen die monumentale
Kunst fortbestanden. Wieder entsteht die Monumentalität in Griechen-
land unter dem Einfluß fremder Vorbilder, die diesmal nicht Kreta,
sondern Ägypten und der Orient bieten. Aber diesmal wird sie den
Griechen nicht aufoktroyiert, sondern sie holen sie sich. Wer historische
Parallelen, die immer nur teilweise zutreffen, liebt, mag für den Unter-
schied in dem Verhältnis zur Monumentalität zwischen der mykenischen
Epoche und dem siebenten Jahrhundert an das Verhältnis der Deutschen
zur antiken Kunst in der römischen Kaiserzeit und in der karolingischen
Zeit erinnern. Eine folgerichtige Aufwärtsbewegung und eine Vorbereitung
durch die Aufnahme und Verarbeitung der Anregungen des Orients in
der Kleinkunst und in der Keramik führen mit Notwendigkeit zur Über-
nahme der monumentalen Form. Ägypten und der Orient verhalten sich
hierbei ganz passiv. Ein innerer Entwicklungsdrang treibt die Griechen
p Vgl. Ed. Meyer, Geschichte d, Altertums 11 6 f.
Gerhart Rodenwaldt
gemeinen geistigen Fortschritten zusammen. Damit stehen dann weiter-
hin die Unkenntnis oder der Gebrauch der Schrift in Beziehungen. Die
kretisch-nrykenische Kultur besaß eine Schrift und ist für uns nur solange
prähistorisch, als wir ihre Archive nicht entziffern können. Die geo-
metrische Kultur dagegen ist schritt- und geschichtslos, und die sichere
historische Überlieferung reicht nur bis in das gleiche Jahrhundert zurück,
in das auch die Anfänge der monumentalen Kunst fallen i).
Die geometrische Kunst kennt nur die Kleinkunst und das Kunst-
gewerbe, bis im siebenten Jahrhundert die Monumentalkunst entsteht.
Für die Plastik — und für die Malerei ist das Gleiche vorauszusetzen —
scheinen die Anschauungen jetzt ziemlich geklärt zu sein. Die frühere
Annahme, daß der monumentalen Plastik in Stein und Erz eine solche
in Holz vorangegangen sei, wird jetzt allgemein abgelehnt. Es gibt dafür
weder literarische, noch monumentale Zeugnisse, und sowohl die Stil-
analyse der ältesten Denkmäler der Plastik wie alle allgemeinen Er-
wägungen sprechen dagegen. Wohl hat man, wie die Überlieferung zeigt,
zunächst als Material für Statuen neben Stein und Metall auch Holz
verwandt; dies ist erst allmählich aus dem Gebrauch geschwunden. Aber
diese Holzschnitzerei geht nicht als Zwischenstufe der übrigen Plastik
voran und hat auch neben ihr schwerlich einen eigenen Stil ausgebildet.
ln Ägypten und in Mesopotamien hatte inzwischen die monumentale
Kunst fortbestanden. Wieder entsteht die Monumentalität in Griechen-
land unter dem Einfluß fremder Vorbilder, die diesmal nicht Kreta,
sondern Ägypten und der Orient bieten. Aber diesmal wird sie den
Griechen nicht aufoktroyiert, sondern sie holen sie sich. Wer historische
Parallelen, die immer nur teilweise zutreffen, liebt, mag für den Unter-
schied in dem Verhältnis zur Monumentalität zwischen der mykenischen
Epoche und dem siebenten Jahrhundert an das Verhältnis der Deutschen
zur antiken Kunst in der römischen Kaiserzeit und in der karolingischen
Zeit erinnern. Eine folgerichtige Aufwärtsbewegung und eine Vorbereitung
durch die Aufnahme und Verarbeitung der Anregungen des Orients in
der Kleinkunst und in der Keramik führen mit Notwendigkeit zur Über-
nahme der monumentalen Form. Ägypten und der Orient verhalten sich
hierbei ganz passiv. Ein innerer Entwicklungsdrang treibt die Griechen
p Vgl. Ed. Meyer, Geschichte d, Altertums 11 6 f.