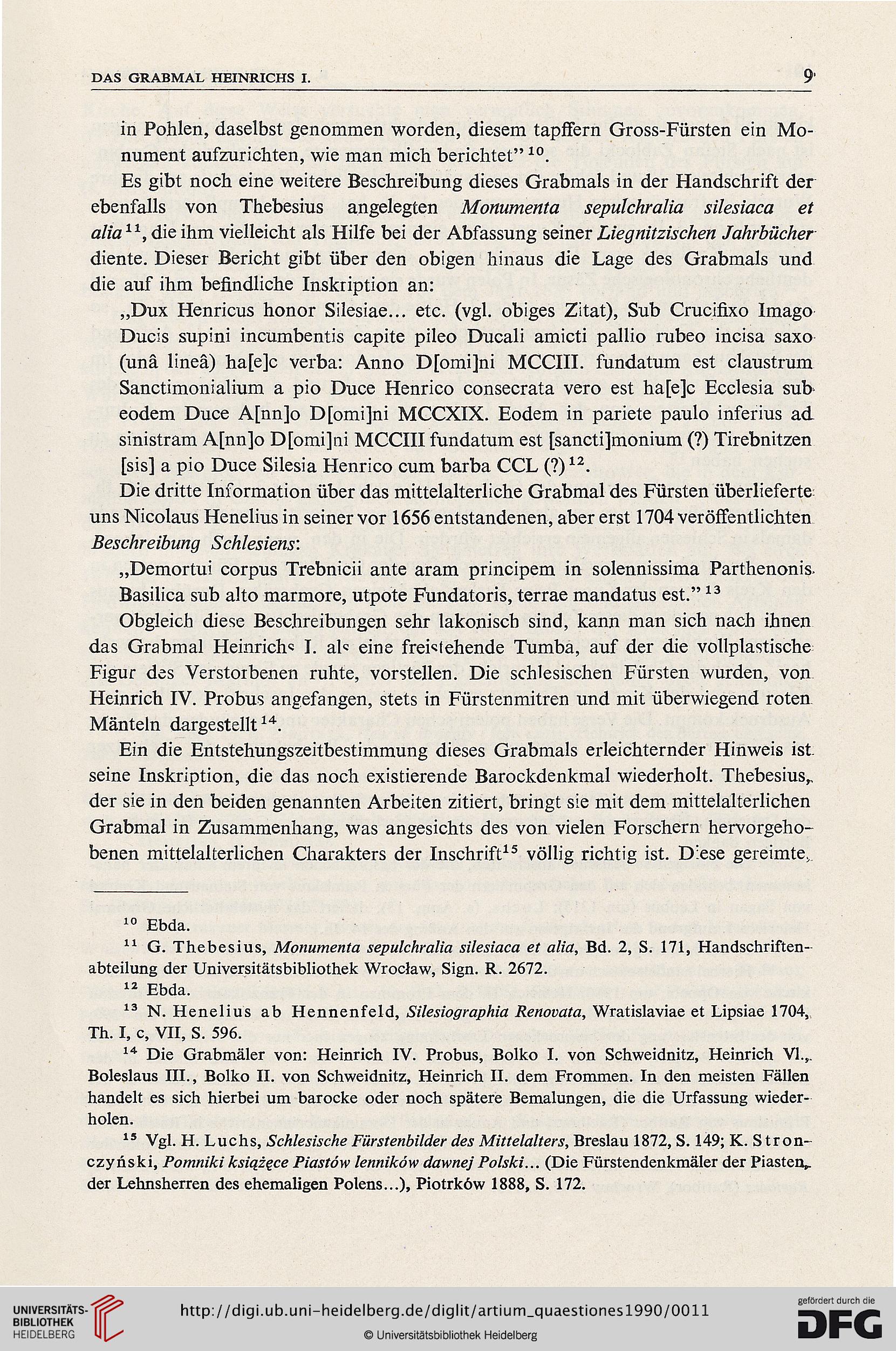DAS GRABMAL HEINRICHS I.
9
in Pohlen, daselbst genommen worden, diesem tapffern Gross-Fursten ein Mo-
nument aufzurichten, wie man mich berichtet” 10.
Es gibt noch eine weitere Beschreibung dieses Grabmals in der Handschrift der
ebenfałls von Thebesius angelegten Monumenta sepulchralia silesiaca et
alia 11, die ihm vielleicht als Hilfe bei der Abfassung seiner Liegnitzischen Jahrbiicher
diente. Dieser Bericht gibt iiber den obigen hinaus die Lage des Grabmals und
die auf ihm befindliche Inskription an:
„Dux Henricus honor Silesiae... etc. (vgl. obiges Zitat), Sub Crucifixo Imago
Ducis supini incumbentis capite pileo Ducali amicti pallio rubeo incisa saxo
(una linea) ha[e]c verba: Anno D[omi]ni MCCIII. fundatum est claustrum
Sanctimonialium a pio Duce Henrico consecrata vero est ha[e]c Ecclesia sub-
eodem Duce A[nn]o D[omi]ni MCCXIX. Eodem in pariete paulo inferius ad
sinistram A[nn]o D[omi]ni MCCIII fundatum est [sancti]monium (?) Tirebnitzen
[sis] a pio Duce Silesia Henrico cum barba CCL (?) 12.
Die dritte Information iiber das mittelalterliche Grabmal des Fiirsten uberlieferte
uns Nicolaus Henelius in seinervor 1656 entstandenen, aber erst 1704 veroffentlichten
Beschreibung Schlesiens:
„Demortui corpus Trebnicii ante aram principem in solennissima Parthenonis,
Basilica sub alto marmore, utpote Fundatoris, terrae mandatus est.” 13
Obgleich diese Beschreibungen sehr lakonisch sind, kann man sich nach ihnen
das Grabmal Heinrich« I. al« eine frehlehende Tumba, auf der die vollplastische
Figur des Yerstoibenen ruhte, vorstellen. Die schlesischen Fursten wurden, von
Heinrich IV. Probus angefangen, stets in Fiirstenmitren und mit iiberwiegend roten
Manteln dargestellt 14.
Ein die Entstehungszeitbestimmung dieses Grabmals erleichternder Hinweis ist
seine Inskription, die das noch existierende Barockdenkmal wiederholt. Thebesiusr
der sie in den beiden genannten Arbeiten zitiert, bringt sie mit dem mittelalterłichen
Grabmal in Zusammenhang, was angesichts des von vielen Forschern hervorgeho-
benen mittelalterlichen Charakters der Inschrift 13 vollig richtig ist. D ese gereimte,.
10 Ebda.
11 G. Thebesius, Monumenta sepulchralia silesiaca et alia, Bd. 2, S. 171, Handschriften-
abteilung der Universitatsbibliothek Wroclaw, Sign. R. 2672.
12 Ebda.
13 N. Henelius ab Hennenfeld, Silesiographia Renouata, Wratislaviae et Lipsiae 1704,
Th. I, c, VII, S. 596.
14 Die Grabmaler von: Heinrich IV. Probus, Bolko I. von Schweidnitz, Heinrich VI.,.
Boleslaus III., Bolko II. von Schweidnitz, Heinrich II. dem Frommen. In den meisten Fallen
handelt es sich hierbei um barocke oder noch spatere Bemalungen, die die Urfassung wieder-
holen.
15 Vgl. H. Luchs, Schlesische Fiirstenbilder des Mittelalters, Breslau 1872, S. 149; K. S tron-
czyński, Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski... (Die Fiirstendenkmaler der Piasten,
der Lehnsherren des ehemaligen Polens...), Piotrków 1888, S. 172.
9
in Pohlen, daselbst genommen worden, diesem tapffern Gross-Fursten ein Mo-
nument aufzurichten, wie man mich berichtet” 10.
Es gibt noch eine weitere Beschreibung dieses Grabmals in der Handschrift der
ebenfałls von Thebesius angelegten Monumenta sepulchralia silesiaca et
alia 11, die ihm vielleicht als Hilfe bei der Abfassung seiner Liegnitzischen Jahrbiicher
diente. Dieser Bericht gibt iiber den obigen hinaus die Lage des Grabmals und
die auf ihm befindliche Inskription an:
„Dux Henricus honor Silesiae... etc. (vgl. obiges Zitat), Sub Crucifixo Imago
Ducis supini incumbentis capite pileo Ducali amicti pallio rubeo incisa saxo
(una linea) ha[e]c verba: Anno D[omi]ni MCCIII. fundatum est claustrum
Sanctimonialium a pio Duce Henrico consecrata vero est ha[e]c Ecclesia sub-
eodem Duce A[nn]o D[omi]ni MCCXIX. Eodem in pariete paulo inferius ad
sinistram A[nn]o D[omi]ni MCCIII fundatum est [sancti]monium (?) Tirebnitzen
[sis] a pio Duce Silesia Henrico cum barba CCL (?) 12.
Die dritte Information iiber das mittelalterliche Grabmal des Fiirsten uberlieferte
uns Nicolaus Henelius in seinervor 1656 entstandenen, aber erst 1704 veroffentlichten
Beschreibung Schlesiens:
„Demortui corpus Trebnicii ante aram principem in solennissima Parthenonis,
Basilica sub alto marmore, utpote Fundatoris, terrae mandatus est.” 13
Obgleich diese Beschreibungen sehr lakonisch sind, kann man sich nach ihnen
das Grabmal Heinrich« I. al« eine frehlehende Tumba, auf der die vollplastische
Figur des Yerstoibenen ruhte, vorstellen. Die schlesischen Fursten wurden, von
Heinrich IV. Probus angefangen, stets in Fiirstenmitren und mit iiberwiegend roten
Manteln dargestellt 14.
Ein die Entstehungszeitbestimmung dieses Grabmals erleichternder Hinweis ist
seine Inskription, die das noch existierende Barockdenkmal wiederholt. Thebesiusr
der sie in den beiden genannten Arbeiten zitiert, bringt sie mit dem mittelalterłichen
Grabmal in Zusammenhang, was angesichts des von vielen Forschern hervorgeho-
benen mittelalterlichen Charakters der Inschrift 13 vollig richtig ist. D ese gereimte,.
10 Ebda.
11 G. Thebesius, Monumenta sepulchralia silesiaca et alia, Bd. 2, S. 171, Handschriften-
abteilung der Universitatsbibliothek Wroclaw, Sign. R. 2672.
12 Ebda.
13 N. Henelius ab Hennenfeld, Silesiographia Renouata, Wratislaviae et Lipsiae 1704,
Th. I, c, VII, S. 596.
14 Die Grabmaler von: Heinrich IV. Probus, Bolko I. von Schweidnitz, Heinrich VI.,.
Boleslaus III., Bolko II. von Schweidnitz, Heinrich II. dem Frommen. In den meisten Fallen
handelt es sich hierbei um barocke oder noch spatere Bemalungen, die die Urfassung wieder-
holen.
15 Vgl. H. Luchs, Schlesische Fiirstenbilder des Mittelalters, Breslau 1872, S. 149; K. S tron-
czyński, Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski... (Die Fiirstendenkmaler der Piasten,
der Lehnsherren des ehemaligen Polens...), Piotrków 1888, S. 172.