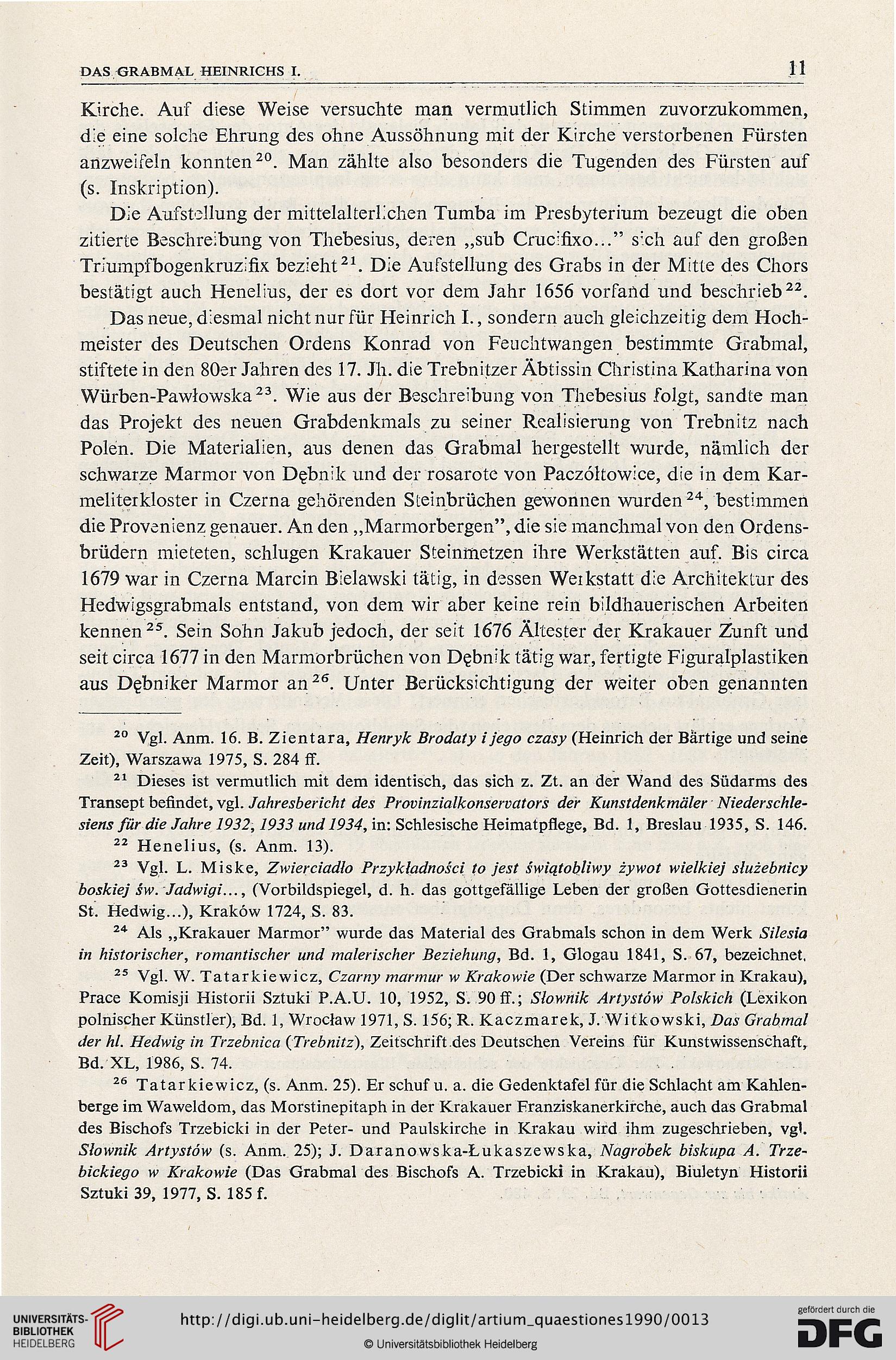DAS GRABMAL HEINRICHS I.
11
Kirche. Auf diese Weise versuchte man vermutlich Stimmen zuvorzukommen,
d'.e eine solche Ehrung des ohne Aussohnung mit der Kirche verstorbenen Fursten
anzweifeln konnten 20. Man zahlte also besonders die Tugenden des Fiirsten auf
(s. Inskription).
Die Aufstcllung der mittelalterlichen Tumba im Presbyterium bezeugt die oben
zitierte Beschreibung von Thebesius, deren „sub Cruc ;fixo...” s :ch auf den groBen
Triumpfbogenkruzilix bezieht 21. Die Aufstellung des Grabs in der Mitte des Chors
bestatigt auch Henelius, der es dort vor dem Jahr 1656 vorfaild und beschrieb 22.
Das neue, diesmal nicht nur fiir Heinrich I., sondern auch gleichzeitig dem Hoch-
meister des Deutschen Ordens Konrad von Feuchtwangen bestimmte Grabmal,
stiftete in den 80er Jahren des 17. Jh. die Trebnitzer Abtissin Cliristina Katharina von
Wiirben-Pawłowska 23. Wie aus der Beschreibung von Thebesius folgt, sandte man
das Projekt des neuen Grabdenkmals zu seiner Rcalisierung von Trebnitz nach
Polen. Die Materialien, aus denen das Grabmal hergestellt wurde, namlich der
schwarze Marrnor von Dębnik und der rosarote von Paczółtowice, die in dem Kar-
meliteikloster in Czerna gehorenden Steinbriichen gewonnen wurden 24, bestimmen
die Provenienz genauer. An den „Marmorbergen”, die sie manchmal von den Ordens-
briidern mieteten, schługen Krakauer Steinmetzen ihre Werkstatten auf. Bis circa
1679 war in Czerna Marcin Bielawski tatig, in dessen Weikstatt die Architektur des
Hedwigsgrabmals entstand, von dem wir aber keine rein bildhauerischen Arbeiten
kennen 25. Sein Sohn Jakub jedoch, der seit 1676 Altester der Krakauer Zunft und
seit circa 1677 in den Marmorbriichen von Dębnik tatig war, fertigte Figuralplastiken
aus Dębniker Marmor an 26. Unter Beriicksichtigung der weiter oben genannten
20 Vgl. Anm. 16. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy (Heinrich der Biirtigc und seine
Zeit), Warszawa 1975, S. 284 ff.
21 Dieses ist vermutlich mit dem identisch, das sich z. Zt. an der Wand des Siidarms des
Transept befindet, vgl. Jahresbericht des Provinzialkonservators der Kunstdenkmaler Niederschle-
siens fiir die Jahre 1932,1933 und 1934, in: Schlesische Heimatpflege, Bd. 1, Breslau 1935, S. 146.
22 Henelius, (s. Anm. 13).
23 Vgl. L. Miske, Zwierciadło Przykładności to jest świątobłiwy żywot wielkiej służebnicy
boskiej św. Jadwigi..., (Vorbildspiegel, d. h. das gottgefallige Leben der groflen Gottesdienerin
St. Hedwig...), Kraków 1724, S. 83.
24 Als „Krakauer Marmor” wurde das Material des Grabmals schon in dem Werk Silesia
in historischer, romantischer und małerischer Beziehung, Bd. 1, Glogau 1841, S. 67, bezeichnet.
25 Vgl. W. Tatarlciewicz, Czarny marmur w Krakowie (Der schwarze Marmor in Krakau),
Prace Komisji Historii Sztuki P.A.U. 10, 1952, S. 90 ff.; Słownik Artystów Połskich (Lexikon
polnischer Kiinstler), Bd. 1, Wrocław 1971, S. 156; R. Kaczmarek, J. Witkowski, Das Grabmał
der hl. Hedwig in Trzebnica {Trebnitz), Zeitschrift .des Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft,
Bd. XL, 1986, S. 74.
26 Tatarkiewicz, (s. Anm. 25). Er schuf u. a. die Gedenktafel fur die Schlacht am Kahlen-
berge im Waweldom, das Morstinepitaph in der Krakauer Franziskanerkirche, auch das Grabmal
des Bischofs Trzebicki in der Peter- und Paulskirche in Krakau wird ihm zugeschrieben, vgl.
Słownik Artystów (s. Anm. 25); J. Daranowska-Łukaszewska, Nagrobek biskupa A. Trze-
bickiego w Krakowie (Das Grabmal des Bischofs A. Trzebicki in Krakau), Biuletyn Historii
Sztuki 39, 1977, S. 185 f.
11
Kirche. Auf diese Weise versuchte man vermutlich Stimmen zuvorzukommen,
d'.e eine solche Ehrung des ohne Aussohnung mit der Kirche verstorbenen Fursten
anzweifeln konnten 20. Man zahlte also besonders die Tugenden des Fiirsten auf
(s. Inskription).
Die Aufstcllung der mittelalterlichen Tumba im Presbyterium bezeugt die oben
zitierte Beschreibung von Thebesius, deren „sub Cruc ;fixo...” s :ch auf den groBen
Triumpfbogenkruzilix bezieht 21. Die Aufstellung des Grabs in der Mitte des Chors
bestatigt auch Henelius, der es dort vor dem Jahr 1656 vorfaild und beschrieb 22.
Das neue, diesmal nicht nur fiir Heinrich I., sondern auch gleichzeitig dem Hoch-
meister des Deutschen Ordens Konrad von Feuchtwangen bestimmte Grabmal,
stiftete in den 80er Jahren des 17. Jh. die Trebnitzer Abtissin Cliristina Katharina von
Wiirben-Pawłowska 23. Wie aus der Beschreibung von Thebesius folgt, sandte man
das Projekt des neuen Grabdenkmals zu seiner Rcalisierung von Trebnitz nach
Polen. Die Materialien, aus denen das Grabmal hergestellt wurde, namlich der
schwarze Marrnor von Dębnik und der rosarote von Paczółtowice, die in dem Kar-
meliteikloster in Czerna gehorenden Steinbriichen gewonnen wurden 24, bestimmen
die Provenienz genauer. An den „Marmorbergen”, die sie manchmal von den Ordens-
briidern mieteten, schługen Krakauer Steinmetzen ihre Werkstatten auf. Bis circa
1679 war in Czerna Marcin Bielawski tatig, in dessen Weikstatt die Architektur des
Hedwigsgrabmals entstand, von dem wir aber keine rein bildhauerischen Arbeiten
kennen 25. Sein Sohn Jakub jedoch, der seit 1676 Altester der Krakauer Zunft und
seit circa 1677 in den Marmorbriichen von Dębnik tatig war, fertigte Figuralplastiken
aus Dębniker Marmor an 26. Unter Beriicksichtigung der weiter oben genannten
20 Vgl. Anm. 16. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy (Heinrich der Biirtigc und seine
Zeit), Warszawa 1975, S. 284 ff.
21 Dieses ist vermutlich mit dem identisch, das sich z. Zt. an der Wand des Siidarms des
Transept befindet, vgl. Jahresbericht des Provinzialkonservators der Kunstdenkmaler Niederschle-
siens fiir die Jahre 1932,1933 und 1934, in: Schlesische Heimatpflege, Bd. 1, Breslau 1935, S. 146.
22 Henelius, (s. Anm. 13).
23 Vgl. L. Miske, Zwierciadło Przykładności to jest świątobłiwy żywot wielkiej służebnicy
boskiej św. Jadwigi..., (Vorbildspiegel, d. h. das gottgefallige Leben der groflen Gottesdienerin
St. Hedwig...), Kraków 1724, S. 83.
24 Als „Krakauer Marmor” wurde das Material des Grabmals schon in dem Werk Silesia
in historischer, romantischer und małerischer Beziehung, Bd. 1, Glogau 1841, S. 67, bezeichnet.
25 Vgl. W. Tatarlciewicz, Czarny marmur w Krakowie (Der schwarze Marmor in Krakau),
Prace Komisji Historii Sztuki P.A.U. 10, 1952, S. 90 ff.; Słownik Artystów Połskich (Lexikon
polnischer Kiinstler), Bd. 1, Wrocław 1971, S. 156; R. Kaczmarek, J. Witkowski, Das Grabmał
der hl. Hedwig in Trzebnica {Trebnitz), Zeitschrift .des Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft,
Bd. XL, 1986, S. 74.
26 Tatarkiewicz, (s. Anm. 25). Er schuf u. a. die Gedenktafel fur die Schlacht am Kahlen-
berge im Waweldom, das Morstinepitaph in der Krakauer Franziskanerkirche, auch das Grabmal
des Bischofs Trzebicki in der Peter- und Paulskirche in Krakau wird ihm zugeschrieben, vgl.
Słownik Artystów (s. Anm. 25); J. Daranowska-Łukaszewska, Nagrobek biskupa A. Trze-
bickiego w Krakowie (Das Grabmal des Bischofs A. Trzebicki in Krakau), Biuletyn Historii
Sztuki 39, 1977, S. 185 f.