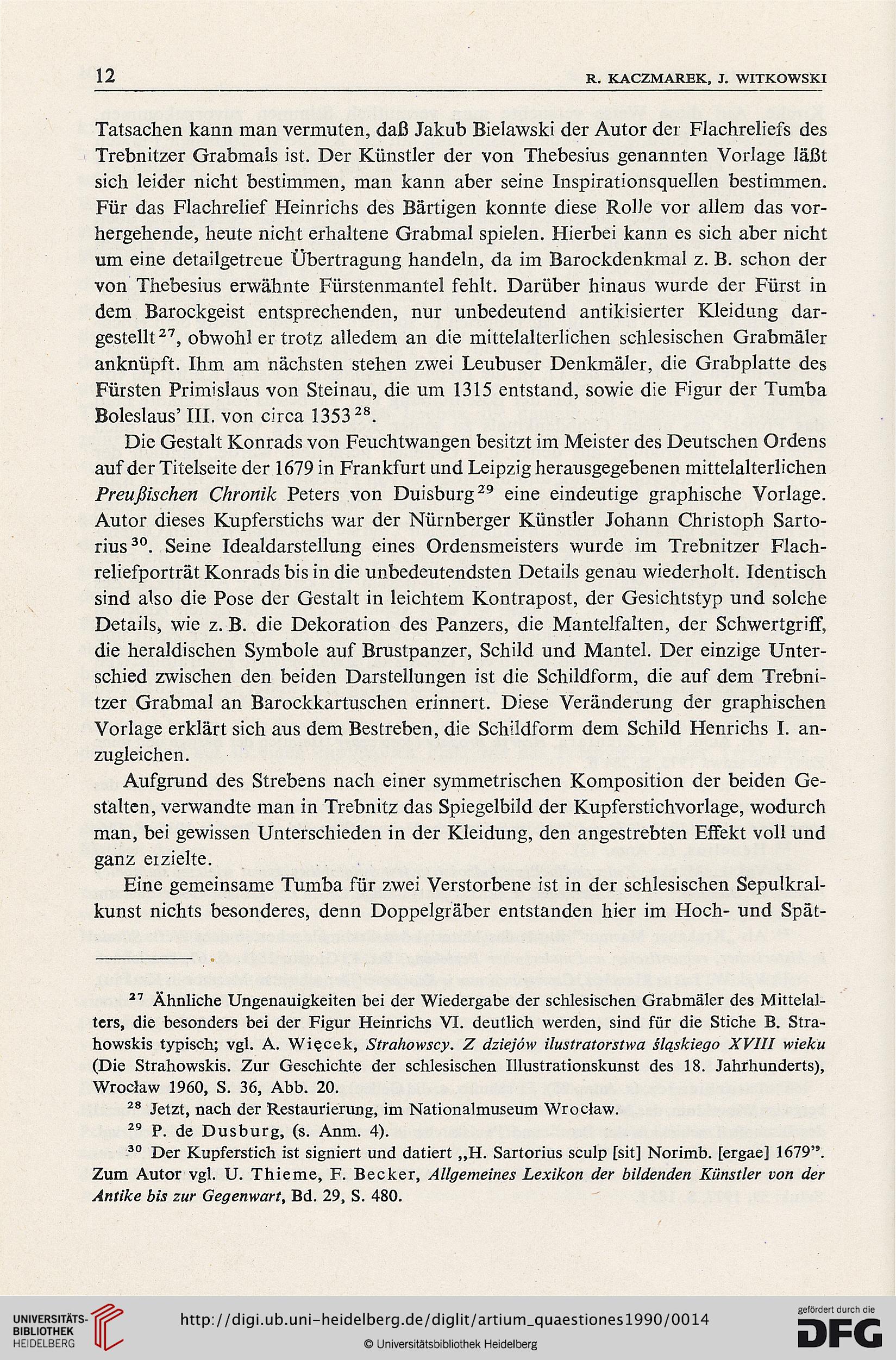12
R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI
Tatsachen kann man vermuten, da6 Jakub Bielawski der Autor der Flachreliefs des
Trebnitzer Grabmals ist. Der Kiinstler der von Thebesius genannten Vorlage laBt
sich leider nicht bestimmen, man kann aber seine Inspirationsąuellen bestimmen.
Fiir das Flachrelief Heinrichs des Bartigen konnte diese Rolle vor allem das vor-
hergehende, heute nicht erhaltene Grabmal spielen. Hierbei kann es sich aber nicht
um eine detailgetreue Ubertragung handeln, da im Barockdenkmal z. B. schon der
von Thebesius erwahnte Fiirstenmantel fehlt. Daruber hinaus wurde der Fiirst in
dem Barockgeist entsprechenden, nur unbedeutend antikisierter Kleidung dar-
gestellt 27, obwohl er trotz alledem an die mittelalterlichen schlesischen Grabmaler
anknupft. Ihm am nachsten stehen zwei Leubuser Denkmaler, die Grabplatte des
Fiirsten Primislaus von Steinau, die um 1315 entstand, sowie die Figur der Tumba
Boleslaus’ III. von circa 1353 28.
Die Gestalt Konrads von Feuchtwangen besitzt im Meister des Deutschen Ordens
auf der Titelseite der 1679 in Frankfurt und Leipzig herausgegebenen mittelalterlichen
Preufiischen Chronik Peters von Duisburg 29 eine eindeutige graphische Vorlage.
Autor dieses Kupferstichs war der Niirnberger Kiinstler Johann Christoph Sarto-
rius 30. Seine Idealdarstellung eines Ordensmeisters wurde im Trebnitzer Flach-
reliefportrat Konrads bis in die unbedeutendsten Details genau wiederholt. Identisch
sind also die Pose der Gestalt in leichtem Kontrapost, der Gesichtstyp und solche
Details, wie z. B. die Dekoration des Panzers, die Mantelfalten, der Schwertgriff.
die heraldischen Symbole auf Brustpanzer, Schild und Mantel. Der einzige Unter-
schied zwischen den beiden Darstellungen ist die Schildform, die auf dem Trebni-
tzer Grabmal an Barockkartuschen erinnert. Diese Veranderung der graphischen
Vorlage erklart sich aus dem Bestreben, die Schildform dem Schild Henrichs I. an-
zugleichen.
Aufgrund des Strebens nach einer symmetrischen Komposition der beiden Ge-
stalten, verwandte man in Trebnitz das Spiegelbild der Kupferstichvorlage, wodurch
man, bei gewissen Unterschieden in der Kleidung, den angestrebten Effekt voll und
ganz eizielte.
Eine gemeinsame Tumba fiir zwei Verstorbene ist in der schlesischen Sepulkral-
kunst nichts besonderes, denn Doppelgraber entstanden hier im Hoch- und Spat-
27 Ahnliche Ungenauigkeiten bei der Wiedergabe der schlesischen Grabmaler des Mittelal-
ters, die besonders bei der Figur Heinrichs VI. deutlich werden, sind fur die Stiche B. Stra-
howskis typisch; vgl. A. Więcek, Strahowscy. Z dziejów ilustratorstwa śląskiego XVIII wieku
(Die Strahowskis. Zur Geschichte der schlesischen Illustrationskunst des 18. Jahrhunderts),
Wroclaw 1960, S. 36, Abb. 20.
28 Jetzt, nach der Restaurierung, im Nationalmuseum Wroclaw.
29 P. de Dusburg, (s. Anm. 4).
30 Der Kupferstich ist signiert und datiert „H. Sartorius sculp [sit] Norimb. [ergae] 1679”.
Zum Autor vgl. U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der
Antike bis zur Gegenwart, Bd. 29, S. 480.
R. KACZMAREK, J. WITKOWSKI
Tatsachen kann man vermuten, da6 Jakub Bielawski der Autor der Flachreliefs des
Trebnitzer Grabmals ist. Der Kiinstler der von Thebesius genannten Vorlage laBt
sich leider nicht bestimmen, man kann aber seine Inspirationsąuellen bestimmen.
Fiir das Flachrelief Heinrichs des Bartigen konnte diese Rolle vor allem das vor-
hergehende, heute nicht erhaltene Grabmal spielen. Hierbei kann es sich aber nicht
um eine detailgetreue Ubertragung handeln, da im Barockdenkmal z. B. schon der
von Thebesius erwahnte Fiirstenmantel fehlt. Daruber hinaus wurde der Fiirst in
dem Barockgeist entsprechenden, nur unbedeutend antikisierter Kleidung dar-
gestellt 27, obwohl er trotz alledem an die mittelalterlichen schlesischen Grabmaler
anknupft. Ihm am nachsten stehen zwei Leubuser Denkmaler, die Grabplatte des
Fiirsten Primislaus von Steinau, die um 1315 entstand, sowie die Figur der Tumba
Boleslaus’ III. von circa 1353 28.
Die Gestalt Konrads von Feuchtwangen besitzt im Meister des Deutschen Ordens
auf der Titelseite der 1679 in Frankfurt und Leipzig herausgegebenen mittelalterlichen
Preufiischen Chronik Peters von Duisburg 29 eine eindeutige graphische Vorlage.
Autor dieses Kupferstichs war der Niirnberger Kiinstler Johann Christoph Sarto-
rius 30. Seine Idealdarstellung eines Ordensmeisters wurde im Trebnitzer Flach-
reliefportrat Konrads bis in die unbedeutendsten Details genau wiederholt. Identisch
sind also die Pose der Gestalt in leichtem Kontrapost, der Gesichtstyp und solche
Details, wie z. B. die Dekoration des Panzers, die Mantelfalten, der Schwertgriff.
die heraldischen Symbole auf Brustpanzer, Schild und Mantel. Der einzige Unter-
schied zwischen den beiden Darstellungen ist die Schildform, die auf dem Trebni-
tzer Grabmal an Barockkartuschen erinnert. Diese Veranderung der graphischen
Vorlage erklart sich aus dem Bestreben, die Schildform dem Schild Henrichs I. an-
zugleichen.
Aufgrund des Strebens nach einer symmetrischen Komposition der beiden Ge-
stalten, verwandte man in Trebnitz das Spiegelbild der Kupferstichvorlage, wodurch
man, bei gewissen Unterschieden in der Kleidung, den angestrebten Effekt voll und
ganz eizielte.
Eine gemeinsame Tumba fiir zwei Verstorbene ist in der schlesischen Sepulkral-
kunst nichts besonderes, denn Doppelgraber entstanden hier im Hoch- und Spat-
27 Ahnliche Ungenauigkeiten bei der Wiedergabe der schlesischen Grabmaler des Mittelal-
ters, die besonders bei der Figur Heinrichs VI. deutlich werden, sind fur die Stiche B. Stra-
howskis typisch; vgl. A. Więcek, Strahowscy. Z dziejów ilustratorstwa śląskiego XVIII wieku
(Die Strahowskis. Zur Geschichte der schlesischen Illustrationskunst des 18. Jahrhunderts),
Wroclaw 1960, S. 36, Abb. 20.
28 Jetzt, nach der Restaurierung, im Nationalmuseum Wroclaw.
29 P. de Dusburg, (s. Anm. 4).
30 Der Kupferstich ist signiert und datiert „H. Sartorius sculp [sit] Norimb. [ergae] 1679”.
Zum Autor vgl. U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von der
Antike bis zur Gegenwart, Bd. 29, S. 480.