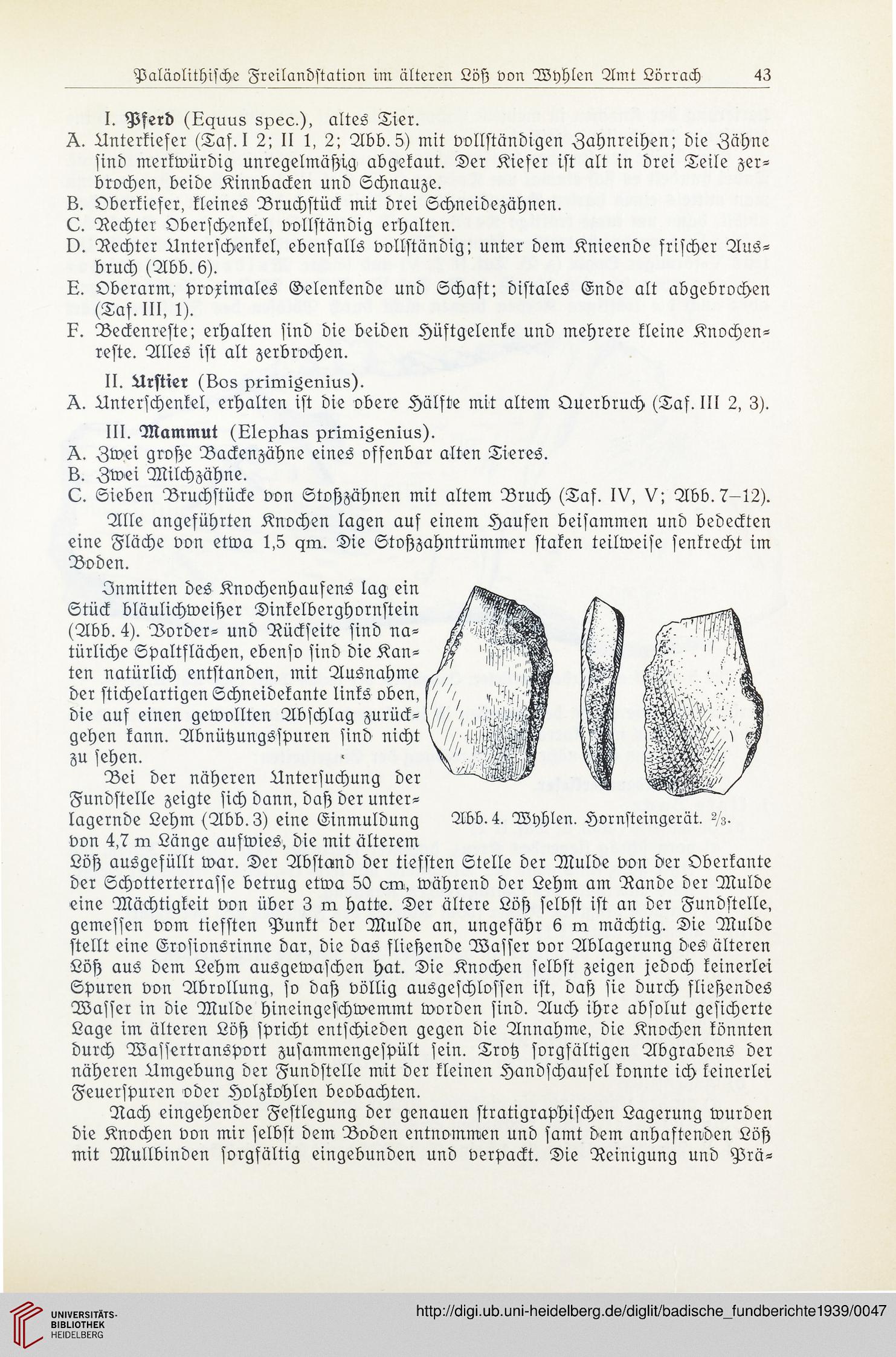Paläolithische Freilanöstation im älteren Löh von Wyhlen Amt Lörrach
43
I. Pferd (8Huus spec.), altes Tier.
Anterkiefer (Taf. I 2; II 1, 2; Abb. 5) mit vollständigen Zahnreihen; die Zähne
sind merkwürdig unregelmäßig abg-ekaut. Der Kiefer ist alt in drei Teile zer-
brochen, beide Kinnbacken und Schnauze.
8. Oberkiefer, kleines Bruchstück mit drei Schneidezähnen.
L. Rechter Oberschenkel, vollständig erhalten.
v. Rechter Anterschenkel, ebenfalls vollständig; unter dem Knieende frischer Aus-
bruch (Abb. 6).
8. Oberarm, proximales Gelenkende und Schaft; distales Ende alt abgebrochen
(Taf. III, 1).
8. Beckenreste; erhalten sind die beiden Hüftgelenke und mehrere kleine Knochen-
reste. Alles ist alt zerbrochen.
II. Arstier (8os prliniZenius).
A.. Unterschenkel, erhalten ist die obere Hälfte mit altem Querbruch (Taf. III 2, 3).
III. Mammut (Llepstas priiniZenlus).
A.. Zwei große Backenzähne eines offenbar alten Tieres.
8. Zwei Milchzähne.
S. Sieben Bruchstücke von Stoßzähnen mit altem Bruch (Taf. IV, V; Abb. 7-12).
Alle angeführten Knochen lagen auf einem Haufen beisammen und bedeckten
eine Fläche von etwa 1,5 qra. Die Stoßzahntrümmer staken teilweise senkrecht im
Boden.
Inmitten des Knochenhaufens lag ein
Stück bläulichweißer Dinkelberghornstein
(Abb. 4). Vorder- und Rückseite sind na¬
türliche Spaltflächen, ebenso sind die Kan¬
ten natürlich entstanden, mit Ausnahme
der stichelartigen Schneidekante links oben,
die auf einen gewollten Abschlag zurück¬
gehen kann. Abnützungsspuren sind nicht
zu sehen.
Bei der näheren Untersuchung der
Fundstelle zeigte sich dann, daß der unter¬
lagernde Lehm (Abb. 3) eine Einmuldung
von 4,7 ra Länge aufwies, die mit älterem
Löh ausgefüllt war. Der Abstand der tiefsten Stelle der Mulde von der Oberkante
der Schotterterrasse betrug etwa 50 ein, während der Lehm am Rande der Mulde
eine Mächtigkeit von über 3 in hatte. Der ältere Löh selbst ist an der Fundstelle,
gemessen vom tiessten Punkt der Mulde an, ungefähr 6 in mächtig. Die Mulde
stellt eine Crosionsrinne dar, die das fliehende Wasser vor Ablagerung des' älteren
Löß aus dem Lehm ausgewaschen hat. Die Knochen selbst zeigen jedoch keinerlei
Spuren von Abrollung, so daß völlig ausgeschlossen ist, daß sie durch fließendes
Wasser in die Mulde hineingeschwemmt worden sind. Auch ihre absolut gesicherte
Lage im älteren Löh spricht entschieden gegen die Annahme, die Knochen könnten
durch Wassertransport zusammengespült sein. Trotz sorgfältigen Abgrabens der
näheren Umgebung der Fundstelle mit der kleinen Handschaufel konnte ich keinerlei
Feuerspuren oder Holzkohlen beobachten.
Nach eingehender Festlegung der genauen stratigraphischen Lagerung wurden
die Knochen von mir selbst dem Boden entnommen und samt dem anhaftenden Löh
mit Mullbinden sorgfältig eingebunden und verpackt. Die Reinigung und Prä-
Abb. 4. Wyhlen. Hornsteingerät. 2/z.
43
I. Pferd (8Huus spec.), altes Tier.
Anterkiefer (Taf. I 2; II 1, 2; Abb. 5) mit vollständigen Zahnreihen; die Zähne
sind merkwürdig unregelmäßig abg-ekaut. Der Kiefer ist alt in drei Teile zer-
brochen, beide Kinnbacken und Schnauze.
8. Oberkiefer, kleines Bruchstück mit drei Schneidezähnen.
L. Rechter Oberschenkel, vollständig erhalten.
v. Rechter Anterschenkel, ebenfalls vollständig; unter dem Knieende frischer Aus-
bruch (Abb. 6).
8. Oberarm, proximales Gelenkende und Schaft; distales Ende alt abgebrochen
(Taf. III, 1).
8. Beckenreste; erhalten sind die beiden Hüftgelenke und mehrere kleine Knochen-
reste. Alles ist alt zerbrochen.
II. Arstier (8os prliniZenius).
A.. Unterschenkel, erhalten ist die obere Hälfte mit altem Querbruch (Taf. III 2, 3).
III. Mammut (Llepstas priiniZenlus).
A.. Zwei große Backenzähne eines offenbar alten Tieres.
8. Zwei Milchzähne.
S. Sieben Bruchstücke von Stoßzähnen mit altem Bruch (Taf. IV, V; Abb. 7-12).
Alle angeführten Knochen lagen auf einem Haufen beisammen und bedeckten
eine Fläche von etwa 1,5 qra. Die Stoßzahntrümmer staken teilweise senkrecht im
Boden.
Inmitten des Knochenhaufens lag ein
Stück bläulichweißer Dinkelberghornstein
(Abb. 4). Vorder- und Rückseite sind na¬
türliche Spaltflächen, ebenso sind die Kan¬
ten natürlich entstanden, mit Ausnahme
der stichelartigen Schneidekante links oben,
die auf einen gewollten Abschlag zurück¬
gehen kann. Abnützungsspuren sind nicht
zu sehen.
Bei der näheren Untersuchung der
Fundstelle zeigte sich dann, daß der unter¬
lagernde Lehm (Abb. 3) eine Einmuldung
von 4,7 ra Länge aufwies, die mit älterem
Löh ausgefüllt war. Der Abstand der tiefsten Stelle der Mulde von der Oberkante
der Schotterterrasse betrug etwa 50 ein, während der Lehm am Rande der Mulde
eine Mächtigkeit von über 3 in hatte. Der ältere Löh selbst ist an der Fundstelle,
gemessen vom tiessten Punkt der Mulde an, ungefähr 6 in mächtig. Die Mulde
stellt eine Crosionsrinne dar, die das fliehende Wasser vor Ablagerung des' älteren
Löß aus dem Lehm ausgewaschen hat. Die Knochen selbst zeigen jedoch keinerlei
Spuren von Abrollung, so daß völlig ausgeschlossen ist, daß sie durch fließendes
Wasser in die Mulde hineingeschwemmt worden sind. Auch ihre absolut gesicherte
Lage im älteren Löh spricht entschieden gegen die Annahme, die Knochen könnten
durch Wassertransport zusammengespült sein. Trotz sorgfältigen Abgrabens der
näheren Umgebung der Fundstelle mit der kleinen Handschaufel konnte ich keinerlei
Feuerspuren oder Holzkohlen beobachten.
Nach eingehender Festlegung der genauen stratigraphischen Lagerung wurden
die Knochen von mir selbst dem Boden entnommen und samt dem anhaftenden Löh
mit Mullbinden sorgfältig eingebunden und verpackt. Die Reinigung und Prä-
Abb. 4. Wyhlen. Hornsteingerät. 2/z.