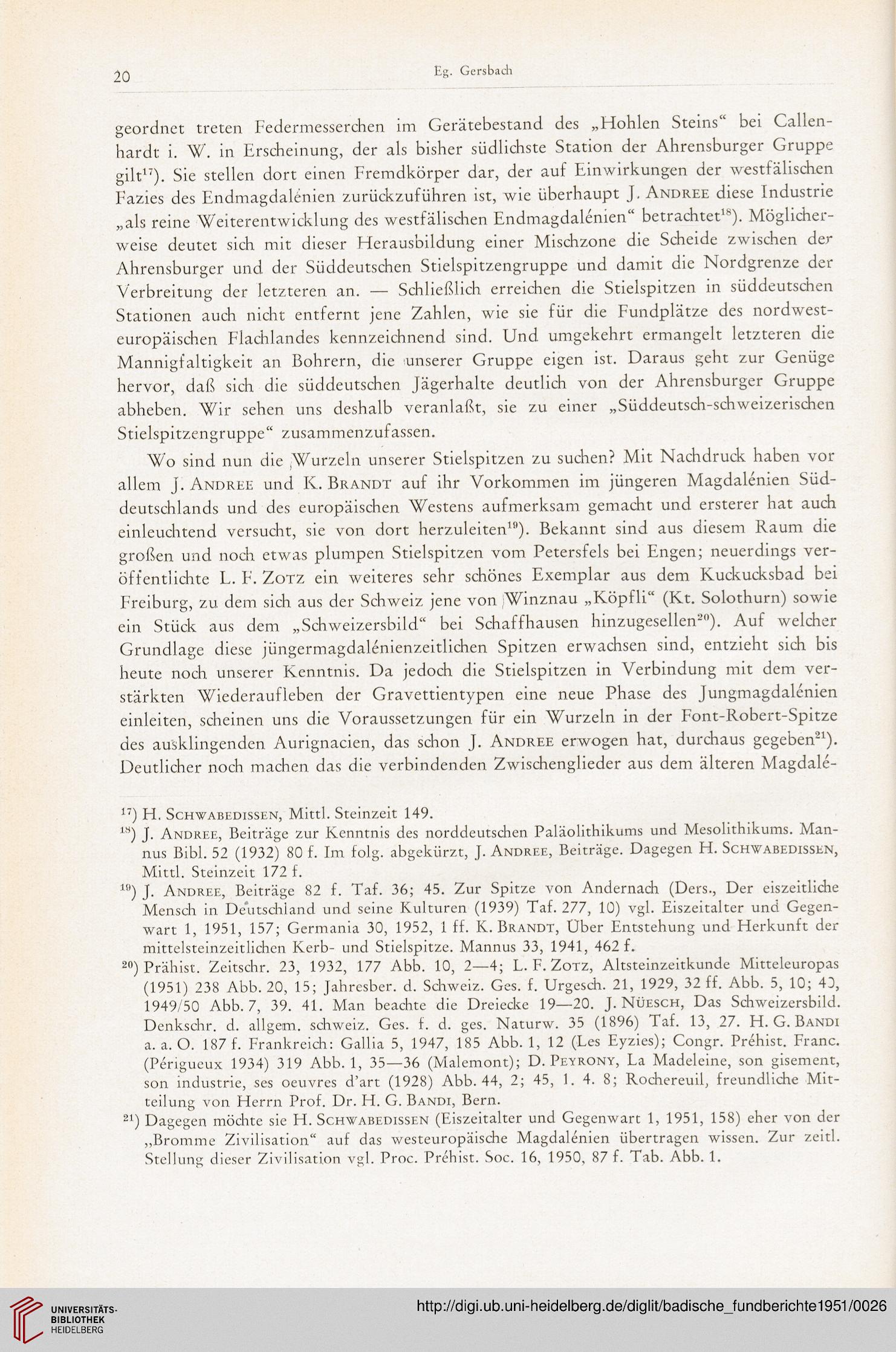20
Eg. Gersbach
geordnet treten Federmesserchen im Gerätebestand des „Hohlen Steins“ bei Callen-
hardt i. W. in Erscheinung, der als bisher südlichste Station der Ahrensburger Gruppe
gilt17). Sie stellen dort einen Fremdkörper dar, der auf Einwirkungen der westfälischen
Fazies des Endmagdalenien zurückzuführen ist, wie überhaupt J. Andree diese Industrie
„als reine Weiterentwicklung des westfälischen Endmagdalenien“ betrachtet18). Möglicher-
weise deutet sich mit dieser Herausbildung einer Mischzone die Scheide zwischen der
Ahrensburger und der Süddeutschen Stielspitzengruppe und damit die Nordgrenze der
Verbreitung der letzteren an. — Schließlich erreichen die Stielspitzen in süddeutschen
Stationen auch nicht entfernt jene Zahlen, wie sie für die Fundplätze des nordwest-
europäischen Flachlandes kennzeichnend sind. Und umgekehrt ermangelt letzteren die
Mannigfaltigkeit an Bohrern, die unserer Gruppe eigen ist. Daraus geht zur Genüge
hervor, daß sich die süddeutschen Jägerhalte deutlich von der Ahrensburger Gruppe
abheben. Wir sehen uns deshalb veranlaßt, sie zu einer „Süddeutsch-schweizerischen
Stielspitzengruppe“ zusammenzufassen.
Vo sind nun die Wurzeln unserer Stielspitzen zu suchen? Mit Nachdruck haben vor
allem J. Andree und K. Brandt auf ihr Vorkommen im jüngeren Magdalenien Süd-
deutschlands und des europäischen Westens aufmerksam gemacht und ersterer hat auch
einleuchtend versucht, sie von dort herzuleiten19). Bekannt sind aus diesem Raum die
großen und noch etwas plumpen Stielspitzen vom Petersfels bei Engen; neuerdings ver-
öffentlichte L. F. Zotz ein weiteres sehr schönes Exemplar aus dem Kuckucksbad bei
Freiburg, zu dem sich aus der Schweiz jene von iWinznau „Köpfli“ (Kt. Solothurn) sowie
ein Stück aus dem „Schweizersbild“ bei Schaffhausen hinzugesellen20). Auf welcher
Grundlage diese jüngermagdalenienzeitlichen Spitzen erwachsen sind, entzieht sich bis
heute noch unserer Kenntnis. Da jedoch die Stielspitzen in Verbindung mit dem ver-
stärkten Wiederaufleben der Gravettientypen eine neue Phase des Jungmagdalenien
einleiten, scheinen uns die Voraussetzungen für ein Wurzeln in der Font-Robert-Spitze
des ausklingenden Aurignacien, das schon J. Andree erwogen hat, durchaus gegeben21).
Deutlicher noch machen das die verbindenden Zwischenglieder aus dem älteren Magdale-
17) H. Schwabedissen, Mittl. Steinzeit 149.
ls) J. Andree, Beiträge zur Kenntnis des norddeutschen Paläolithikums und Mesolithikums. Man-
nus Bibi. 52 (1932) 80 f. Im folg, abgekürzt, J. Andree, Beiträge. Dagegen H. Schwabedissen,
Mittl. Steinzeit 172 f.
“) J. Andree, Beiträge 82 f. Taf. 36; 45. Zur Spitze von Andernach (Ders., Der eiszeitliche
Mensch in Deutschland und seine Kulturen (1939) Taf. 277, 10) vgl. Eiszeitalter und Gegen-
wart 1, 1951, 157; Germania 30, 1952, 1 ff. K. Brandt, Über Entstehung und Herkunft der
mittelsteinzeitlichen Kerb- und Stielspitze. Mannus 33, 1941, 462 f.
20) Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 177 Abb. 10, 2—4; L. F. Zotz, Altsteinzeitkunde Mitteleuropas
(1951) 238 Abb. 20, 15; Jahresber. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 ff. Abb. 5, 10; 40,
1949/50 Abb. 7, 39. 41. Man beachte die Dreiecke 19—20. J. Nüesch, Das Schweizersbild.
Denkschr. d. allgetn. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 35 (1896) Taf. 13, TI. H. G. Bandi
a. a. O. 187 f. Frankreich: Gallia 5, 1947, 185 Abb. 1, 12 (Les Eyzies); Congr. Prehist. Franc.
(Perigueux 1934) 319 Abb. 1, 35—36 (Malemont); D. Peyrony, La Madeleine, son gisement,
son industrie, ses Oeuvres d’art (1928) Abb. 44, 2; 45, 1. 4. 8; Rochereuil, freundliche Mit-
teilung von Herrn Prof. Dr. H. G. Bandi, Bern.
21) Dagegen möchte sie H. Schwabedissen (Eiszeitalter und Gegenwart 1, 1951, 158) eher von der
„Bromme Zivilisation“ auf das westeuropäische Magdalenien übertragen wissen. Zur zeitl.
Stellung dieser Zivilisation vgl. Proc. Prehist. Soc. 16, 1950, 87 f. Tab. Abb. 1.
Eg. Gersbach
geordnet treten Federmesserchen im Gerätebestand des „Hohlen Steins“ bei Callen-
hardt i. W. in Erscheinung, der als bisher südlichste Station der Ahrensburger Gruppe
gilt17). Sie stellen dort einen Fremdkörper dar, der auf Einwirkungen der westfälischen
Fazies des Endmagdalenien zurückzuführen ist, wie überhaupt J. Andree diese Industrie
„als reine Weiterentwicklung des westfälischen Endmagdalenien“ betrachtet18). Möglicher-
weise deutet sich mit dieser Herausbildung einer Mischzone die Scheide zwischen der
Ahrensburger und der Süddeutschen Stielspitzengruppe und damit die Nordgrenze der
Verbreitung der letzteren an. — Schließlich erreichen die Stielspitzen in süddeutschen
Stationen auch nicht entfernt jene Zahlen, wie sie für die Fundplätze des nordwest-
europäischen Flachlandes kennzeichnend sind. Und umgekehrt ermangelt letzteren die
Mannigfaltigkeit an Bohrern, die unserer Gruppe eigen ist. Daraus geht zur Genüge
hervor, daß sich die süddeutschen Jägerhalte deutlich von der Ahrensburger Gruppe
abheben. Wir sehen uns deshalb veranlaßt, sie zu einer „Süddeutsch-schweizerischen
Stielspitzengruppe“ zusammenzufassen.
Vo sind nun die Wurzeln unserer Stielspitzen zu suchen? Mit Nachdruck haben vor
allem J. Andree und K. Brandt auf ihr Vorkommen im jüngeren Magdalenien Süd-
deutschlands und des europäischen Westens aufmerksam gemacht und ersterer hat auch
einleuchtend versucht, sie von dort herzuleiten19). Bekannt sind aus diesem Raum die
großen und noch etwas plumpen Stielspitzen vom Petersfels bei Engen; neuerdings ver-
öffentlichte L. F. Zotz ein weiteres sehr schönes Exemplar aus dem Kuckucksbad bei
Freiburg, zu dem sich aus der Schweiz jene von iWinznau „Köpfli“ (Kt. Solothurn) sowie
ein Stück aus dem „Schweizersbild“ bei Schaffhausen hinzugesellen20). Auf welcher
Grundlage diese jüngermagdalenienzeitlichen Spitzen erwachsen sind, entzieht sich bis
heute noch unserer Kenntnis. Da jedoch die Stielspitzen in Verbindung mit dem ver-
stärkten Wiederaufleben der Gravettientypen eine neue Phase des Jungmagdalenien
einleiten, scheinen uns die Voraussetzungen für ein Wurzeln in der Font-Robert-Spitze
des ausklingenden Aurignacien, das schon J. Andree erwogen hat, durchaus gegeben21).
Deutlicher noch machen das die verbindenden Zwischenglieder aus dem älteren Magdale-
17) H. Schwabedissen, Mittl. Steinzeit 149.
ls) J. Andree, Beiträge zur Kenntnis des norddeutschen Paläolithikums und Mesolithikums. Man-
nus Bibi. 52 (1932) 80 f. Im folg, abgekürzt, J. Andree, Beiträge. Dagegen H. Schwabedissen,
Mittl. Steinzeit 172 f.
“) J. Andree, Beiträge 82 f. Taf. 36; 45. Zur Spitze von Andernach (Ders., Der eiszeitliche
Mensch in Deutschland und seine Kulturen (1939) Taf. 277, 10) vgl. Eiszeitalter und Gegen-
wart 1, 1951, 157; Germania 30, 1952, 1 ff. K. Brandt, Über Entstehung und Herkunft der
mittelsteinzeitlichen Kerb- und Stielspitze. Mannus 33, 1941, 462 f.
20) Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 177 Abb. 10, 2—4; L. F. Zotz, Altsteinzeitkunde Mitteleuropas
(1951) 238 Abb. 20, 15; Jahresber. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 ff. Abb. 5, 10; 40,
1949/50 Abb. 7, 39. 41. Man beachte die Dreiecke 19—20. J. Nüesch, Das Schweizersbild.
Denkschr. d. allgetn. Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 35 (1896) Taf. 13, TI. H. G. Bandi
a. a. O. 187 f. Frankreich: Gallia 5, 1947, 185 Abb. 1, 12 (Les Eyzies); Congr. Prehist. Franc.
(Perigueux 1934) 319 Abb. 1, 35—36 (Malemont); D. Peyrony, La Madeleine, son gisement,
son industrie, ses Oeuvres d’art (1928) Abb. 44, 2; 45, 1. 4. 8; Rochereuil, freundliche Mit-
teilung von Herrn Prof. Dr. H. G. Bandi, Bern.
21) Dagegen möchte sie H. Schwabedissen (Eiszeitalter und Gegenwart 1, 1951, 158) eher von der
„Bromme Zivilisation“ auf das westeuropäische Magdalenien übertragen wissen. Zur zeitl.
Stellung dieser Zivilisation vgl. Proc. Prehist. Soc. 16, 1950, 87 f. Tab. Abb. 1.