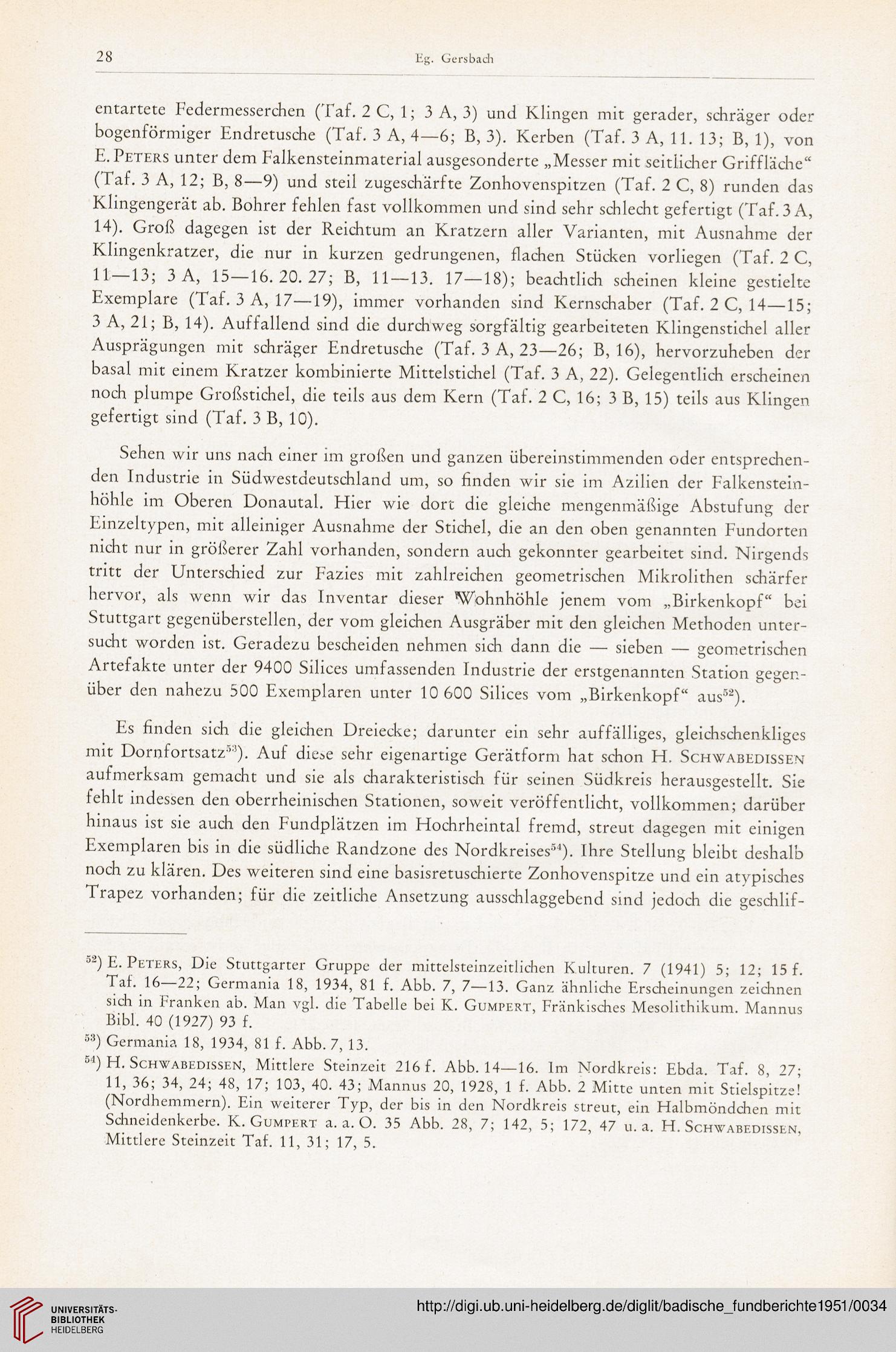28
Eg. Gersbach
entartete Federmesserchen (Taf. 2 C, 1; 3 A, 3) und Klingen mit gerader, schräger oder
bogenförmiger Endretusche (Taf. 3 A, 4—6; B, 3). Kerben (Taf. 3 A, 11. 13; B, 1), von
E. Peters unter dem Falkensteinmaterial ausgesonderte „Messer mit seitlicher Griff lache“
(Taf. 3 A, 12; B, 8—9) und steil zugeschärfte Zonhovenspitzen (Taf. 2 C, 8) runden das
Klingengerät ab. Bohrer fehlen fast vollkommen und sind sehr schlecht gefertigt (Taf. 3 A,
14). Groß dagegen ist der Reichtum an Kratzern aller Varianten, mit Ausnahme der
Klingenkratzer, die nur in kurzen gedrungenen, flachen Stücken vorliegen (Taf. 2 C,
11—13; 3 A, 15—16.20.27; B, 11—13. 17—18); beachtlich scheinen kleine gestielte
Exemplare (Taf. 3 A, 17—19), immer vorhanden sind Kernschaber (Taf. 2 C, 14—15;
3 A, 21; B, 14). Auffallend sind die durchweg sorgfältig gearbeiteten Klingenstichel aller
Ausprägungen mit schräger Endretusche (Taf. 3 A, 23—26; B, 16), hervorzuheben der
basal mit einem Kratzer kombinierte Mittelstichel (Taf. 3 A, 22). Gelegentlich erscheinen
noch plumpe Großstichel, die teils aus dem Kern (Taf. 2 C, 16; 3 B, 15) teils aus Klingen
gefertigt sind (Taf. 3 B, 10).
Sehen wir uns nach einer im großen und ganzen übereinstimmenden oder entsprechen-
den Industrie in Südwestdeutschland um, so finden wir sie im Azilien der Falkenstein-
höhle im Oberen Donautal. Hier wie dort die gleiche mengenmäßige Abstufung der
Einzeltypen, mit alleiniger Ausnahme der Stichel, die an den oben genannten Fundorten
nicht nur in größerer Zahl vorhanden, sondern auch gekonnter gearbeitet sind. Nirgends
tritt der Unterschied zur Fazies mit zahlreichen geometrischen Mikrolithen schärfer
hervor, als wenn wir das Inventar dieser Wohnhöhle jenem vom „Birkenkopf“ bei
Stuttgart gegenüberstellen, der vom gleichen Ausgräber mit den gleichen Methoden unter-
sucht worden ist. Geradezu bescheiden nehmen sich dann die — sieben — geometrischen
Artefakte unter der 9400 Silices umfassenden Industrie der erstgenannten Station gegen-
über den nahezu 500 Exemplaren unter 10 600 Silices vom „Birkenkopf“ aus52).
Es finden sich die gleichen Dreiecke; darunter ein sehr auffälliges, gleichschenkliges
mit Dornfortsatz53). Auf diese sehr eigenartige Gerätform hat schon H. Schwabedissen
aufmerksam gemacht und sie als charakteristisch für seinen Südkreis herausgestellt. Sie
fehlt indessen den oberrheinischen Stationen, soweit veröffentlicht, vollkommen; darüber
hinaus ist sie auch den Fundplätzen im Hochrheintal fremd, streut dagegen mit einigen
Exemplaren bis in die südliche Randzone des Nordkreises54). Ihre Stellung bleibt deshalb
noch zu klären. Des weiteren sind eine basisretuschierte Zonhovenspitze und ein atypisches
Trapez vorhanden; für die zeitliche Ansetzung ausschlaggebend sind jedoch die geschlif-
52) E. Peters, Die Stuttgarter Gruppe der mittelsteinzeitlichen Kulturen. 7 (1941) 5; 12; 15 f.
Taf. 16—22; Germania 18, 1934, 81 f. Abb. 7, 7—13. Ganz ähnliche Erscheinungen zeichnen
sich in Franken ab. Man vgl. die Tabelle bei K. Gumpert, Fränkisches Mesolithikum. Mannus
Bibi. 40 (1927) 93 f.
53) Germania 18, 1934, 81 f. Abb. 7, 13.
51) H. Schwabedissen, Mittlere Steinzeit 216 f. Abb. 14—16. Im Nordkreis: Ebda. Taf. 8, 27;
11, 36; 34, 24; 48, 17; 103, 40. 43; Mannus 20, 1928, 1 f. Abb. 2 Mitte unten mit Stielspitze!
(Nordhemmern). Ein weiterer Typ, der bis in den Nordkreis streut, ein Halbmöndchen mit
Schneidenkerbe. K. Gumpert a. a. O. 35 Abb. 28, 7; 142, 5; 172, 47 u. a. H. Schwabedissen,
Mittlere Steinzeit Taf. 11, 31; 17, 5.
Eg. Gersbach
entartete Federmesserchen (Taf. 2 C, 1; 3 A, 3) und Klingen mit gerader, schräger oder
bogenförmiger Endretusche (Taf. 3 A, 4—6; B, 3). Kerben (Taf. 3 A, 11. 13; B, 1), von
E. Peters unter dem Falkensteinmaterial ausgesonderte „Messer mit seitlicher Griff lache“
(Taf. 3 A, 12; B, 8—9) und steil zugeschärfte Zonhovenspitzen (Taf. 2 C, 8) runden das
Klingengerät ab. Bohrer fehlen fast vollkommen und sind sehr schlecht gefertigt (Taf. 3 A,
14). Groß dagegen ist der Reichtum an Kratzern aller Varianten, mit Ausnahme der
Klingenkratzer, die nur in kurzen gedrungenen, flachen Stücken vorliegen (Taf. 2 C,
11—13; 3 A, 15—16.20.27; B, 11—13. 17—18); beachtlich scheinen kleine gestielte
Exemplare (Taf. 3 A, 17—19), immer vorhanden sind Kernschaber (Taf. 2 C, 14—15;
3 A, 21; B, 14). Auffallend sind die durchweg sorgfältig gearbeiteten Klingenstichel aller
Ausprägungen mit schräger Endretusche (Taf. 3 A, 23—26; B, 16), hervorzuheben der
basal mit einem Kratzer kombinierte Mittelstichel (Taf. 3 A, 22). Gelegentlich erscheinen
noch plumpe Großstichel, die teils aus dem Kern (Taf. 2 C, 16; 3 B, 15) teils aus Klingen
gefertigt sind (Taf. 3 B, 10).
Sehen wir uns nach einer im großen und ganzen übereinstimmenden oder entsprechen-
den Industrie in Südwestdeutschland um, so finden wir sie im Azilien der Falkenstein-
höhle im Oberen Donautal. Hier wie dort die gleiche mengenmäßige Abstufung der
Einzeltypen, mit alleiniger Ausnahme der Stichel, die an den oben genannten Fundorten
nicht nur in größerer Zahl vorhanden, sondern auch gekonnter gearbeitet sind. Nirgends
tritt der Unterschied zur Fazies mit zahlreichen geometrischen Mikrolithen schärfer
hervor, als wenn wir das Inventar dieser Wohnhöhle jenem vom „Birkenkopf“ bei
Stuttgart gegenüberstellen, der vom gleichen Ausgräber mit den gleichen Methoden unter-
sucht worden ist. Geradezu bescheiden nehmen sich dann die — sieben — geometrischen
Artefakte unter der 9400 Silices umfassenden Industrie der erstgenannten Station gegen-
über den nahezu 500 Exemplaren unter 10 600 Silices vom „Birkenkopf“ aus52).
Es finden sich die gleichen Dreiecke; darunter ein sehr auffälliges, gleichschenkliges
mit Dornfortsatz53). Auf diese sehr eigenartige Gerätform hat schon H. Schwabedissen
aufmerksam gemacht und sie als charakteristisch für seinen Südkreis herausgestellt. Sie
fehlt indessen den oberrheinischen Stationen, soweit veröffentlicht, vollkommen; darüber
hinaus ist sie auch den Fundplätzen im Hochrheintal fremd, streut dagegen mit einigen
Exemplaren bis in die südliche Randzone des Nordkreises54). Ihre Stellung bleibt deshalb
noch zu klären. Des weiteren sind eine basisretuschierte Zonhovenspitze und ein atypisches
Trapez vorhanden; für die zeitliche Ansetzung ausschlaggebend sind jedoch die geschlif-
52) E. Peters, Die Stuttgarter Gruppe der mittelsteinzeitlichen Kulturen. 7 (1941) 5; 12; 15 f.
Taf. 16—22; Germania 18, 1934, 81 f. Abb. 7, 7—13. Ganz ähnliche Erscheinungen zeichnen
sich in Franken ab. Man vgl. die Tabelle bei K. Gumpert, Fränkisches Mesolithikum. Mannus
Bibi. 40 (1927) 93 f.
53) Germania 18, 1934, 81 f. Abb. 7, 13.
51) H. Schwabedissen, Mittlere Steinzeit 216 f. Abb. 14—16. Im Nordkreis: Ebda. Taf. 8, 27;
11, 36; 34, 24; 48, 17; 103, 40. 43; Mannus 20, 1928, 1 f. Abb. 2 Mitte unten mit Stielspitze!
(Nordhemmern). Ein weiterer Typ, der bis in den Nordkreis streut, ein Halbmöndchen mit
Schneidenkerbe. K. Gumpert a. a. O. 35 Abb. 28, 7; 142, 5; 172, 47 u. a. H. Schwabedissen,
Mittlere Steinzeit Taf. 11, 31; 17, 5.