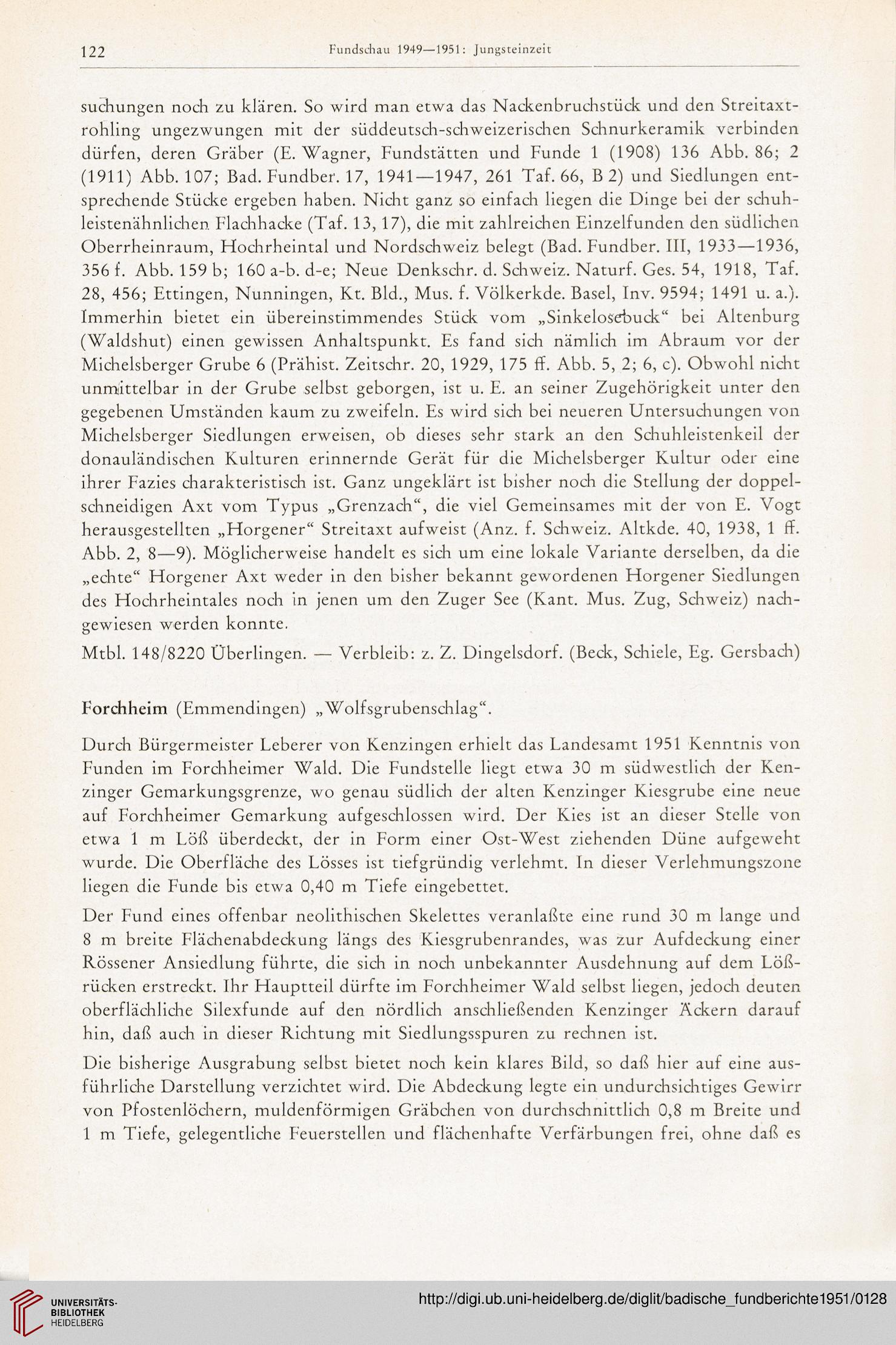122
Fundschau 1949—1951: Jungsteinzeit
suchungen noch zu klären. So wird man etwa das Nackenbruchstück und den Streitaxt-
rohling ungezwungen mit der süddeutsch-schweizerischen Schnurkeramik verbinden
dürfen, deren Gräber (E. Wagner, Fundstätten und Funde 1 (1908) 136 Abb. 86; 2
(1911) Abb. 107; Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 261 Taf. 66, B 2) und Siedlungen ent-
sprechende Stücke ergeben haben. Nicht ganz so einfach liegen die Dinge bei der schuh-
leistenähnlichen Flachhacke (Taf. 13, 17), die mit zahlreichen Einzelfunden den südlichen
Oberrheinraum, Hochrheintal und Nordschweiz belegt (Bad. Fundber. III, 1933—1936,
356 f. Abb. 159 b; 160 a-b. d-e; Neue Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. 54, 1918, Taf.
28, 456; Ettingen, Nünningen, Kt. Bld., Mus. f. Völkerkde. Basel, Inv. 9594; 1491 u. a.).
Immerhin bietet ein übereinstimmendes Stück vom „Sinkelosebuck“ bei Altenburg
(Waldshut) einen gewissen Anhaltspunkt. Es fand sich nämlich im Abraum vor der
Michelsberger Grube 6 (Prähist. Zeitschr. 20, 1929, 175 ff. Abb. 5, 2; 6, c). Obwohl nicht
unmittelbar in der Grube selbst geborgen, ist u. E. an seiner Zugehörigkeit unter den
gegebenen Umständen kaum zu zweifeln. Es wird sich bei neueren Untersuchungen von
Michelsberger Siedlungen erweisen, ob dieses sehr stark an den Schuhleistenkeil der
donauländischen Kulturen erinnernde Gerät für die Michelsberger Kultur oder eine
ihrer Fazies charakteristisch ist. Ganz ungeklärt ist bisher noch die Stellung der doppel-
schneidigen Axt vom Typus „Grenzach“, die viel Gemeinsames mit der von E. Vogt
herausgestellten „Horgener“ Streitaxt aufweist (Anz. f. Schweiz. Altkde. 40, 1938, 1 ff.
Abb. 2, 8—9). Möglicherweise handelt es sich um eine lokale Variante derselben, da die
„echte“ Horgener Axt weder in den bisher bekannt gewordenen Horgener Siedlungen
des Hochrheintales noch in jenen um den Zuger See (Kant. Mus. Zug, Schweiz) nach-
gewiesen werden konnte.
Mtbl. 148/8220 Überlingen. — Verbleib: z. Z. Dingelsdorf. (Beck, Schiele, Eg. Gersbach)
Forchheim (Emmendingen) „Wolfsgrubenschlag“.
Durch Bürgermeister Leberer von Kenzingen erhielt das Landesamt 1951 Kenntnis von
Funden im Forchheimer Wald. Die Fundstelle liegt etwa 30 m südwestlich der Ken-
zinger Gemarkungsgrenze, wo genau südlich der alten Kenzinger Kiesgrube eine neue
auf Forchheimer Gemarkung aufgeschlossen wird. Der Kies ist an dieser Stelle von
etwa 1 m Löß überdeckt, der in Form einer Ost-West ziehenden Düne auf geweht
wurde. Die Oberfläche des Lösses ist tiefgründig verlehmt. In dieser Verlehmungszone
liegen die Funde bis etwa 0,40 m Tiefe eingebettet.
Der Fund eines offenbar neolithischen Skelettes veranlaßte eine rund 30 m lange und
8 m breite Flächenabdeckung längs des Kiesgrubenrandes, was zur Aufdeckung einer
Rössener Ansiedlung führte, die sich in noch unbekannter Ausdehnung auf dem Löß-
rücken erstreckt. Ihr Hauptteil dürfte im Forchheimer Wald selbst liegen, jedoch deuten
oberflächliche Silexfunde auf den nördlich anschließenden Kenzinger Äckern darauf
hin, daß auch in dieser Richtung mit Siedlungsspuren zu rechnen ist.
Die bisherige Ausgrabung selbst bietet noch kein klares Bild, so daß hier auf eine aus-
führliche Darstellung verzichtet wird. Die Abdeckung legte ein undurchsichtiges Gewirr
von Pfostenlöchern, muldenförmigen Gräbchen von durchschnittlich 0,8 m Breite und
1 m Tiefe, gelegentliche Feuerstellen und flächenhafte Verfärbungen frei, ohne daß es
Fundschau 1949—1951: Jungsteinzeit
suchungen noch zu klären. So wird man etwa das Nackenbruchstück und den Streitaxt-
rohling ungezwungen mit der süddeutsch-schweizerischen Schnurkeramik verbinden
dürfen, deren Gräber (E. Wagner, Fundstätten und Funde 1 (1908) 136 Abb. 86; 2
(1911) Abb. 107; Bad. Fundber. 17, 1941—1947, 261 Taf. 66, B 2) und Siedlungen ent-
sprechende Stücke ergeben haben. Nicht ganz so einfach liegen die Dinge bei der schuh-
leistenähnlichen Flachhacke (Taf. 13, 17), die mit zahlreichen Einzelfunden den südlichen
Oberrheinraum, Hochrheintal und Nordschweiz belegt (Bad. Fundber. III, 1933—1936,
356 f. Abb. 159 b; 160 a-b. d-e; Neue Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. 54, 1918, Taf.
28, 456; Ettingen, Nünningen, Kt. Bld., Mus. f. Völkerkde. Basel, Inv. 9594; 1491 u. a.).
Immerhin bietet ein übereinstimmendes Stück vom „Sinkelosebuck“ bei Altenburg
(Waldshut) einen gewissen Anhaltspunkt. Es fand sich nämlich im Abraum vor der
Michelsberger Grube 6 (Prähist. Zeitschr. 20, 1929, 175 ff. Abb. 5, 2; 6, c). Obwohl nicht
unmittelbar in der Grube selbst geborgen, ist u. E. an seiner Zugehörigkeit unter den
gegebenen Umständen kaum zu zweifeln. Es wird sich bei neueren Untersuchungen von
Michelsberger Siedlungen erweisen, ob dieses sehr stark an den Schuhleistenkeil der
donauländischen Kulturen erinnernde Gerät für die Michelsberger Kultur oder eine
ihrer Fazies charakteristisch ist. Ganz ungeklärt ist bisher noch die Stellung der doppel-
schneidigen Axt vom Typus „Grenzach“, die viel Gemeinsames mit der von E. Vogt
herausgestellten „Horgener“ Streitaxt aufweist (Anz. f. Schweiz. Altkde. 40, 1938, 1 ff.
Abb. 2, 8—9). Möglicherweise handelt es sich um eine lokale Variante derselben, da die
„echte“ Horgener Axt weder in den bisher bekannt gewordenen Horgener Siedlungen
des Hochrheintales noch in jenen um den Zuger See (Kant. Mus. Zug, Schweiz) nach-
gewiesen werden konnte.
Mtbl. 148/8220 Überlingen. — Verbleib: z. Z. Dingelsdorf. (Beck, Schiele, Eg. Gersbach)
Forchheim (Emmendingen) „Wolfsgrubenschlag“.
Durch Bürgermeister Leberer von Kenzingen erhielt das Landesamt 1951 Kenntnis von
Funden im Forchheimer Wald. Die Fundstelle liegt etwa 30 m südwestlich der Ken-
zinger Gemarkungsgrenze, wo genau südlich der alten Kenzinger Kiesgrube eine neue
auf Forchheimer Gemarkung aufgeschlossen wird. Der Kies ist an dieser Stelle von
etwa 1 m Löß überdeckt, der in Form einer Ost-West ziehenden Düne auf geweht
wurde. Die Oberfläche des Lösses ist tiefgründig verlehmt. In dieser Verlehmungszone
liegen die Funde bis etwa 0,40 m Tiefe eingebettet.
Der Fund eines offenbar neolithischen Skelettes veranlaßte eine rund 30 m lange und
8 m breite Flächenabdeckung längs des Kiesgrubenrandes, was zur Aufdeckung einer
Rössener Ansiedlung führte, die sich in noch unbekannter Ausdehnung auf dem Löß-
rücken erstreckt. Ihr Hauptteil dürfte im Forchheimer Wald selbst liegen, jedoch deuten
oberflächliche Silexfunde auf den nördlich anschließenden Kenzinger Äckern darauf
hin, daß auch in dieser Richtung mit Siedlungsspuren zu rechnen ist.
Die bisherige Ausgrabung selbst bietet noch kein klares Bild, so daß hier auf eine aus-
führliche Darstellung verzichtet wird. Die Abdeckung legte ein undurchsichtiges Gewirr
von Pfostenlöchern, muldenförmigen Gräbchen von durchschnittlich 0,8 m Breite und
1 m Tiefe, gelegentliche Feuerstellen und flächenhafte Verfärbungen frei, ohne daß es