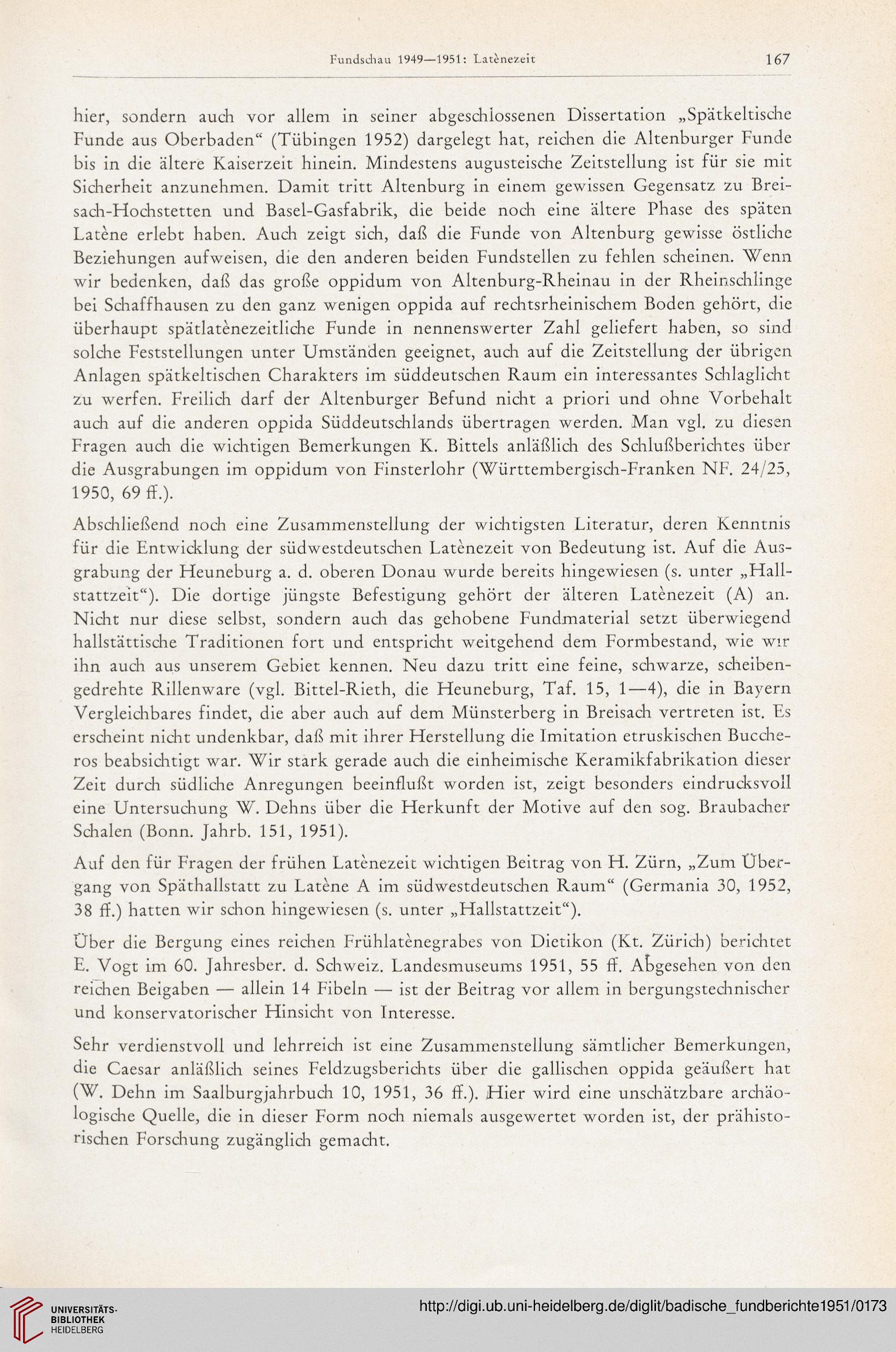Fundschau 1949—1951: Latenezeit
167
hier, sondern auch vor allem in seiner abgeschlossenen Dissertation „Spätkeltische
Funde aus Oberbaden“ (Tübingen 1952) dargelegt hat, reichen die Altenburger Funde
bis in die ältere Kaiserzeit hinein. Mindestens augusteische Zeitstellung ist für sie mit
Sicherheit anzunehmen. Damit tritt Altenburg in einem gewissen Gegensatz zu Brei-
sach-Hochstetten und Basel-Gasfabrik, die beide noch eine ältere Phase des späten
Latene erlebt haben. Auch zeigt sich, daß die Funde von Altenburg gewisse östliche
Beziehungen auf weisen, die den anderen beiden Fundstellen zu fehlen scheinen. "Wenn
wir bedenken, daß das große oppidum von Altenburg-Rheinau in der Rheinschlinge
bei Schaffhausen zu den ganz wenigen oppida auf rechtsrheinischem Boden gehört, die
überhaupt spätlatenezeitliche Funde in nennenswerter Zahl geliefert haben, so sind
solche Feststellungen unter Umständen geeignet, auch auf die Zeitstellung der übrigen
Anlagen spätkeltischen Charakters im süddeutschen Raum ein interessantes Schlaglicht
zu werfen. Freilich darf der Altenburger Befund nicht a priori und ohne Vorbehalt
auch auf die anderen oppida Süddeutschlands übertragen werden. Man vgl. zu diesen
Fragen auch die wichtigen Bemerkungen K. Bitteis anläßlich des Schlußberichtes über
die Ausgrabungen im oppidum von Finsterlohr (Württembergisch-Franken NF. 24/25,
1950, 69 ff.).
Abschließend noch eine Zusammenstellung der wichtigsten Literatur, deren Kenntnis
für die Entwicklung der südwestdeutschen Latenezeit von Bedeutung ist. Auf die Aus-
grabung der Heuneburg a. d. oberen Donau wurde bereits hingewiesen (s. unter „Hall-
stattzeit“). Die dortige jüngste Befestigung gehört der älteren Latenezeit (A) an.
Nicht nur diese selbst, sondern auch das gehobene Fundmaterial setzt überwiegend
hallstättische Traditionen fort und entspricht weitgehend dem Formbestand, wie wir
ihn auch aus unserem Gebiet kennen. Neu dazu tritt eine feine, schwarze, scheiben-
gedrehte Rillenware (vgl. Bittel-Rieth, die Heuneburg, Taf. 15, 1—4), die in Bayern
Vergleichbares findet, die aber auch auf dem Münsterberg in Breisach vertreten ist. Es
erscheint nicht undenkbar, daß mit ihrer Herstellung die Imitation etruskischen Bucche-
ros beabsichtigt war. Wir stark gerade auch die einheimische Keramikfabrikation dieser
Zeit durch südliche Anregungen beeinflußt worden ist, zeigt besonders eindrucksvoll
eine Untersuchung W. Dehns über die Herkunft der Motive auf den sog. Braubacher
Schalen (Bonn. Jahrb. 151, 1951).
Auf den für Fragen der frühen Latenezeit wichtigen Beitrag von H. Zürn, „Zum Über-
gang von Späthallstatt zu Latene A im südwestdeutschen Raum“ (Germania 30, 1952,
38 ff.) hatten wir schon hingewiesen (s. unter „Hallstattzeit“).
Über die Bergung eines reichen Frühlatenegrabes von Dietikon (Kt. Zürich) berichtet
E. Vogt im 60. Jahresber. d. Schweiz. Landesmuseums 1951, 55 ff. Abgesehen von den
reichen Beigaben — allein 14 Fibeln — ist der Beitrag vor allem in bergungstechnischer
und konservatorischer Hinsicht von Interesse.
Sehr verdienstvoll und lehrreich ist eine Zusammenstellung sämtlicher Bemerkungen,
die Caesar anläßlich seines Feldzugsberichts über die gallischen oppida geäußert hat
(W. Dehn im Saalburgjahrbuch 10, 1951, 36 ff.). Hier wird eine unschätzbare archäo-
logische Quelle, die in dieser Form noch niemals ausgewertet worden ist, der prähisto-
rischen Forschung zugänglich gemacht.
167
hier, sondern auch vor allem in seiner abgeschlossenen Dissertation „Spätkeltische
Funde aus Oberbaden“ (Tübingen 1952) dargelegt hat, reichen die Altenburger Funde
bis in die ältere Kaiserzeit hinein. Mindestens augusteische Zeitstellung ist für sie mit
Sicherheit anzunehmen. Damit tritt Altenburg in einem gewissen Gegensatz zu Brei-
sach-Hochstetten und Basel-Gasfabrik, die beide noch eine ältere Phase des späten
Latene erlebt haben. Auch zeigt sich, daß die Funde von Altenburg gewisse östliche
Beziehungen auf weisen, die den anderen beiden Fundstellen zu fehlen scheinen. "Wenn
wir bedenken, daß das große oppidum von Altenburg-Rheinau in der Rheinschlinge
bei Schaffhausen zu den ganz wenigen oppida auf rechtsrheinischem Boden gehört, die
überhaupt spätlatenezeitliche Funde in nennenswerter Zahl geliefert haben, so sind
solche Feststellungen unter Umständen geeignet, auch auf die Zeitstellung der übrigen
Anlagen spätkeltischen Charakters im süddeutschen Raum ein interessantes Schlaglicht
zu werfen. Freilich darf der Altenburger Befund nicht a priori und ohne Vorbehalt
auch auf die anderen oppida Süddeutschlands übertragen werden. Man vgl. zu diesen
Fragen auch die wichtigen Bemerkungen K. Bitteis anläßlich des Schlußberichtes über
die Ausgrabungen im oppidum von Finsterlohr (Württembergisch-Franken NF. 24/25,
1950, 69 ff.).
Abschließend noch eine Zusammenstellung der wichtigsten Literatur, deren Kenntnis
für die Entwicklung der südwestdeutschen Latenezeit von Bedeutung ist. Auf die Aus-
grabung der Heuneburg a. d. oberen Donau wurde bereits hingewiesen (s. unter „Hall-
stattzeit“). Die dortige jüngste Befestigung gehört der älteren Latenezeit (A) an.
Nicht nur diese selbst, sondern auch das gehobene Fundmaterial setzt überwiegend
hallstättische Traditionen fort und entspricht weitgehend dem Formbestand, wie wir
ihn auch aus unserem Gebiet kennen. Neu dazu tritt eine feine, schwarze, scheiben-
gedrehte Rillenware (vgl. Bittel-Rieth, die Heuneburg, Taf. 15, 1—4), die in Bayern
Vergleichbares findet, die aber auch auf dem Münsterberg in Breisach vertreten ist. Es
erscheint nicht undenkbar, daß mit ihrer Herstellung die Imitation etruskischen Bucche-
ros beabsichtigt war. Wir stark gerade auch die einheimische Keramikfabrikation dieser
Zeit durch südliche Anregungen beeinflußt worden ist, zeigt besonders eindrucksvoll
eine Untersuchung W. Dehns über die Herkunft der Motive auf den sog. Braubacher
Schalen (Bonn. Jahrb. 151, 1951).
Auf den für Fragen der frühen Latenezeit wichtigen Beitrag von H. Zürn, „Zum Über-
gang von Späthallstatt zu Latene A im südwestdeutschen Raum“ (Germania 30, 1952,
38 ff.) hatten wir schon hingewiesen (s. unter „Hallstattzeit“).
Über die Bergung eines reichen Frühlatenegrabes von Dietikon (Kt. Zürich) berichtet
E. Vogt im 60. Jahresber. d. Schweiz. Landesmuseums 1951, 55 ff. Abgesehen von den
reichen Beigaben — allein 14 Fibeln — ist der Beitrag vor allem in bergungstechnischer
und konservatorischer Hinsicht von Interesse.
Sehr verdienstvoll und lehrreich ist eine Zusammenstellung sämtlicher Bemerkungen,
die Caesar anläßlich seines Feldzugsberichts über die gallischen oppida geäußert hat
(W. Dehn im Saalburgjahrbuch 10, 1951, 36 ff.). Hier wird eine unschätzbare archäo-
logische Quelle, die in dieser Form noch niemals ausgewertet worden ist, der prähisto-
rischen Forschung zugänglich gemacht.