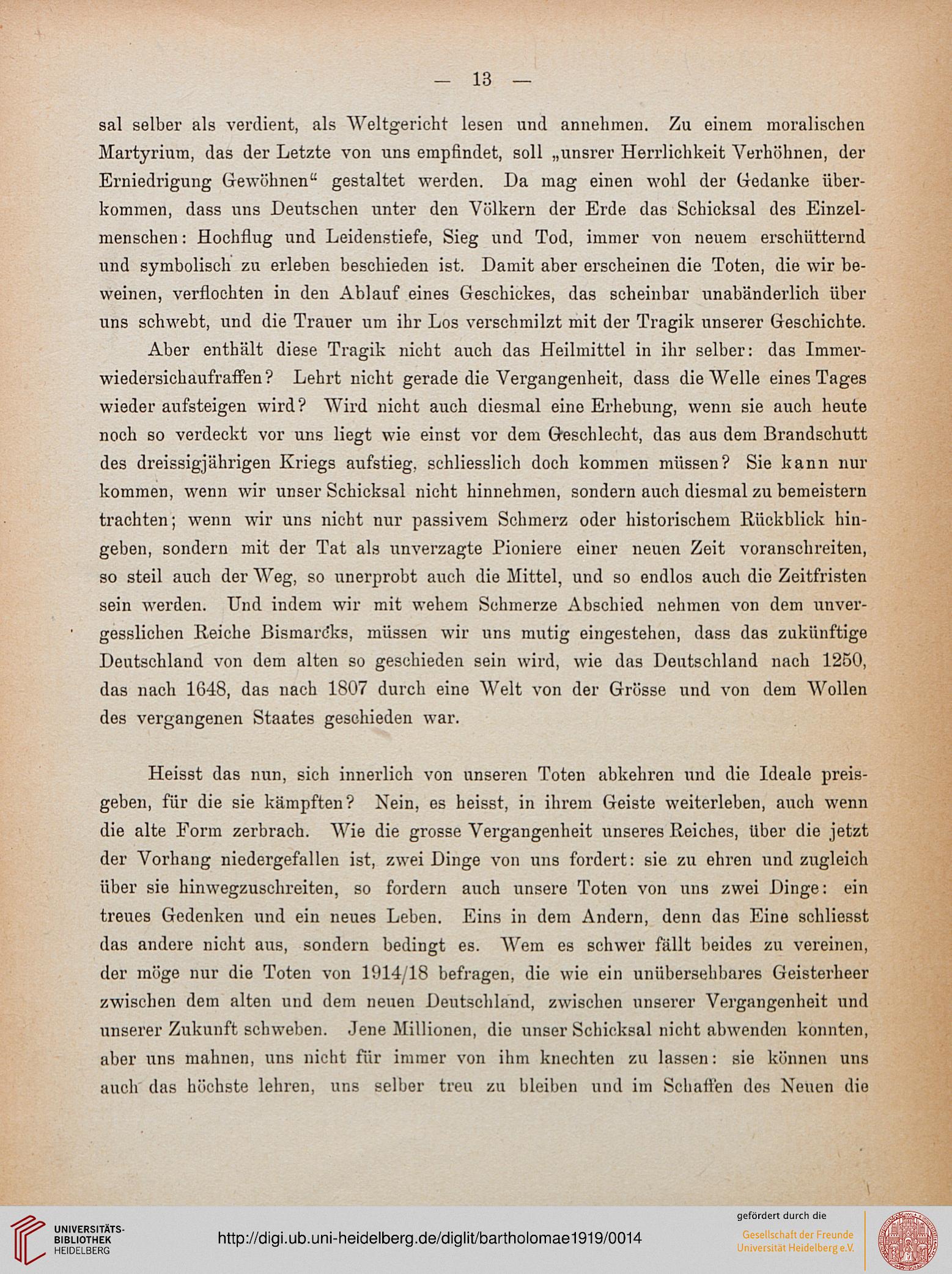- 13 —
sal selber als verdient, als Weltgericht lesen und annehmen. Zu einem moralischen
Martyrium, das der Letzte von uns empfindet, soll „unsrer Herrlichkeit Verhöhnen, der
Erniedrigung Gewöhnen" gestaltet werden. Da mag einen wohl der Gedanke über-
kommen, dass uns Deutschen unter den Völkern der Erde das Schicksal des Einzel-
menschen : Hochflug und Leidenstiefe, Sieg und Tod, immer von neuem erschütternd
und symbolisch zu erleben beschieden ist. Damit aber erscheinen die Toten, die wir be-
weinen, verflochten in den Ablauf eines Geschickes, das scheinbar unabänderlich über
uns schwebt, und die Trauer um ihr Los verschmilzt mit der Tragik unserer Geschichte.
Aber enthält diese Tragik nicht auch das Heilmittel in ihr selber: das Immer-
wiedersichaufraffen? Lehrt nicht gerade die Vergangenheit, dass die Welle eines Tages
wieder aufsteigen wird? Wird nicht auch diesmal eine Erhebung, wenn sie auch heute
noch so verdeckt vor uns liegt wie einst vor dem Geschlecht, das aus dem Brandschutt
des dreissigjährigen Kriegs aufstieg, schliesslich doch kommen müssen? Sie kann um-
kommen, wenn wir unser Schicksal nicht hinnehmen, sondern auch diesmal zu bemeistern
trachten; wenn wir uns nicht nur passivem Schmerz oder historischem Rückblick hin-
geben, sondern mit der Tat als unverzagte Pioniere einer neuen Zeit voranschreiten,
so steil auch der Weg, so unerprobt auch die Mittel, und so endlos auch die Zeitfristen
sein werden. Und indem wir mit wehem Schmerze Abschied nehmen von dem unver-
gesslichen Reiche Bismarcks, müssen wir uns mutig eingestehen, dass das zukünftige
Deutschland von dem alten so geschieden sein wird, wie das Deutschland nach 1250,
das nach 1648, das nach 1807 durch eine Welt von der Grösse und von dem Wollen
des vergangenen Staates geschieden war.
Heisst das nun, sich innerlich von unseren Toten abkehren und die Ideale preis-
geben, für die sie kämpften? Nein, es heisst, in ihrem Geiste weiterleben, auch wenn
die alte Form zerbrach. Wie die grosse Vergangenheit unseres Reiches, über die jetzt
der Vorhang niedergefallen ist, zwei Dinge von uns fordert: sie zu ehren und zugleich
über sie hinwegzuschreiten, so fordern auch unsere Toten von uns zwei Dinge: ein
treues Gedenken und ein neues Leben. Eins in dem Andern, denn das Eine schliesst
das andere nicht aus, sondern bedingt es. Wem es schwer fällt beides zu vereinen,
der möge nur die Toten von 1914/18 befragen, die wie ein unübersehbares Geisterheer
zwischen dem alten und dem neuen Deutschland, zwischen unserer Vergangenheit und
unserer Zukunft schweben. Jene Millionen, die unser Schicksal nicht abwenden konnten,
aber uns mahnen, uns nicht für immer von ihm knechten zu lassen: sie können uns
auch das höchste lehren, uns selber treu zu bleiben und im Schäften des Neuen die
sal selber als verdient, als Weltgericht lesen und annehmen. Zu einem moralischen
Martyrium, das der Letzte von uns empfindet, soll „unsrer Herrlichkeit Verhöhnen, der
Erniedrigung Gewöhnen" gestaltet werden. Da mag einen wohl der Gedanke über-
kommen, dass uns Deutschen unter den Völkern der Erde das Schicksal des Einzel-
menschen : Hochflug und Leidenstiefe, Sieg und Tod, immer von neuem erschütternd
und symbolisch zu erleben beschieden ist. Damit aber erscheinen die Toten, die wir be-
weinen, verflochten in den Ablauf eines Geschickes, das scheinbar unabänderlich über
uns schwebt, und die Trauer um ihr Los verschmilzt mit der Tragik unserer Geschichte.
Aber enthält diese Tragik nicht auch das Heilmittel in ihr selber: das Immer-
wiedersichaufraffen? Lehrt nicht gerade die Vergangenheit, dass die Welle eines Tages
wieder aufsteigen wird? Wird nicht auch diesmal eine Erhebung, wenn sie auch heute
noch so verdeckt vor uns liegt wie einst vor dem Geschlecht, das aus dem Brandschutt
des dreissigjährigen Kriegs aufstieg, schliesslich doch kommen müssen? Sie kann um-
kommen, wenn wir unser Schicksal nicht hinnehmen, sondern auch diesmal zu bemeistern
trachten; wenn wir uns nicht nur passivem Schmerz oder historischem Rückblick hin-
geben, sondern mit der Tat als unverzagte Pioniere einer neuen Zeit voranschreiten,
so steil auch der Weg, so unerprobt auch die Mittel, und so endlos auch die Zeitfristen
sein werden. Und indem wir mit wehem Schmerze Abschied nehmen von dem unver-
gesslichen Reiche Bismarcks, müssen wir uns mutig eingestehen, dass das zukünftige
Deutschland von dem alten so geschieden sein wird, wie das Deutschland nach 1250,
das nach 1648, das nach 1807 durch eine Welt von der Grösse und von dem Wollen
des vergangenen Staates geschieden war.
Heisst das nun, sich innerlich von unseren Toten abkehren und die Ideale preis-
geben, für die sie kämpften? Nein, es heisst, in ihrem Geiste weiterleben, auch wenn
die alte Form zerbrach. Wie die grosse Vergangenheit unseres Reiches, über die jetzt
der Vorhang niedergefallen ist, zwei Dinge von uns fordert: sie zu ehren und zugleich
über sie hinwegzuschreiten, so fordern auch unsere Toten von uns zwei Dinge: ein
treues Gedenken und ein neues Leben. Eins in dem Andern, denn das Eine schliesst
das andere nicht aus, sondern bedingt es. Wem es schwer fällt beides zu vereinen,
der möge nur die Toten von 1914/18 befragen, die wie ein unübersehbares Geisterheer
zwischen dem alten und dem neuen Deutschland, zwischen unserer Vergangenheit und
unserer Zukunft schweben. Jene Millionen, die unser Schicksal nicht abwenden konnten,
aber uns mahnen, uns nicht für immer von ihm knechten zu lassen: sie können uns
auch das höchste lehren, uns selber treu zu bleiben und im Schäften des Neuen die