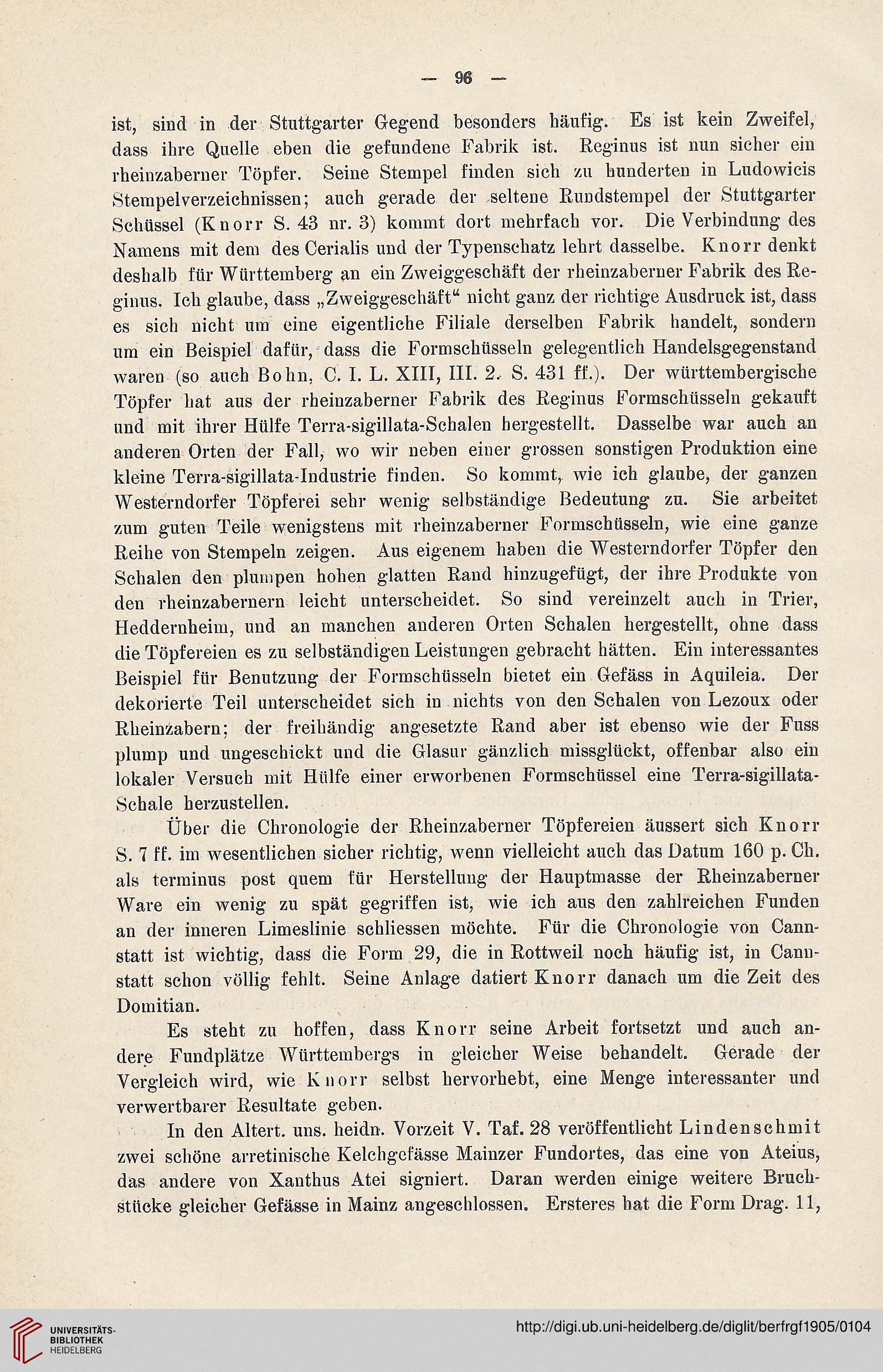96
ist, sind in der Stuttgarter Gegend besonders häufig. Es ist kein Zweifel,
dass ihre Quelle eben die gefundene Fabrik ist. Rcginus ist nun sicher ein
rheinzaberner Töpfer. Seine Stempel finden sich zu hunderteu in Ludowicis
Stempelverzeichnissen; auch gerade der seltene Rundsteiupel der Stuttgarter
Schüssel (Knorr S. 43 nr. 3) kommt dort mehrfach vor. Die Verbindung des
Namens mit dem des Cerialis und der Typenschatz lehrt dasselbe. Knorr denkt
deshalb für Württeinberg an ein Zweiggeschäft der rheinzaberner Fabrik des Re-
ginus. Ieh glaube, dass „Zweiggeschäft“ nicht ganz der richtige Ausdruck ist, dass
es sicli nieht um eine eigentliche Filiale derselben Fabrik handelt, sondern
um ein Beispiel dafiir, dass die Formschiisseln gelegentlich Handelsgegenstand
waren (so auch Bohn. C. I. L. XIII, III. 2. S. 431 ff.). Der wiirttembergische
Töpfer hat aus der rheiuzaberner Fabrik des Reginus Formschiisseln gekauft
und mit ihrer Hiilfe Terra-sigillata-Schalen hergestellt. Dasselbe war auch an
anderen Orten der Fall, wo wir neben einer grossen sonstigen Produktion eine
kleine Terra-sigillata-Industrie finden. So kommt, wie ich glaube, der gauzen
Westerndorfer Töpferei sehr wenig selbständige Bedeutung zu. Sie arbeitet
zum guten Teile wenigstens mit rheinzaberner Formschiisseln, wie eine ganze
Reihe von Stempeln zeigen. Aus eigenem liaben die Westerndorfer Töpfer den
Schalen den plumpen hohen glatten Rand hinzugefiigt, der ihre Produkte von
den rheinzabernern leicht unterscheidet. So sind vereinzelt auch in Trier,
Heddernheim, und an manchen anderen Orten Schalen hergestellt, ohne dass
die Töpfereien es zu selbständigen Leistungen gebracht liätten. Ein iuteressantes
Beispiel fiir Benutzung der Formschtisseln bietet ein Gefäss in Aquileia. Der
dekorierte Teil unterscheidet sieh in nichts von den Schalen von Lezoux oder
Rheinzabern; der freihändig angesetzte Rand aber ist ebenso wie der Fuss
plurnp und ungeschickt und die Glasur gänzlich missglückt, offenbar also ein
lokaler Versuch mit Hiilfe einer erworbenen Formschüssel eine Terra-sigillata-
Schale herzustellen.
Über die Chronologie der Rheinzaberner Töpfereien äussert sich Knorr
S. 7 ff. im wesentlichen sicher richtig, wenn vielleieht auch das Datum 160 p. Ch.
als terrainus post quem tur Herstellung der Hauptmasse der Rheinzaberner
Ware ein wenig zn spät gegriffen ist, wie ich aus den zahlreichen Funden
an der inneren Limeslinie schliessen möchte. Für die Ckronologie von Cann-
statt ist wichtig, dass die Form 29, die in Rottweil noch häufig ist, in Cann-
statt schon völlig fehlt. Seine Anlage datiert Knorr danach um die Zeit des
Domitian.
Es stekt zu hoffen, dass Knorr seine Arbeit fortsetzt und auch an-
dere Fundplätze WUrttembergs in gleicher Weise behandelt. Gerade der
Vergleich wird, wie Knorr selbst hervorhebt, eine Menge interessanter und
verwertbarer Resultate geben.
In den Altert. uns. heidn. Vorzeit V. Taf. 28 veröffentlicht Lindenschmit
zwei scliöne arretinische Kelchgefässe Mainzer Fundortes, das eine von Ateius,
das andere von Xanthus Atei signiert. Daran werden einige weitere Bruch-
stücke gleicher Gefässe in Mainz angeschlossen. Ersteres hat die Form Drag. 11,
ist, sind in der Stuttgarter Gegend besonders häufig. Es ist kein Zweifel,
dass ihre Quelle eben die gefundene Fabrik ist. Rcginus ist nun sicher ein
rheinzaberner Töpfer. Seine Stempel finden sich zu hunderteu in Ludowicis
Stempelverzeichnissen; auch gerade der seltene Rundsteiupel der Stuttgarter
Schüssel (Knorr S. 43 nr. 3) kommt dort mehrfach vor. Die Verbindung des
Namens mit dem des Cerialis und der Typenschatz lehrt dasselbe. Knorr denkt
deshalb für Württeinberg an ein Zweiggeschäft der rheinzaberner Fabrik des Re-
ginus. Ieh glaube, dass „Zweiggeschäft“ nicht ganz der richtige Ausdruck ist, dass
es sicli nieht um eine eigentliche Filiale derselben Fabrik handelt, sondern
um ein Beispiel dafiir, dass die Formschiisseln gelegentlich Handelsgegenstand
waren (so auch Bohn. C. I. L. XIII, III. 2. S. 431 ff.). Der wiirttembergische
Töpfer hat aus der rheiuzaberner Fabrik des Reginus Formschiisseln gekauft
und mit ihrer Hiilfe Terra-sigillata-Schalen hergestellt. Dasselbe war auch an
anderen Orten der Fall, wo wir neben einer grossen sonstigen Produktion eine
kleine Terra-sigillata-Industrie finden. So kommt, wie ich glaube, der gauzen
Westerndorfer Töpferei sehr wenig selbständige Bedeutung zu. Sie arbeitet
zum guten Teile wenigstens mit rheinzaberner Formschiisseln, wie eine ganze
Reihe von Stempeln zeigen. Aus eigenem liaben die Westerndorfer Töpfer den
Schalen den plumpen hohen glatten Rand hinzugefiigt, der ihre Produkte von
den rheinzabernern leicht unterscheidet. So sind vereinzelt auch in Trier,
Heddernheim, und an manchen anderen Orten Schalen hergestellt, ohne dass
die Töpfereien es zu selbständigen Leistungen gebracht liätten. Ein iuteressantes
Beispiel fiir Benutzung der Formschtisseln bietet ein Gefäss in Aquileia. Der
dekorierte Teil unterscheidet sieh in nichts von den Schalen von Lezoux oder
Rheinzabern; der freihändig angesetzte Rand aber ist ebenso wie der Fuss
plurnp und ungeschickt und die Glasur gänzlich missglückt, offenbar also ein
lokaler Versuch mit Hiilfe einer erworbenen Formschüssel eine Terra-sigillata-
Schale herzustellen.
Über die Chronologie der Rheinzaberner Töpfereien äussert sich Knorr
S. 7 ff. im wesentlichen sicher richtig, wenn vielleieht auch das Datum 160 p. Ch.
als terrainus post quem tur Herstellung der Hauptmasse der Rheinzaberner
Ware ein wenig zn spät gegriffen ist, wie ich aus den zahlreichen Funden
an der inneren Limeslinie schliessen möchte. Für die Ckronologie von Cann-
statt ist wichtig, dass die Form 29, die in Rottweil noch häufig ist, in Cann-
statt schon völlig fehlt. Seine Anlage datiert Knorr danach um die Zeit des
Domitian.
Es stekt zu hoffen, dass Knorr seine Arbeit fortsetzt und auch an-
dere Fundplätze WUrttembergs in gleicher Weise behandelt. Gerade der
Vergleich wird, wie Knorr selbst hervorhebt, eine Menge interessanter und
verwertbarer Resultate geben.
In den Altert. uns. heidn. Vorzeit V. Taf. 28 veröffentlicht Lindenschmit
zwei scliöne arretinische Kelchgefässe Mainzer Fundortes, das eine von Ateius,
das andere von Xanthus Atei signiert. Daran werden einige weitere Bruch-
stücke gleicher Gefässe in Mainz angeschlossen. Ersteres hat die Form Drag. 11,