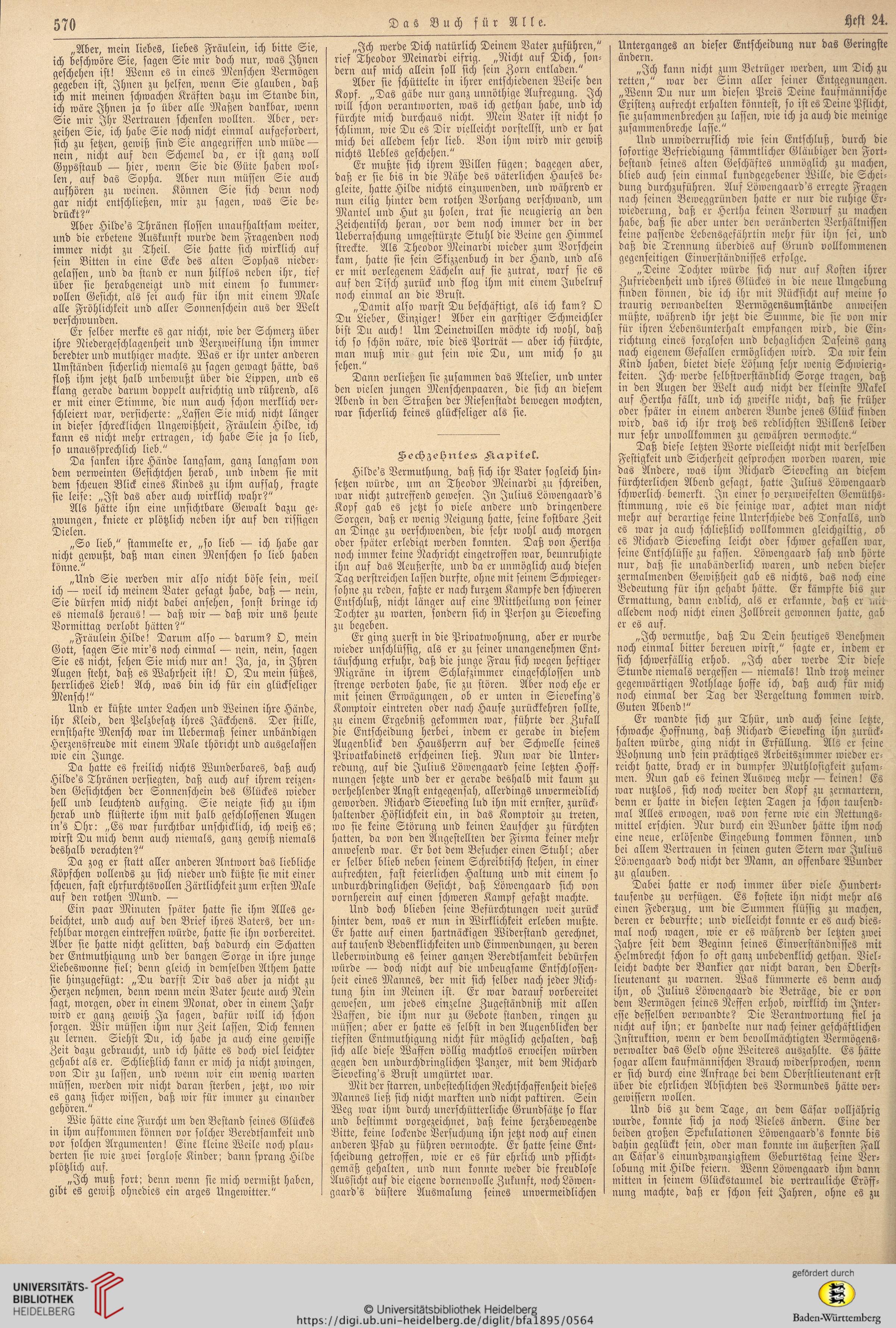570
„Aber, mein liebes, liebes Fräulein, ich bitte Sie,
ich beschwöre Sie, sagen Sie mir doch nur, was Ihnen
geschehen ist! Wenn es in eines Menschen Vermögen
gegeben ist, Ihnen zu helfen, wenn Sie glauben, daß
ich mit meinen schwachen Kräften dazu im Stande bin,
ich wäre Ihnen ja so über alle Maßen dankbar, wenn
Sie mir Ihr Vertrauen schenken wollten. Aber, ver-
zeihen Sie, ich habe Sie noch nicht einmal aufgefordert,
sich zu setzen, gewiß sind Sie angegriffen und müde —
nein, nicht auf den Schemel da, er ist ganz voll
Gypsstaub — hier, wenn Sie die Güte haben wol-
len, auf das Sopha. Aber nun müssen Sie auch
aushören zu weinen. Können Sie sich denn noch
gar nicht entschließen, mir zu sagen, was Sie be-
drückt?"
Aber Hilde's Thränen flössen unaufhaltsam weiter,
und die erbetene Auskunft wurde dein Fragenden noch
immer nicht zu Theil. Sie hatte sich wirklich auf
sein Bitten in eine Ecke des alten Sophas nieder-
gelassen, und da stand er nun hilflos neben ihr, tief
über sie herabgeneigt und mit einem so kummer-
vollen Gesicht, als sei auch für ihn mit einem Male
alle Fröhlichkeit und aller Sonnenschein aus der Welt
verschwunden.
Er selber merkte es gar nicht, wie der Schmerz über
ihre Niedergeschlagenheit und Verzweiflung ihn immer
beredter und muthiger machte. Was er ihr unter anderen
Umstünden sicherlich niemals zu sagen gewagt hätte, das
floß ihm jetzt halb unbewußt über die Lippen, und es
klang gerade darum doppelt aufrichtig und rührend, als
er mit einer Stimme, die nun auch schon merklich ver-
schleiert war, versicherte: „Lassen Sie mich nicht länger
in dieser schrecklichen Ungewißheit, Fräulein Hilde, ich
kann es nicht mehr ertragen, ich habe Sie ja so lieb,
so unaussprechlich lieb."
Da sanken ihre Hände langsam, ganz langsam von
dem verweinten Gesichtchen herab, und indem sie mit
dem scheuen Blick eines Kindes zu ihm aufsah, fragte
sie leise: „Ist das aber auch wirklich wahr?"
Als Hütte ihn eine unsichtbare Gewalt dazu ge-
zwungen, kniete er plötzlich neben ihr auf den rissigen
Dielen.
„So lieb," stammelte er, „so lieb — ich habe gar
nicht gewußt, daß man einen Menschen so lieb haben
könne."
„Und Sie werden mir also nicht böse sein, weil
ich — weil ich meinem Vater gesagt habe, daß — nein,
Sie dürfen mich nicht dabei ansehen, sonst bringe ich
es niemals heraus! — daß wir — daß wir uns heute
Vormittag verlobt Hütten?"
„Fräulein Hilde! Darum also — darum? O, mein
Gott, sagen Sie mir's noch einmal — nein, nein, sagen
Sie es nicht, sehen Sie mich nur an! Ja, ja, in Ihren
Augen steht, daß es Wahrheit ist! O, Du mein süßes,
herrliches Lieb! Ach, was bin ich für ein glückseliger
Mensch!"
Und er küßte unter Lachen und Weinen ihre Hände,
ihr Kleid, den Pelzbesatz ihres Jäckchens. Der stille,
ernsthafte Mensch war im Uebermaß seiner unbändigen
Herzensfreude mit einem Male thöricht und ausgelassen
wie ein Junge.
Da hatte es freilich nichts Wunderbares, daß auch
Hilde's Thränen versiegten, daß auch auf ihrem reizen-
den Gesichtchen der Sonnenschein des Glückes wieder
hell und leuchtend aufging. Sie neigte sich zu ihm
herab und flüsterte ihm mit halb geschlossenen Augen
in's Ohr: „Es war furchtbar unschicklich, ich weiß es;
wirst Du mich denn auch niemals, ganz gewiß niemals
deshalb verachten?"
Da zog er statt aller anderen Antwort das liebliche
Köpfchen vollends zu sich nieder und küßte sie mit einer
scheuen, fast ehrfurchtsvollen Zärtlichkeit zum ersten Male
auf den rochen Mund. —
Ein paar Minuten später hatte sie ihm Alles ge-
beichtet, und auch auf den Bries ihres Vaters, der un-
fehlbar morgen eintreffen würde, hatte sie ihn vorbereitet.
Aber sie hatte nicht gelitten, daß dadurch ein Schatten
der Entmuthigung und der bangen Sorge in ihre junge
Liebeswonne siel; denn gleich in demselben Athem hatte
sie hinzugesügt: „Du darfst Dir das aber ja nicht zu
Herzen nehmen, denn wenn mein Vater heute auch Nein
sagt, morgen, oder in einem Monat, oder in einem Jahr
wird er ganz gewiß Ja sagen, dafür will ich schon
sorgen. Wir müssen ihm nur Zeit lassen, Dich kennen
zu lernen. Siehst Du, ich habe ja auch eine gewisse
Zeit dazu gebraucht, und ich hätte es doch viel leichter
gehabt als er. Schließlich kann er mich ja nicht zwingen,
von Dir zu lassen, und wenn wir ein wenig warten
müssen, werden wir nicht daran sterben, jetzt, wo wir
es ganz sicher wissen, daß wir für immer zu einander
gehören."
Wie Hütte eine Furcht um den Bestand seines Glückes
in ihm aufkommen können vor solcher Beredtsamkeit und
vor solchen Argumenten! Eine kleine Weile noch plau-
derten sie wie zwei sorglose Kinder; dann sprang Hilde
plötzlich auf.
„Ich muß fort; denn wenn sie mich vermißt haben,
gibt es gewiß ohnedies ein arges Ungewitter."
Das Buch für Alle.
„Ich werde Dich natürlich Deinem Vater zuführen,"
rief Theodor Meinardi eifrig. „Nicht auf Dich, son-
dern auf mich allein soll sich sein Zorn entladen."
Aber sie schüttelte in ihrer entschiedenen Weise den
Kopf. „Das gäbe nur ganz unnöthige Aufregung. Ich
will schon verantworten, was ich gethan habe, und ich
fürchte mich durchaus nicht. Mein Vater ist nicht so
schlimm, wie Du es Dir vielleicht vorstellst, und er hat
mich bei alledem sehr lieb. Von ihm wird mir gewiß
nichts Uebles geschehen."
Er mußte sich ihrem Willen fügen; dagegen aber,
daß er sie bis in die Nähe des väterlichen Hauses be-
gleite, hatte Hilde nichts einzuwenden, und während er
nun eilig hinter dem rothen Vorhang verschwand, um
Mantel und Hut zu holen, trat sie neugierig an den
Zeichentisch heran, vor dem noch immer der in der
Ueberraschung umgestürzte Stuhl die Beine gen Himmel
streckte. Als Theodor Meinardi wieder zum Vorschein
kam, hatte sie sein Skizzenbuch in der Hand, und als
er mit verlegenem Lächeln auf sie zutrat, warf sie es
auf den Tisch zurück und flog ihm mit einem Jubelruf
noch einmal an die Brust.
„Damit also warst Du beschäftigt, als ich kam? O
Du Lieber, Einziger! Aber ein garstiger Schmeichler
bist Du auch! Um Deinetwillen möchte ich wohl, daß
ich so schön wäre, wie dies Porträt — aber ich fürchte,
man muß mir gut sein wie Du, um mich so zu
sehen."
Dann verließen sie zusammen das Atelier, und unter
den vielen jungen Menschenpaaren, die sich an diesem
Abend in den Straßen der Riesenstadt bewegen mochten,
war sicherlich keines glückseliger als sie.
Sechzehntes Kcrpitet.
Hilde's Vermuthung, daß sich ihr Vater sogleich hin-
setzen würde, um an Theodor Meinardi zu schreiben,
war nicht zutreffend gewesen. In Julius Löwengaard's
Kopf gab es jetzt so viele andere und dringendere
Sorgen, daß er wenig Neigung hatte, seine kostbare Zeit
an Dinge zu verschwenden, die sehr wohl auch morgen
oder später erledigt werden konnten. Daß von Hertha
noch immer keine Nachricht eingetroffen war, beunruhigte
ihn auf das Aeußerste, und da er unmöglich auch diesen
Tag verstreichen lassen durfte, ohne mit seinem Schwieger-
söhne zu reden, faßte er nach kurzem Kampfe den schweren
Entschluß, nicht länger auf eine Mittheilung von seiner
Tochter zu warten, sondern sich in Person zu Sieveking
zu begeben.
Er ging zuerst in die Privatwohnung, aber er wurde
wieder unschlüssig, als er zu seiner unangenehmen Ent-
täuschung erfuhr, daß die junge Frau sich wegen heftiger
Migräne in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen und
strenge verboten habe, sie zu stören. Aber noch ehe er
mit seinen Erwägungen, ob er unten in Sieveking's
Komptoir eintreten oder nach Hause zurückkehren sollte,
zu einem Ergebnis; gekommen war, führte der Zufall
die Entscheidung herbei, indem er gerade in diesem
Augenblick den Hausherrn auf der Schwelle seines
Privatkabinets erscheinen ließ. Nun war die Unter-
redung, auf die Julius Löwengaard seine letzten Hoff-
nungen setzte und der er gerade deshalb mit kaum zu
verhehlender Angst entgegenfah, allerdings unvermeidlich
geworden. Richard Sieveking lud ihn mit ernster, zurück-
haltender Höflichkeit ein, in das Komptoir zu treten,
wo sie keine Störung und keinen Lauscher zu fürchten
hatten, da von den Angestellten der Firma keiner mehr
anwesend war. Er bot dem Besucher einen Stuhl; aber
er selber blieb neben seinem Schreibtisch stehen, in einer
aufrechten, fast feierlichen Haltung und mit einem so
undurchdringlichen Gesicht, daß Löwengaard sich von
vornherein auf einen schweren Kampf gefaßt machte.
Und doch blieben feine Befürchtungen weit zurück
hinter dem, was er nun in Wirklichkeit erleben mußte.
Er hatte auf einen hartnäckigen Widerstand gerechnet,
auf tausend Bedenklichkeiten und Einwendungen, zu deren
Ueberwindung es seiner ganzen Beredtsamkeit bedürfen
würde — doch nicht auf die unbeugsame Entschlossen-
heit eines Mannes, der mit sich selber nach jeder Rich-
tung hin im Reinen ist. Er war darauf vorbereitet
gewesen, um jedes einzelne Zugeständniß mit allen
Waffen, die ihm nur zu Gebote standen, ringen zu
müssen; aber er hatte es selbst in den Augenblicken der
tiefsten Entmuthigung nicht für möglich gehalten, daß
sich alle diese Waffen völlig machtlos erweisen würden
gegen den undurchdringlichen Panzer, mit dem Richard
Sieveking's Brust umgürtet war.
Mit der starren, unbestechlichen Rechtschaffenheit dieses
Mannes ließ sich nicht markten und nicht paktiren. Sein
Weg war ihm durch unerschütterliche Grundsätze so klar
und bestimmt vorgezeichnet, daß keine herzbewegende
Bitte, keine lockende Versuchung ihn jetzt noch auf einen
anderen Pfad zu führen vermochte. Er hatte seine Ent-
scheidung getroffen, wie er es für ehrlich und pflicht-
gemäß gehalten, und nun konnte weder die freudlose
Aussicht auf die eigene dornenvolle Zukunft, noch Löwen-
gaard's düstere Ausmalung seines unvermeidlichen
Heft 24.
Unterganges an dieser Entscheidung nur das Geringste
ändern.
„Ich kann nicht zum Betrüger werden, um Dich zu
retten," war der Sinn aller seiner Entgegnungen.
„Wenn Du nur um diesen Preis Deine kaufmännische
Existenz aufrecht erhalten könntest, so ist es Deine Pflicht,
sie zusammenbrechen zu lassen, wie ich ja auch die meinige
zusammenbreche lasse."
Und unwiderruflich wie sein Entschluß, durch die
sofortige Befriedigung sämmtlicher Gläubiger den Fort-
bestand seines alten Geschäftes unmöglich zu machen,
blieb auch sein einmal kundgegebener Wille, die Schei-
dung durchzuführen. Auf Löwengaard's erregte Fragen
nach seinen Beweggründen hatte er nur die ruhige Er-
wiederung, daß er Hertha keinen Vorwurf zu machen
habe, daß sie aber unter den veränderten Verhältnissen
keine passende Lebensgefährtin mehr für ihn sei, und
daß die Trennung überdies auf Grund vollkommenen
gegenseitigen Einverständnisses erfolge.
„Deine Tochter würde sich nur auf Kosten ihrer
Zufriedenheit und ihres Glückes in die neue Umgebung
finden können, die ich ihr mit Rücksicht auf meine so
traurig verwandelten Vermögensumstände anweisen
müßte, während ihr jetzt die Summe, die sie von mir
für ihren Lebensunterhalt empfangen wird, die Ein-
richtung eines sorglosen und behaglichen Daseins ganz
nach eigenem Gefallen ermöglichen wird. Da wir kein
Kind haben, bietet diese Lösung sehr wenig Schwierig-
keiten. Ich werde selbstverständlich Sorge tragen, daß
in den Augen der Welt auch nicht der kleinste Makel
auf Hertha fällt, und ich zweifle nicht, daß sie früher
oder später in einem anderen Bunde jenes Glück finden
wird, das ich ihr trotz des redlichsten Willens leider
nur sehr unvollkommen zu gewähren vermochte."
Daß diese letzten Worte vielleicht nicht mit derselben
Festigkeit und Sicherheit gesprochen worden waren, wie
das Andere, was ihm Richard Sieveking an diesem
fürchterlichen Abend gesagt, hatte Julius Löwengaard
schwerlich bemerkt. In einer so verzweifelten Gemüths-
stimmung, wie es die seinige war, achtet man nicht
mehr auf derartige feine Unterschiede des Tonfalls, und
es war ja auch schließlich vollkommen gleichgiltig, ob
es Richard Sieveking leicht oder schwer gefallen war,
seine Entschlüsse zu fassen. Löwengaard sah und hörte
nur, daß sie unabänderlich waren, und neben dieser
zermalmenden Gewißheit gab es nichts, das noch eine
Bedeutung für ihn gehabt hätte. Er kämpfte bis zur
Ermattung, dann endlich, als er erkannte, daß er mit
alledem noch nicht einen Zollbreit gewonnen hatte, gab
er es auf.
„Ich vermuthe, daß Du Dein heutiges Benehmen
noch einmal bitter bereuen wirst," sagte er, indem er
sich schwerfällig erhob. „Ich aber werde Dir diese
Stunde niemals vergessen — niemals! Und trotz meiner
gegenwärtigen Nothlage hoffe ich, daß auch für mich
noch einmal der Tag der Vergeltung kommen wird.
Guten Abend!"
Er wandte sich zur Thür, und auch seine letzte,
schwache Hoffnung, daß Richard Sieveking ihn zurück-
halten würde, ging nicht in Erfüllung. Als er seine
Wohnung und sein prächtiges Arbeitszimmer wieder er-
reicht hatte, brach er in dumpfer Muthlosigkeit zusam-
men. Nun gab es keinen Ausweg mehr — keinen! Es
ivar nutzlos, sich noch weiter den Kopf zu zermartern,
denn er hatte in diesen letzten Tagen ja schon tausend-
mal Alles erwogen, was von ferne wie ein Rettungs-
mittel erschien. Nur durch ein Wunder hätte ihm noch
eine neue, erlösende Eingebung kommen können, und
bei allem Vertrauen in seinen guten Stern war Julius
Löwengaard doch nicht der Mann, an offenbare Wunder
zu glauben.
Dabei hatte er noch immer über viele Hundert-
tausende zu verfügen. Es kostete ihn nicht mehr als
einen Federzug, um die Summen flüssig zu machen,
deren er bedurfte; und vielleicht konnte er es auch dies-
mal noch wagen, wie er es während der letzten zwei
Jahre seit dem Beginn seines Einverständnisses mit
Helmbrecht schon so oft ganz unbedenklich gethan. Viel-
leicht dachte der Bankier gar nicht daran, den Oberst-
lieutenant zu warnen. Was kümmerte es denn auch
ihn, ob Julius Löwengaard die Beträge, die er von
dem Vermögen seines Neffen erhob, wirklich im Inter-
esse desselben verwandte? Die Verantwortung fiel ja
nicht auf ihn; er handelte nur nach seiner geschäftlichen
Instruktion, wenn er dem bevollmächtigten Vermögens-
verwalter das Geld ohne Weiteres auszahlte. Es hätte
sogar allem kaufmännischen Brauch widersprochen, wenn
er sich durch eine Anfrage bei dem Oberstlieutenant erst
über die ehrlichen Absichten des Vormundes hätte ver-
gewissern wollen.
Und bis zu dem Tage, an dem Cäsar volljährig
wurde, konnte sich ja noch Vieles ändern. Eine der
beiden großen Spekulationen Löwengaard's konnte bis
dahin geglückt sein, oder man konnte im äußersten Fall
an Cäsar's einundzwanzigstem Geburtstag seine Ver-
lobung mit Hilde feiern. Wenn Löwengaard ihm dann
mitten in seinem Glückstaumel die vertrauliche Eröff-
nung machte, daß er schon seit Jahren, ohne es zu
„Aber, mein liebes, liebes Fräulein, ich bitte Sie,
ich beschwöre Sie, sagen Sie mir doch nur, was Ihnen
geschehen ist! Wenn es in eines Menschen Vermögen
gegeben ist, Ihnen zu helfen, wenn Sie glauben, daß
ich mit meinen schwachen Kräften dazu im Stande bin,
ich wäre Ihnen ja so über alle Maßen dankbar, wenn
Sie mir Ihr Vertrauen schenken wollten. Aber, ver-
zeihen Sie, ich habe Sie noch nicht einmal aufgefordert,
sich zu setzen, gewiß sind Sie angegriffen und müde —
nein, nicht auf den Schemel da, er ist ganz voll
Gypsstaub — hier, wenn Sie die Güte haben wol-
len, auf das Sopha. Aber nun müssen Sie auch
aushören zu weinen. Können Sie sich denn noch
gar nicht entschließen, mir zu sagen, was Sie be-
drückt?"
Aber Hilde's Thränen flössen unaufhaltsam weiter,
und die erbetene Auskunft wurde dein Fragenden noch
immer nicht zu Theil. Sie hatte sich wirklich auf
sein Bitten in eine Ecke des alten Sophas nieder-
gelassen, und da stand er nun hilflos neben ihr, tief
über sie herabgeneigt und mit einem so kummer-
vollen Gesicht, als sei auch für ihn mit einem Male
alle Fröhlichkeit und aller Sonnenschein aus der Welt
verschwunden.
Er selber merkte es gar nicht, wie der Schmerz über
ihre Niedergeschlagenheit und Verzweiflung ihn immer
beredter und muthiger machte. Was er ihr unter anderen
Umstünden sicherlich niemals zu sagen gewagt hätte, das
floß ihm jetzt halb unbewußt über die Lippen, und es
klang gerade darum doppelt aufrichtig und rührend, als
er mit einer Stimme, die nun auch schon merklich ver-
schleiert war, versicherte: „Lassen Sie mich nicht länger
in dieser schrecklichen Ungewißheit, Fräulein Hilde, ich
kann es nicht mehr ertragen, ich habe Sie ja so lieb,
so unaussprechlich lieb."
Da sanken ihre Hände langsam, ganz langsam von
dem verweinten Gesichtchen herab, und indem sie mit
dem scheuen Blick eines Kindes zu ihm aufsah, fragte
sie leise: „Ist das aber auch wirklich wahr?"
Als Hütte ihn eine unsichtbare Gewalt dazu ge-
zwungen, kniete er plötzlich neben ihr auf den rissigen
Dielen.
„So lieb," stammelte er, „so lieb — ich habe gar
nicht gewußt, daß man einen Menschen so lieb haben
könne."
„Und Sie werden mir also nicht böse sein, weil
ich — weil ich meinem Vater gesagt habe, daß — nein,
Sie dürfen mich nicht dabei ansehen, sonst bringe ich
es niemals heraus! — daß wir — daß wir uns heute
Vormittag verlobt Hütten?"
„Fräulein Hilde! Darum also — darum? O, mein
Gott, sagen Sie mir's noch einmal — nein, nein, sagen
Sie es nicht, sehen Sie mich nur an! Ja, ja, in Ihren
Augen steht, daß es Wahrheit ist! O, Du mein süßes,
herrliches Lieb! Ach, was bin ich für ein glückseliger
Mensch!"
Und er küßte unter Lachen und Weinen ihre Hände,
ihr Kleid, den Pelzbesatz ihres Jäckchens. Der stille,
ernsthafte Mensch war im Uebermaß seiner unbändigen
Herzensfreude mit einem Male thöricht und ausgelassen
wie ein Junge.
Da hatte es freilich nichts Wunderbares, daß auch
Hilde's Thränen versiegten, daß auch auf ihrem reizen-
den Gesichtchen der Sonnenschein des Glückes wieder
hell und leuchtend aufging. Sie neigte sich zu ihm
herab und flüsterte ihm mit halb geschlossenen Augen
in's Ohr: „Es war furchtbar unschicklich, ich weiß es;
wirst Du mich denn auch niemals, ganz gewiß niemals
deshalb verachten?"
Da zog er statt aller anderen Antwort das liebliche
Köpfchen vollends zu sich nieder und küßte sie mit einer
scheuen, fast ehrfurchtsvollen Zärtlichkeit zum ersten Male
auf den rochen Mund. —
Ein paar Minuten später hatte sie ihm Alles ge-
beichtet, und auch auf den Bries ihres Vaters, der un-
fehlbar morgen eintreffen würde, hatte sie ihn vorbereitet.
Aber sie hatte nicht gelitten, daß dadurch ein Schatten
der Entmuthigung und der bangen Sorge in ihre junge
Liebeswonne siel; denn gleich in demselben Athem hatte
sie hinzugesügt: „Du darfst Dir das aber ja nicht zu
Herzen nehmen, denn wenn mein Vater heute auch Nein
sagt, morgen, oder in einem Monat, oder in einem Jahr
wird er ganz gewiß Ja sagen, dafür will ich schon
sorgen. Wir müssen ihm nur Zeit lassen, Dich kennen
zu lernen. Siehst Du, ich habe ja auch eine gewisse
Zeit dazu gebraucht, und ich hätte es doch viel leichter
gehabt als er. Schließlich kann er mich ja nicht zwingen,
von Dir zu lassen, und wenn wir ein wenig warten
müssen, werden wir nicht daran sterben, jetzt, wo wir
es ganz sicher wissen, daß wir für immer zu einander
gehören."
Wie Hütte eine Furcht um den Bestand seines Glückes
in ihm aufkommen können vor solcher Beredtsamkeit und
vor solchen Argumenten! Eine kleine Weile noch plau-
derten sie wie zwei sorglose Kinder; dann sprang Hilde
plötzlich auf.
„Ich muß fort; denn wenn sie mich vermißt haben,
gibt es gewiß ohnedies ein arges Ungewitter."
Das Buch für Alle.
„Ich werde Dich natürlich Deinem Vater zuführen,"
rief Theodor Meinardi eifrig. „Nicht auf Dich, son-
dern auf mich allein soll sich sein Zorn entladen."
Aber sie schüttelte in ihrer entschiedenen Weise den
Kopf. „Das gäbe nur ganz unnöthige Aufregung. Ich
will schon verantworten, was ich gethan habe, und ich
fürchte mich durchaus nicht. Mein Vater ist nicht so
schlimm, wie Du es Dir vielleicht vorstellst, und er hat
mich bei alledem sehr lieb. Von ihm wird mir gewiß
nichts Uebles geschehen."
Er mußte sich ihrem Willen fügen; dagegen aber,
daß er sie bis in die Nähe des väterlichen Hauses be-
gleite, hatte Hilde nichts einzuwenden, und während er
nun eilig hinter dem rothen Vorhang verschwand, um
Mantel und Hut zu holen, trat sie neugierig an den
Zeichentisch heran, vor dem noch immer der in der
Ueberraschung umgestürzte Stuhl die Beine gen Himmel
streckte. Als Theodor Meinardi wieder zum Vorschein
kam, hatte sie sein Skizzenbuch in der Hand, und als
er mit verlegenem Lächeln auf sie zutrat, warf sie es
auf den Tisch zurück und flog ihm mit einem Jubelruf
noch einmal an die Brust.
„Damit also warst Du beschäftigt, als ich kam? O
Du Lieber, Einziger! Aber ein garstiger Schmeichler
bist Du auch! Um Deinetwillen möchte ich wohl, daß
ich so schön wäre, wie dies Porträt — aber ich fürchte,
man muß mir gut sein wie Du, um mich so zu
sehen."
Dann verließen sie zusammen das Atelier, und unter
den vielen jungen Menschenpaaren, die sich an diesem
Abend in den Straßen der Riesenstadt bewegen mochten,
war sicherlich keines glückseliger als sie.
Sechzehntes Kcrpitet.
Hilde's Vermuthung, daß sich ihr Vater sogleich hin-
setzen würde, um an Theodor Meinardi zu schreiben,
war nicht zutreffend gewesen. In Julius Löwengaard's
Kopf gab es jetzt so viele andere und dringendere
Sorgen, daß er wenig Neigung hatte, seine kostbare Zeit
an Dinge zu verschwenden, die sehr wohl auch morgen
oder später erledigt werden konnten. Daß von Hertha
noch immer keine Nachricht eingetroffen war, beunruhigte
ihn auf das Aeußerste, und da er unmöglich auch diesen
Tag verstreichen lassen durfte, ohne mit seinem Schwieger-
söhne zu reden, faßte er nach kurzem Kampfe den schweren
Entschluß, nicht länger auf eine Mittheilung von seiner
Tochter zu warten, sondern sich in Person zu Sieveking
zu begeben.
Er ging zuerst in die Privatwohnung, aber er wurde
wieder unschlüssig, als er zu seiner unangenehmen Ent-
täuschung erfuhr, daß die junge Frau sich wegen heftiger
Migräne in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen und
strenge verboten habe, sie zu stören. Aber noch ehe er
mit seinen Erwägungen, ob er unten in Sieveking's
Komptoir eintreten oder nach Hause zurückkehren sollte,
zu einem Ergebnis; gekommen war, führte der Zufall
die Entscheidung herbei, indem er gerade in diesem
Augenblick den Hausherrn auf der Schwelle seines
Privatkabinets erscheinen ließ. Nun war die Unter-
redung, auf die Julius Löwengaard seine letzten Hoff-
nungen setzte und der er gerade deshalb mit kaum zu
verhehlender Angst entgegenfah, allerdings unvermeidlich
geworden. Richard Sieveking lud ihn mit ernster, zurück-
haltender Höflichkeit ein, in das Komptoir zu treten,
wo sie keine Störung und keinen Lauscher zu fürchten
hatten, da von den Angestellten der Firma keiner mehr
anwesend war. Er bot dem Besucher einen Stuhl; aber
er selber blieb neben seinem Schreibtisch stehen, in einer
aufrechten, fast feierlichen Haltung und mit einem so
undurchdringlichen Gesicht, daß Löwengaard sich von
vornherein auf einen schweren Kampf gefaßt machte.
Und doch blieben feine Befürchtungen weit zurück
hinter dem, was er nun in Wirklichkeit erleben mußte.
Er hatte auf einen hartnäckigen Widerstand gerechnet,
auf tausend Bedenklichkeiten und Einwendungen, zu deren
Ueberwindung es seiner ganzen Beredtsamkeit bedürfen
würde — doch nicht auf die unbeugsame Entschlossen-
heit eines Mannes, der mit sich selber nach jeder Rich-
tung hin im Reinen ist. Er war darauf vorbereitet
gewesen, um jedes einzelne Zugeständniß mit allen
Waffen, die ihm nur zu Gebote standen, ringen zu
müssen; aber er hatte es selbst in den Augenblicken der
tiefsten Entmuthigung nicht für möglich gehalten, daß
sich alle diese Waffen völlig machtlos erweisen würden
gegen den undurchdringlichen Panzer, mit dem Richard
Sieveking's Brust umgürtet war.
Mit der starren, unbestechlichen Rechtschaffenheit dieses
Mannes ließ sich nicht markten und nicht paktiren. Sein
Weg war ihm durch unerschütterliche Grundsätze so klar
und bestimmt vorgezeichnet, daß keine herzbewegende
Bitte, keine lockende Versuchung ihn jetzt noch auf einen
anderen Pfad zu führen vermochte. Er hatte seine Ent-
scheidung getroffen, wie er es für ehrlich und pflicht-
gemäß gehalten, und nun konnte weder die freudlose
Aussicht auf die eigene dornenvolle Zukunft, noch Löwen-
gaard's düstere Ausmalung seines unvermeidlichen
Heft 24.
Unterganges an dieser Entscheidung nur das Geringste
ändern.
„Ich kann nicht zum Betrüger werden, um Dich zu
retten," war der Sinn aller seiner Entgegnungen.
„Wenn Du nur um diesen Preis Deine kaufmännische
Existenz aufrecht erhalten könntest, so ist es Deine Pflicht,
sie zusammenbrechen zu lassen, wie ich ja auch die meinige
zusammenbreche lasse."
Und unwiderruflich wie sein Entschluß, durch die
sofortige Befriedigung sämmtlicher Gläubiger den Fort-
bestand seines alten Geschäftes unmöglich zu machen,
blieb auch sein einmal kundgegebener Wille, die Schei-
dung durchzuführen. Auf Löwengaard's erregte Fragen
nach seinen Beweggründen hatte er nur die ruhige Er-
wiederung, daß er Hertha keinen Vorwurf zu machen
habe, daß sie aber unter den veränderten Verhältnissen
keine passende Lebensgefährtin mehr für ihn sei, und
daß die Trennung überdies auf Grund vollkommenen
gegenseitigen Einverständnisses erfolge.
„Deine Tochter würde sich nur auf Kosten ihrer
Zufriedenheit und ihres Glückes in die neue Umgebung
finden können, die ich ihr mit Rücksicht auf meine so
traurig verwandelten Vermögensumstände anweisen
müßte, während ihr jetzt die Summe, die sie von mir
für ihren Lebensunterhalt empfangen wird, die Ein-
richtung eines sorglosen und behaglichen Daseins ganz
nach eigenem Gefallen ermöglichen wird. Da wir kein
Kind haben, bietet diese Lösung sehr wenig Schwierig-
keiten. Ich werde selbstverständlich Sorge tragen, daß
in den Augen der Welt auch nicht der kleinste Makel
auf Hertha fällt, und ich zweifle nicht, daß sie früher
oder später in einem anderen Bunde jenes Glück finden
wird, das ich ihr trotz des redlichsten Willens leider
nur sehr unvollkommen zu gewähren vermochte."
Daß diese letzten Worte vielleicht nicht mit derselben
Festigkeit und Sicherheit gesprochen worden waren, wie
das Andere, was ihm Richard Sieveking an diesem
fürchterlichen Abend gesagt, hatte Julius Löwengaard
schwerlich bemerkt. In einer so verzweifelten Gemüths-
stimmung, wie es die seinige war, achtet man nicht
mehr auf derartige feine Unterschiede des Tonfalls, und
es war ja auch schließlich vollkommen gleichgiltig, ob
es Richard Sieveking leicht oder schwer gefallen war,
seine Entschlüsse zu fassen. Löwengaard sah und hörte
nur, daß sie unabänderlich waren, und neben dieser
zermalmenden Gewißheit gab es nichts, das noch eine
Bedeutung für ihn gehabt hätte. Er kämpfte bis zur
Ermattung, dann endlich, als er erkannte, daß er mit
alledem noch nicht einen Zollbreit gewonnen hatte, gab
er es auf.
„Ich vermuthe, daß Du Dein heutiges Benehmen
noch einmal bitter bereuen wirst," sagte er, indem er
sich schwerfällig erhob. „Ich aber werde Dir diese
Stunde niemals vergessen — niemals! Und trotz meiner
gegenwärtigen Nothlage hoffe ich, daß auch für mich
noch einmal der Tag der Vergeltung kommen wird.
Guten Abend!"
Er wandte sich zur Thür, und auch seine letzte,
schwache Hoffnung, daß Richard Sieveking ihn zurück-
halten würde, ging nicht in Erfüllung. Als er seine
Wohnung und sein prächtiges Arbeitszimmer wieder er-
reicht hatte, brach er in dumpfer Muthlosigkeit zusam-
men. Nun gab es keinen Ausweg mehr — keinen! Es
ivar nutzlos, sich noch weiter den Kopf zu zermartern,
denn er hatte in diesen letzten Tagen ja schon tausend-
mal Alles erwogen, was von ferne wie ein Rettungs-
mittel erschien. Nur durch ein Wunder hätte ihm noch
eine neue, erlösende Eingebung kommen können, und
bei allem Vertrauen in seinen guten Stern war Julius
Löwengaard doch nicht der Mann, an offenbare Wunder
zu glauben.
Dabei hatte er noch immer über viele Hundert-
tausende zu verfügen. Es kostete ihn nicht mehr als
einen Federzug, um die Summen flüssig zu machen,
deren er bedurfte; und vielleicht konnte er es auch dies-
mal noch wagen, wie er es während der letzten zwei
Jahre seit dem Beginn seines Einverständnisses mit
Helmbrecht schon so oft ganz unbedenklich gethan. Viel-
leicht dachte der Bankier gar nicht daran, den Oberst-
lieutenant zu warnen. Was kümmerte es denn auch
ihn, ob Julius Löwengaard die Beträge, die er von
dem Vermögen seines Neffen erhob, wirklich im Inter-
esse desselben verwandte? Die Verantwortung fiel ja
nicht auf ihn; er handelte nur nach seiner geschäftlichen
Instruktion, wenn er dem bevollmächtigten Vermögens-
verwalter das Geld ohne Weiteres auszahlte. Es hätte
sogar allem kaufmännischen Brauch widersprochen, wenn
er sich durch eine Anfrage bei dem Oberstlieutenant erst
über die ehrlichen Absichten des Vormundes hätte ver-
gewissern wollen.
Und bis zu dem Tage, an dem Cäsar volljährig
wurde, konnte sich ja noch Vieles ändern. Eine der
beiden großen Spekulationen Löwengaard's konnte bis
dahin geglückt sein, oder man konnte im äußersten Fall
an Cäsar's einundzwanzigstem Geburtstag seine Ver-
lobung mit Hilde feiern. Wenn Löwengaard ihm dann
mitten in seinem Glückstaumel die vertrauliche Eröff-
nung machte, daß er schon seit Jahren, ohne es zu