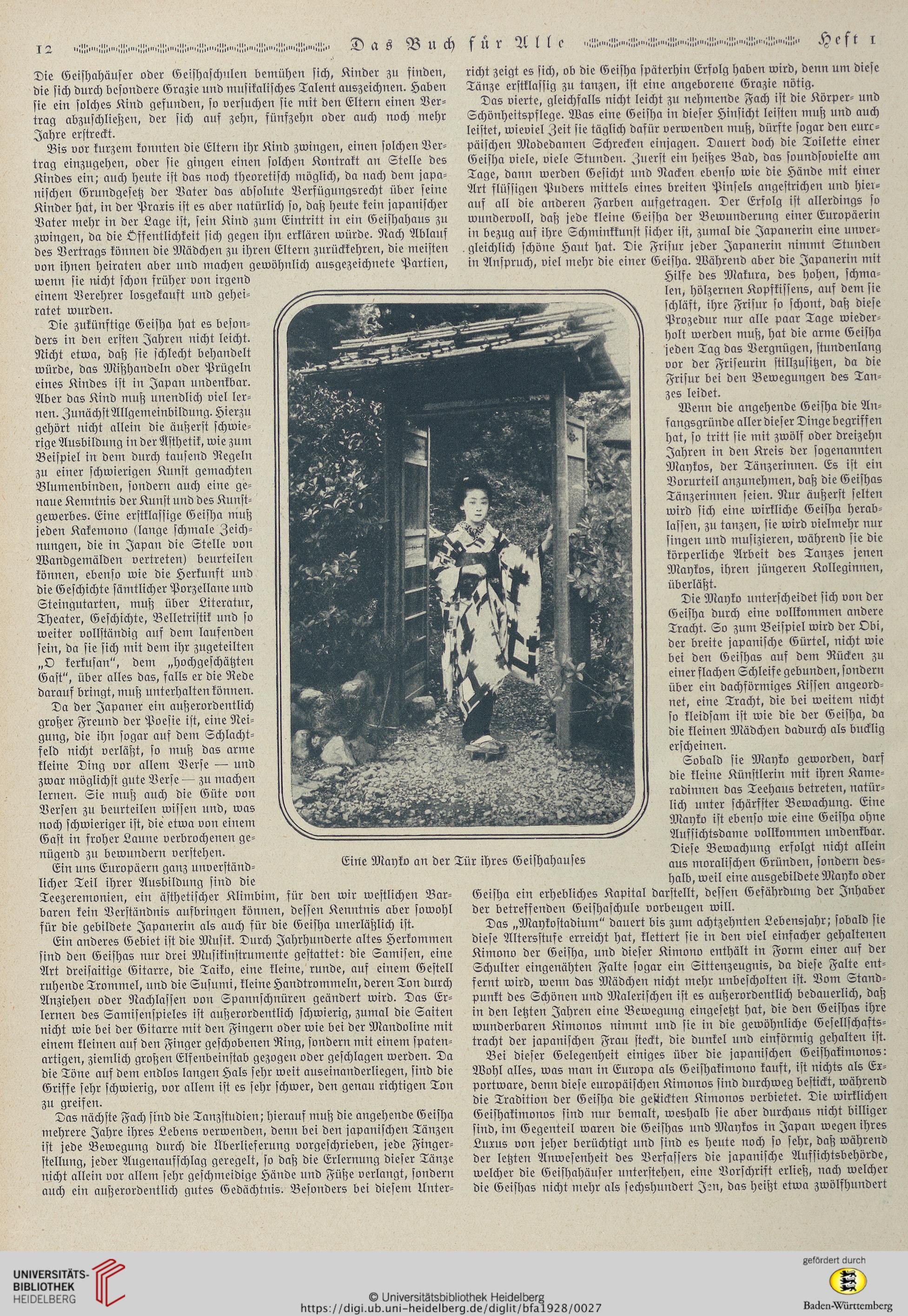12
Die Geishahäuser oder Geishaschulen bemühen sich, Kinder zu finden,
die sich durch besondere Grazie und musikalisches Talent auszeichnen. Haben
sie ein solches Kind gefunden, so versuchen sie mit den Eltern einen Ver-
trag abzuschließen, der sich auf zehn, fünfzehn oder auch noch mehr
Jahre erstreckt.
Bis vor kurzem konnten die Eltern ihr Kind zwingen, einen solchen Ver-
trag einzugehen, oder sie gingen einen solchen Kontrakt an Stelle des
Kindes ein; auch heute ist das noch theoretisch möglich, da nach dem japa-
nischen Grundgesetz der Vater das absolute Verfügungsrecht über seine
Kinder hat, in der Praxis ist es aber natürlich so, daß heute kein japanischer
Vater mehr in der Lage ist, sein Kind zum Eintritt in ein Geishahaus zu
zwingen, da die Öffentlichkeit sich gegen ihn erklären würde. Nach Ablauf
des Vertrags können die Mädchen zu ihren Eltern zurückkehren, die meisten
von ihnen heiraten aber und machen gewöhnlich ausgezeichnete Partien,
wenn sie nicht schon früher von irgend
einem Verehrer losgekauft und gehei¬
ratet wurden.
Die zukünftige Geisha hat es beson¬
ders in den ersten Jahren nicht leicht.
Nicht etwa, daß sie schlecht behandelt
würde, das Mißhandeln oder Prügeln
eines Kindes ist in Japan undenkbar.
Aber das Kind muß unendlich viel ler¬
nen. Zunächst Allgemeinbildung. Hierzu
gehört nicht allein die äußerst schmie¬
rige Ausbildung in der Ästhetik, wie zum
Beispiel in dem durch tausend Regeln
zu einer schwierigen Kunst gemachten
Blumenbinden, sondern auch eine ge¬
naue Kenntnis der Kunst und des Kunst¬
gewerbes. Eine erstklassige Geisha muß
jeden Kakemono (lange schmale Zeich¬
nungen, die in Japan die Stelle von
Wandgemälden vertreten) beurteilen
können, ebenso wie die Herkunft und
die Geschichte sämtlicher Porzellane und
Steingutarten, muß über Literatur,
Theater, Geschichte, Belletristik und so
weiter vollständig auf dem laufenden
sein, da sie sich mit dem ihr zugeteilten
„O kerkusan", dem „hochgeschätzten
Gast", über alles das, falls er die Rede
darauf bringt, muß unterhalten können.
Da der Japaner ein außerordentlich
großer Freund der Poesie ist, eine Nei¬
gung, die ihn sogar auf dem Schlacht¬
feld nicht verläßt, so muß das arme
kleine Ding vor allem Verse — und
zwar möglichst gute Verse — zu machen
lernen. Sie muß auch die Güte von
Versen zu beurteilen wissen und, was
noch schwieriger ist, die etwa von einem
Gast in froher Laune verbrochenen ge¬
nügend zu bewundern verstehen.
Ein uns Europäern ganz unverständ¬
licher Teil ihrer Ausbildung sind die
Teezeremonien, ein ästhetischer Klimbim, für den wir westlichen Bar-
baren kein Verständnis aufbringen können, dessen Kenntnis aber sowohl
für die gebildete Japanerin als auch für die Geisha unerläßlich ist.
Ein anderes Gebiet ist die Musik. Durch Jahrhunderte altes Herkommen
sind den Geishas nur drei Musikinstrumente gestattet: die Samisen, eine
Art dreisaitige Gitarre, die Taiko, eine kleine, runde, auf einem Gestell
ruhende Trommel, und die Susumi, kleine Handtrommeln, deren Ton durch
Anziehen oder Nachlassen von Spannschnüren geändert wird. Das Er-
lernen des Samisenspieles ist außerordentlich schwierig, zumal die Saiten
nicht wie bei der Gitarre mit den Fingern oder wie bei der Mandoline mit
einem kleinen auf den Finger geschobenen Ring, sondern mit einem spaten-
artigen, ziemlich großen Elfenbeinstab gezogen oder geschlagen werden. Da
die Töne auf dem endlos langen Hals sehr weit auseinanderliegen, sind die
Griffe sehr schwierig, vor allem ist es sehr schwer, den genau richtigen Ton
zu greifen.
Das nächste Fach sind die Tanzstndien; hierauf muß die angehende Geisha
mehrere Jahre ihres Lebens verwenden, denn bei den japanischen Tänzen
ist jede Bewegung durch die Überlieferung vorgeschrieben, jede Finger-
stellung, jeder Augenaufschlag geregelt, so daß die Erlernung dieser Tänze
nicht allein vor allem sehr geschmeidige Hände und Füße verlangt, sondern
auch ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Besonders bei diesem Unter-
richt zeigt es sich, ob die Geisha späterhin Erfolg haben wird, denn um diese
Tänze erstklassig zu tanzen, ist eine angeborene Grazie nötig.
Das vierte, gleichfalls nicht leicht zu nehmende Fach ist die Körper- und
Schönheitspflege. Was eine Geisha in dieser Hinsicht leisten muß und auch
leistet, wieviel Zeit sie täglich dafür verwenden muß, dürfte sogar den eurc-
päischen Modedamen Schrecken einjagen. Dauert dach die Toilette einer
Geisha viele, viele Stunden. Zuerst ein heißes Bad, das soundsovielte am
Tage, dann werden Gesicht und Nacken ebenso wie die Hände mit einer
Art flüssigen Puders mittels eines breiten Pinsels angestrichen und hier-
auf all die anderen Farben aufgetragen. Der Erfolg ist allerdings so
wundervoll, daß jede kleine Geisha der Bewunderung einer Europäerin
in bezug auf ihre Schminkkunst sicher ist, zumal die Japanerin eine unver-
. gleichlich schöne Haut hat. Die Frisur jeder Japanerin nimmt Stunden
in Anspruch, viel mehr die einer Geisha. Während aber die Japanerin mit
Hilfe des Makura, des hohen, schma-
len, hölzernen Kopfkissens, auf den: sie
schläft, ihre Frisur so schont, daß diese
Prozedur nur alle paar Tage wieder-
holt werden muß, hat die arme Geisha
jeden Tag das Vergnügen, stundenlang
vor der Friseurin stillzusitzen, da die
Frisur bei den Bewegungen des Tan-
zes leidet.
Wenn die angehende Geisha die An-
fangsgründe aller dieser Dinge begriffen
hat, so tritt sie mit zwölf oder dreizehn
Jahren in den Kreis der sogenannten
Maykos, der Tänzerinnen. Es ist ein
Vorurteil anzunehmen, daß die Geishas
Tänzerinnen seien. Nur äußerst selten
wird sich eine wirkliche Geisha herab-
lassen, zu tanzen, sie wird vielmehr nur
singen und musizieren, während sie die
körperliche Arbeit des Tanzes jenen
Maykos, ihren jüngeren Kolleginnen,
überläßt.
Die Mayko unterscheidet sich von der
Geisha durch eine vollkommen andere
Tracht. So zum Beispiel wird der Obi,
der breite japanische Gürtel, nicht wie
bei den Geishas auf dem Rücken zu
einer flachen Schleife gebunden, sondern
über ein dachförmiges Kissen angeord-
net, eine Tracht, die bei weitem nicht
so kleidsam ist wie die der Geisha, da
die kleinen Mädchen dadurch als bucklig
erscheinen.
Sobald sie Mayko geworden, darf
die kleine Künstlerin mit ihren Kame-
radinnen das Teehaus betreten, natür-
lich unter schärfster Bewachung. Eine
Mayko ist ebenso wie eine Geisha ohne
Aufsichtsdame vollkommen undenkbar.
Diese Bewachung erfolgt nicht allein
aus moralischen Gründen, sondern des-
halb, weil eine ausgebildete Mayko oder
Geisha ein erhebliches Kapital darstellt, dessen Gefährdung der Inhaber
der betreffenden Eeishaschule vorbeugen will.
Das „Maykostadium" dauert bis zum achtzehnten Lebensjahr; sobald sie
diese Altersstufe erreicht hat, klettert sie in den viel einfacher gehaltenen
Kimono der Geisha, und dieser Kimono enthält in Form einer auf der
Schulter eingenähten Falte sogar ein Sittenzeugnis, da diese Falte ent-
fernt wird, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist. Vom Stand-
punkt des Schönen und Malerischen ist es außerordentlich bedauerlich, daß
in den letzten Jahren eine Bewegung eingesetzt hat, die den Geishas ihre
wunderbaren Kimonos nimmt und sie in die gewöhnliche Gesellschafts-
tracht der japanischen Frau steckt, die dunkel und einförmig gehalten ist.
Bei dieser Gelegenheit einiges über die japanischen Geishakimonos:
Wohl alles, was man in Europa als Geishakimono kauft, ist nichts als Ex-
portware, denn diese europäischen Kimonos sind durchweg bestickt, während
die Tradition der Geisha die gestickten Kimonos verbietet. Die wirklichen
Geishakimonos sind nur bemalt, weshalb sie aber durchaus nicht billiger
sind, im Gegenteil waren die Geishas und Maykos in Japan wegen ihres
Luxus von jeher berüchtigt und sind es heute noch so sehr, daß während
der letzten Anwesenheit des Verfassers die japanische Aufsichtsbehörde,
welcher die Geishahäuser unterstehen, eine Vorschrift erließ, nach welcher
die Geishas nicht mehr als sechshundert Jen, das heißt etwa zwölfhundert
Die Geishahäuser oder Geishaschulen bemühen sich, Kinder zu finden,
die sich durch besondere Grazie und musikalisches Talent auszeichnen. Haben
sie ein solches Kind gefunden, so versuchen sie mit den Eltern einen Ver-
trag abzuschließen, der sich auf zehn, fünfzehn oder auch noch mehr
Jahre erstreckt.
Bis vor kurzem konnten die Eltern ihr Kind zwingen, einen solchen Ver-
trag einzugehen, oder sie gingen einen solchen Kontrakt an Stelle des
Kindes ein; auch heute ist das noch theoretisch möglich, da nach dem japa-
nischen Grundgesetz der Vater das absolute Verfügungsrecht über seine
Kinder hat, in der Praxis ist es aber natürlich so, daß heute kein japanischer
Vater mehr in der Lage ist, sein Kind zum Eintritt in ein Geishahaus zu
zwingen, da die Öffentlichkeit sich gegen ihn erklären würde. Nach Ablauf
des Vertrags können die Mädchen zu ihren Eltern zurückkehren, die meisten
von ihnen heiraten aber und machen gewöhnlich ausgezeichnete Partien,
wenn sie nicht schon früher von irgend
einem Verehrer losgekauft und gehei¬
ratet wurden.
Die zukünftige Geisha hat es beson¬
ders in den ersten Jahren nicht leicht.
Nicht etwa, daß sie schlecht behandelt
würde, das Mißhandeln oder Prügeln
eines Kindes ist in Japan undenkbar.
Aber das Kind muß unendlich viel ler¬
nen. Zunächst Allgemeinbildung. Hierzu
gehört nicht allein die äußerst schmie¬
rige Ausbildung in der Ästhetik, wie zum
Beispiel in dem durch tausend Regeln
zu einer schwierigen Kunst gemachten
Blumenbinden, sondern auch eine ge¬
naue Kenntnis der Kunst und des Kunst¬
gewerbes. Eine erstklassige Geisha muß
jeden Kakemono (lange schmale Zeich¬
nungen, die in Japan die Stelle von
Wandgemälden vertreten) beurteilen
können, ebenso wie die Herkunft und
die Geschichte sämtlicher Porzellane und
Steingutarten, muß über Literatur,
Theater, Geschichte, Belletristik und so
weiter vollständig auf dem laufenden
sein, da sie sich mit dem ihr zugeteilten
„O kerkusan", dem „hochgeschätzten
Gast", über alles das, falls er die Rede
darauf bringt, muß unterhalten können.
Da der Japaner ein außerordentlich
großer Freund der Poesie ist, eine Nei¬
gung, die ihn sogar auf dem Schlacht¬
feld nicht verläßt, so muß das arme
kleine Ding vor allem Verse — und
zwar möglichst gute Verse — zu machen
lernen. Sie muß auch die Güte von
Versen zu beurteilen wissen und, was
noch schwieriger ist, die etwa von einem
Gast in froher Laune verbrochenen ge¬
nügend zu bewundern verstehen.
Ein uns Europäern ganz unverständ¬
licher Teil ihrer Ausbildung sind die
Teezeremonien, ein ästhetischer Klimbim, für den wir westlichen Bar-
baren kein Verständnis aufbringen können, dessen Kenntnis aber sowohl
für die gebildete Japanerin als auch für die Geisha unerläßlich ist.
Ein anderes Gebiet ist die Musik. Durch Jahrhunderte altes Herkommen
sind den Geishas nur drei Musikinstrumente gestattet: die Samisen, eine
Art dreisaitige Gitarre, die Taiko, eine kleine, runde, auf einem Gestell
ruhende Trommel, und die Susumi, kleine Handtrommeln, deren Ton durch
Anziehen oder Nachlassen von Spannschnüren geändert wird. Das Er-
lernen des Samisenspieles ist außerordentlich schwierig, zumal die Saiten
nicht wie bei der Gitarre mit den Fingern oder wie bei der Mandoline mit
einem kleinen auf den Finger geschobenen Ring, sondern mit einem spaten-
artigen, ziemlich großen Elfenbeinstab gezogen oder geschlagen werden. Da
die Töne auf dem endlos langen Hals sehr weit auseinanderliegen, sind die
Griffe sehr schwierig, vor allem ist es sehr schwer, den genau richtigen Ton
zu greifen.
Das nächste Fach sind die Tanzstndien; hierauf muß die angehende Geisha
mehrere Jahre ihres Lebens verwenden, denn bei den japanischen Tänzen
ist jede Bewegung durch die Überlieferung vorgeschrieben, jede Finger-
stellung, jeder Augenaufschlag geregelt, so daß die Erlernung dieser Tänze
nicht allein vor allem sehr geschmeidige Hände und Füße verlangt, sondern
auch ein außerordentlich gutes Gedächtnis. Besonders bei diesem Unter-
richt zeigt es sich, ob die Geisha späterhin Erfolg haben wird, denn um diese
Tänze erstklassig zu tanzen, ist eine angeborene Grazie nötig.
Das vierte, gleichfalls nicht leicht zu nehmende Fach ist die Körper- und
Schönheitspflege. Was eine Geisha in dieser Hinsicht leisten muß und auch
leistet, wieviel Zeit sie täglich dafür verwenden muß, dürfte sogar den eurc-
päischen Modedamen Schrecken einjagen. Dauert dach die Toilette einer
Geisha viele, viele Stunden. Zuerst ein heißes Bad, das soundsovielte am
Tage, dann werden Gesicht und Nacken ebenso wie die Hände mit einer
Art flüssigen Puders mittels eines breiten Pinsels angestrichen und hier-
auf all die anderen Farben aufgetragen. Der Erfolg ist allerdings so
wundervoll, daß jede kleine Geisha der Bewunderung einer Europäerin
in bezug auf ihre Schminkkunst sicher ist, zumal die Japanerin eine unver-
. gleichlich schöne Haut hat. Die Frisur jeder Japanerin nimmt Stunden
in Anspruch, viel mehr die einer Geisha. Während aber die Japanerin mit
Hilfe des Makura, des hohen, schma-
len, hölzernen Kopfkissens, auf den: sie
schläft, ihre Frisur so schont, daß diese
Prozedur nur alle paar Tage wieder-
holt werden muß, hat die arme Geisha
jeden Tag das Vergnügen, stundenlang
vor der Friseurin stillzusitzen, da die
Frisur bei den Bewegungen des Tan-
zes leidet.
Wenn die angehende Geisha die An-
fangsgründe aller dieser Dinge begriffen
hat, so tritt sie mit zwölf oder dreizehn
Jahren in den Kreis der sogenannten
Maykos, der Tänzerinnen. Es ist ein
Vorurteil anzunehmen, daß die Geishas
Tänzerinnen seien. Nur äußerst selten
wird sich eine wirkliche Geisha herab-
lassen, zu tanzen, sie wird vielmehr nur
singen und musizieren, während sie die
körperliche Arbeit des Tanzes jenen
Maykos, ihren jüngeren Kolleginnen,
überläßt.
Die Mayko unterscheidet sich von der
Geisha durch eine vollkommen andere
Tracht. So zum Beispiel wird der Obi,
der breite japanische Gürtel, nicht wie
bei den Geishas auf dem Rücken zu
einer flachen Schleife gebunden, sondern
über ein dachförmiges Kissen angeord-
net, eine Tracht, die bei weitem nicht
so kleidsam ist wie die der Geisha, da
die kleinen Mädchen dadurch als bucklig
erscheinen.
Sobald sie Mayko geworden, darf
die kleine Künstlerin mit ihren Kame-
radinnen das Teehaus betreten, natür-
lich unter schärfster Bewachung. Eine
Mayko ist ebenso wie eine Geisha ohne
Aufsichtsdame vollkommen undenkbar.
Diese Bewachung erfolgt nicht allein
aus moralischen Gründen, sondern des-
halb, weil eine ausgebildete Mayko oder
Geisha ein erhebliches Kapital darstellt, dessen Gefährdung der Inhaber
der betreffenden Eeishaschule vorbeugen will.
Das „Maykostadium" dauert bis zum achtzehnten Lebensjahr; sobald sie
diese Altersstufe erreicht hat, klettert sie in den viel einfacher gehaltenen
Kimono der Geisha, und dieser Kimono enthält in Form einer auf der
Schulter eingenähten Falte sogar ein Sittenzeugnis, da diese Falte ent-
fernt wird, wenn das Mädchen nicht mehr unbescholten ist. Vom Stand-
punkt des Schönen und Malerischen ist es außerordentlich bedauerlich, daß
in den letzten Jahren eine Bewegung eingesetzt hat, die den Geishas ihre
wunderbaren Kimonos nimmt und sie in die gewöhnliche Gesellschafts-
tracht der japanischen Frau steckt, die dunkel und einförmig gehalten ist.
Bei dieser Gelegenheit einiges über die japanischen Geishakimonos:
Wohl alles, was man in Europa als Geishakimono kauft, ist nichts als Ex-
portware, denn diese europäischen Kimonos sind durchweg bestickt, während
die Tradition der Geisha die gestickten Kimonos verbietet. Die wirklichen
Geishakimonos sind nur bemalt, weshalb sie aber durchaus nicht billiger
sind, im Gegenteil waren die Geishas und Maykos in Japan wegen ihres
Luxus von jeher berüchtigt und sind es heute noch so sehr, daß während
der letzten Anwesenheit des Verfassers die japanische Aufsichtsbehörde,
welcher die Geishahäuser unterstehen, eine Vorschrift erließ, nach welcher
die Geishas nicht mehr als sechshundert Jen, das heißt etwa zwölfhundert