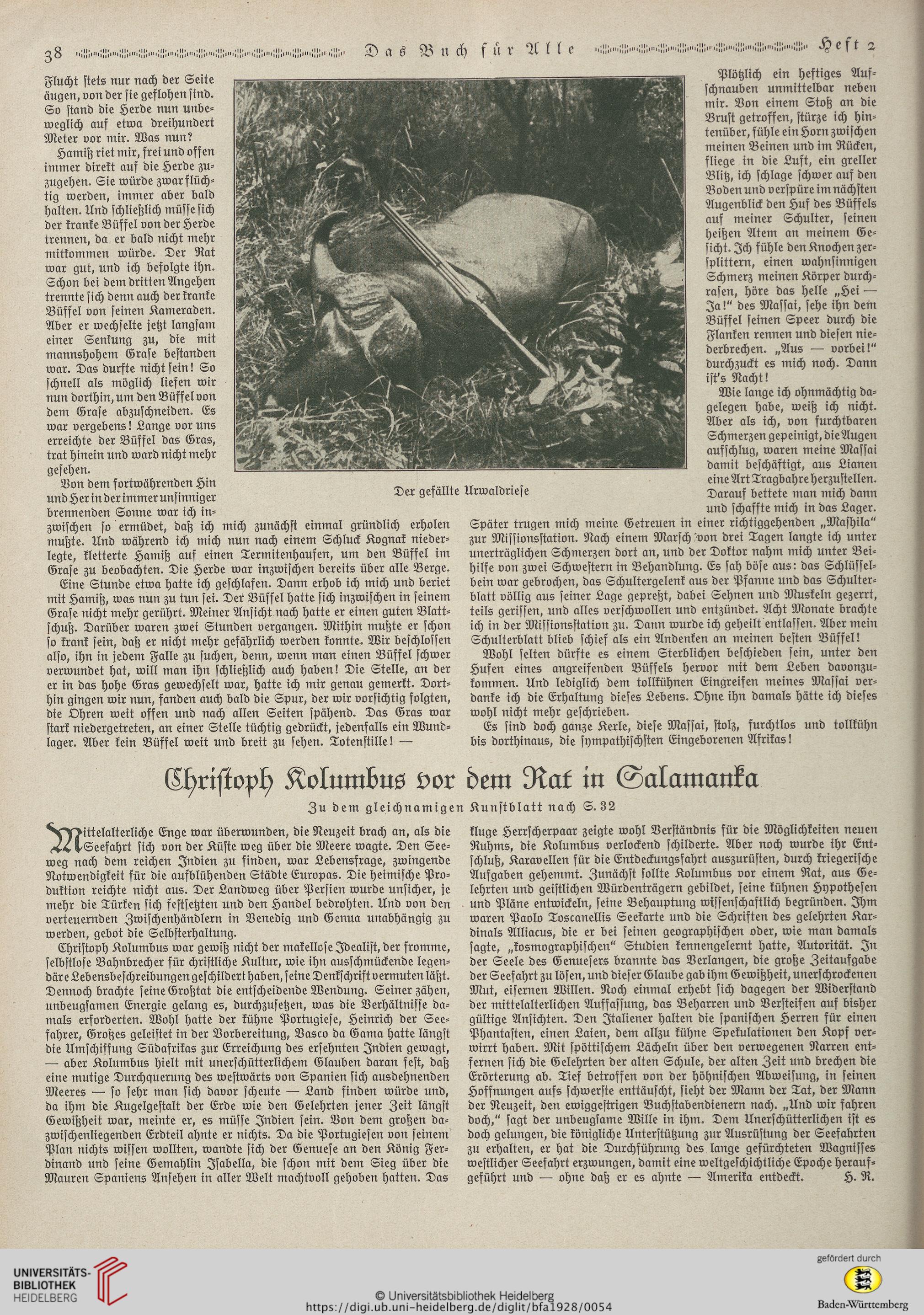Das Buch für Alle
Heft 2
Flucht stets nur nach der Seite
äugen, von der sie geflohen sind.
So stand die Herde nun unbe¬
weglich auf etwa dreihundert
Meter vor mir. Was nun?
Kannst riet mir, frei und offen
immer direkt auf die Herde zu-
zugehen. Sie würde zwar flüch¬
tig werden, immer aber bald
halten. Und schliestlich müsse sich
der kranke Büffel von der Herde
trennen, da er bald nicht mehr
mitkommen würde. Der Rat
war gut, und ich befolgte ihn.
Schon bei dem dritten Angehen
trennte sich denn auch der kranke
Büffel von seinen Kameraden.
Aber er wechselte jetzt langsam
einer Senkung zu, die mit
mannshohem Grase bestanden
war. Das durfte nicht sein! So
schnell als möglich liefen wir
nun dorthin, um den Büffel von
dem Grase abzuschneiden. Es
war vergebens! Lange vor uns
erreichte der Büffel das Gras,
trat hinein und ward nicht mehr
gesehen.
Von dem fortwährenden Hin
und Her in der immer unsinniger
brennenden Sonne war ich in¬
zwischen so ermüdet, dast ich mich zunächst einmal gründlich erholen
mutzte. Und während ich mich nun nach einem Schluck Kognak nieder-
legte, kletterte Kannst auf einen Termitenhaufen, um den Büffel im
Grase zu beobachten. Die Herde war inzwischen bereits über alle Berge.
Eine Stunde etwa hatte ich geschlafen. Dann erhob ich mich und beriet
mit Kannst, was nun zu tun sei. Der Büffel hatte sich inzwischen in seinem
Grase nicht mehr gerührt. Meiner Ansicht nach hatte er einen guten Blatt-
schust. Darüber waren zwei Stunden vergangen. Mithin mustte er schon
so krank sein, dast er nicht mehr gefährlich werden konnte. Wir beschlossen
also, ihn in jedem Falle zu suchen, denn, wenn man einen Büffel schwer
verwundet hat, will man ihn schliestlich auch haben! Die Stelle, an der
er in das hohe Gras gewechselt war, hatte ich mir genau gemerkt. Dort-
hin gingen wir nun, fanden auch bald die Spur, der wir vorsichtig folgten,
die Ohren weit offen und nach allen Seiten spähend. Das Gras war
stark niedergetreten, an einer Stelle tüchtig gedrückt, jedenfalls ein Wund-
lager. Aber kein Büffel weit und breit zu sehen. Totenstille! —
Plötzlich ein heftiges Auf-
schnauben unmittelbar neben
mir. Von einem Stotz an die
Brust getroffen, stürze ich hin-
tenüber, fühle ein Horn zwischen
meinen Beinen und im Rücken,
fliege in die Luft, ein greller
Blitz, ich schlage schwer auf den
Boden und verspüre im nächsten
Augenblick den Huf des Büffels
auf meiner Schulter, seinen
heitzen Atem an meinem Ge-
sicht. Ich fühle den Knochen zer-
splittern, einen wahnsinnigen
Schmerz meinen Körper durch-
rasen, höre das Helle „Hei —
Ja!" des Massai, sehe ihn dem
Büffel seinen Speer durch die
Flanken rennen und diesen nie-
derbrechen. „Aus — vorbei!"
durchzuckt es mich noch. Dann
ist's Nacht!
Wie lange ich ohnmächtig da-
gelegen habe, weitz ich nicht.
Aber als ich, von furchtbaren
Schmerzen gepeinigt, dieAugen
aufschlug, waren meine Massai
damit beschäftigt, aus Lianen
eine Art Tragbahre herzustellen.
Darauf bettete man mich dann
und schaffte mich in das Lager.
Später trugen mich meine Getreuen in einer richtiggehenden „Mashila"
zur Missionsstation. Nach einem Marsch von drei Tagen langte ich unter
unerträglichen Schmerzen dort an, und der Doktor nahm mich unter Bei-
hilfe von zwei Schwestern in Behandlung. Es sah böse aus: das Schlüssel-
bein war gebrochen, das Schultergelenk aus der Pfanne und das Schulter-
blatt völlig aus seiner Lage gepretzt, dabei Sehnen und Muskeln gezerrt,
teils gerissen, und alles verschwollen und entzündet. Acht Monate brachte
ich in der Missionsstation zu. Dann wurde ich geheilt entlassen. Aber mein
Schulterblatt blieb schief als ein Andenken an meinen besten Büffel!
Wohl selten dürfte es einem Sterblichen beschieden sein, unter den
Hufen eines angreifenden Büffels hervor mit dem Leben davonzu-
kommen. Und lediglich dem tollkühnen Eingreifen meines Massai ver-
danke ich die Erhaltung dieses Lebens. Ohne ihn damals hätte ich dieses
wohl nicht mehr geschrieben.
Es sind doch ganze Kerle, diese Massai, stolz, furchtlos und tollkühn
bis dorthinaus, die sympathischsten Eingeborenen Afrikas!
Der gefällte Urwaldriese
Christoph Kolumbus vor dem Rat in Salamanka
Zu dem gleichnamigen Kunstblatt nach S. 32
ittelalterliche Enge war überwunden, die Neuzeit brach an, als die
Seefahrt sich von der Küste weg über die Meere wagte. Den See-
weg nach dem reichen Indien zu finden, war Lebensfrage, zwingende
Notwendigkeit für die aufblühenden Städte Europas. Die heimische Pro-
duktion reichte nicht aus. Der Landweg über Persien wurde unsicher, je
mehr die Türken sich festsetzten und den Handel bedrohten. Und von den
verteuernden Zwischenhändlern in Venedig und Genua unabhängig zu
werden, gebot die Selbsterhaltung.
Christoph Kolumbus war gewitz nicht der makellose Idealist, der fromme,
selbstlose Bahnbrecher für christliche Kultur, wie ihn ausschmückende legen-
däre Lebensbeschreibungen geschildert haben, seine Denkschrift vermuten lätzt.
Dennoch brachte seine Grotztat die entscheidende Wendung. Seiner zähen,
unbeugsamen Energie gelang es, durchzusetzen, was die Verhältnisse da-
mals erforderten. Wohl hatte der kühne Portugiese, Heinrich der See-
fahrer, Trotzes geleistet in der Vorbereitung, Vasco da Gama hatte längst
die Umschiffung Südafrikas zur Erreichung des ersehnten Indien gewagt,
— aber Kolumbus hielt mit unerschütterlichem Glauben daran fest, datz
eine mutige Durchquerung des westwärts von Spanien sich ausdehnenden
Meeres — so sehr man sich davor scheute — Land finden würde und,
da ihm die Kugelgestalt der Erde wie den Gelehrten jener Zeit längst
Gewitzheit war, meinte er, es müsse Indien sein. Von dem großen da-
zwischenliegenden Erdteil ahnte er nichts. Da die Portugiesen von seinem
Plan nichts wissen wollten, wandte sich der Genuese an den König Fer-
dinand und seine Gemahlin Isabella, die schon mit dem Sieg über die
Mauren Spaniens Ansehen in aller Welt machtvoll gehoben hatten. Das
kluge Herrscherpaar zeigte wohl Verständnis für die Möglichkeiten neuen
Ruhms, die Kolumbus verlockend schilderte. Aber noch wurde ihr Ent-
schluß, Karavellen für die Entdeckungsfahrt auszurüsten, durch kriegerische
Aufgaben gehemmt. Zunächst sollte Kolumbus vor einem Rat, aus Ge-
lehrten und geistlichen Würdenträgern gebildet, seine kühnen Hypothesen
und Pläne entwickeln, seine Behauptung wissenschaftlich begründen. Ihm
waren Paolo Toscanellis Seekarte und die Schriften des gelehrten Kar-
dinals Alliacus, die er bei seinen geographischen oder, wie man damals
sagte, „kosmo graphisch en" Studien kennengelernt hatte, Autorität. In
der Seele des Eenuesers brannte das Verlangen, die große Zeitaufgabe
der Seefahrt zu lösen, und dieser Glaube gab ihm Gewißheit, unerschrockenen
Mut, eisernen Willen. Noch einmal erhebt sich dagegen der Widerstand
der mittelalterlichen Auffassung, das Beharren und Versteifen auf bisher
gültige Ansichten. Den Italiener halten die spanischen Herren für einen
Phantasten, einen Laien, dem allzu kühne Spekulationen den Kopf ver-
wirrt haben. Mit spöttischem Lächeln über den verwegenen Narren ent-
fernen sich die Gelehrten der alten Schule, der alten Zeit und brechen die
Erörterung ab. Tief betroffen von der höhnischen Abweisung, in seinen
Hoffnungen aufs schwerste enttäuscht, sieht der Mann der Tat, der Mann
der Neuzeit, den ewiggestrigen Buchstabendienern nach. „Und wir fahren
doch," sagt der unbeugsame Wille in ihm. Dem Unerschütterlichen ist es
doch gelungen, die königliche Unterstützung zur Ausrüstung der Seefahrten
zu erhalten, er hat die Durchführung des lange gefürchteten Wagnisses
westlicher Seefahrt erzwungen, damit eine weltgeschichtliche Epoche herauf-
geführt und — ohne dast er es ahnte — Amerika entdeckt. H. R.
Heft 2
Flucht stets nur nach der Seite
äugen, von der sie geflohen sind.
So stand die Herde nun unbe¬
weglich auf etwa dreihundert
Meter vor mir. Was nun?
Kannst riet mir, frei und offen
immer direkt auf die Herde zu-
zugehen. Sie würde zwar flüch¬
tig werden, immer aber bald
halten. Und schliestlich müsse sich
der kranke Büffel von der Herde
trennen, da er bald nicht mehr
mitkommen würde. Der Rat
war gut, und ich befolgte ihn.
Schon bei dem dritten Angehen
trennte sich denn auch der kranke
Büffel von seinen Kameraden.
Aber er wechselte jetzt langsam
einer Senkung zu, die mit
mannshohem Grase bestanden
war. Das durfte nicht sein! So
schnell als möglich liefen wir
nun dorthin, um den Büffel von
dem Grase abzuschneiden. Es
war vergebens! Lange vor uns
erreichte der Büffel das Gras,
trat hinein und ward nicht mehr
gesehen.
Von dem fortwährenden Hin
und Her in der immer unsinniger
brennenden Sonne war ich in¬
zwischen so ermüdet, dast ich mich zunächst einmal gründlich erholen
mutzte. Und während ich mich nun nach einem Schluck Kognak nieder-
legte, kletterte Kannst auf einen Termitenhaufen, um den Büffel im
Grase zu beobachten. Die Herde war inzwischen bereits über alle Berge.
Eine Stunde etwa hatte ich geschlafen. Dann erhob ich mich und beriet
mit Kannst, was nun zu tun sei. Der Büffel hatte sich inzwischen in seinem
Grase nicht mehr gerührt. Meiner Ansicht nach hatte er einen guten Blatt-
schust. Darüber waren zwei Stunden vergangen. Mithin mustte er schon
so krank sein, dast er nicht mehr gefährlich werden konnte. Wir beschlossen
also, ihn in jedem Falle zu suchen, denn, wenn man einen Büffel schwer
verwundet hat, will man ihn schliestlich auch haben! Die Stelle, an der
er in das hohe Gras gewechselt war, hatte ich mir genau gemerkt. Dort-
hin gingen wir nun, fanden auch bald die Spur, der wir vorsichtig folgten,
die Ohren weit offen und nach allen Seiten spähend. Das Gras war
stark niedergetreten, an einer Stelle tüchtig gedrückt, jedenfalls ein Wund-
lager. Aber kein Büffel weit und breit zu sehen. Totenstille! —
Plötzlich ein heftiges Auf-
schnauben unmittelbar neben
mir. Von einem Stotz an die
Brust getroffen, stürze ich hin-
tenüber, fühle ein Horn zwischen
meinen Beinen und im Rücken,
fliege in die Luft, ein greller
Blitz, ich schlage schwer auf den
Boden und verspüre im nächsten
Augenblick den Huf des Büffels
auf meiner Schulter, seinen
heitzen Atem an meinem Ge-
sicht. Ich fühle den Knochen zer-
splittern, einen wahnsinnigen
Schmerz meinen Körper durch-
rasen, höre das Helle „Hei —
Ja!" des Massai, sehe ihn dem
Büffel seinen Speer durch die
Flanken rennen und diesen nie-
derbrechen. „Aus — vorbei!"
durchzuckt es mich noch. Dann
ist's Nacht!
Wie lange ich ohnmächtig da-
gelegen habe, weitz ich nicht.
Aber als ich, von furchtbaren
Schmerzen gepeinigt, dieAugen
aufschlug, waren meine Massai
damit beschäftigt, aus Lianen
eine Art Tragbahre herzustellen.
Darauf bettete man mich dann
und schaffte mich in das Lager.
Später trugen mich meine Getreuen in einer richtiggehenden „Mashila"
zur Missionsstation. Nach einem Marsch von drei Tagen langte ich unter
unerträglichen Schmerzen dort an, und der Doktor nahm mich unter Bei-
hilfe von zwei Schwestern in Behandlung. Es sah böse aus: das Schlüssel-
bein war gebrochen, das Schultergelenk aus der Pfanne und das Schulter-
blatt völlig aus seiner Lage gepretzt, dabei Sehnen und Muskeln gezerrt,
teils gerissen, und alles verschwollen und entzündet. Acht Monate brachte
ich in der Missionsstation zu. Dann wurde ich geheilt entlassen. Aber mein
Schulterblatt blieb schief als ein Andenken an meinen besten Büffel!
Wohl selten dürfte es einem Sterblichen beschieden sein, unter den
Hufen eines angreifenden Büffels hervor mit dem Leben davonzu-
kommen. Und lediglich dem tollkühnen Eingreifen meines Massai ver-
danke ich die Erhaltung dieses Lebens. Ohne ihn damals hätte ich dieses
wohl nicht mehr geschrieben.
Es sind doch ganze Kerle, diese Massai, stolz, furchtlos und tollkühn
bis dorthinaus, die sympathischsten Eingeborenen Afrikas!
Der gefällte Urwaldriese
Christoph Kolumbus vor dem Rat in Salamanka
Zu dem gleichnamigen Kunstblatt nach S. 32
ittelalterliche Enge war überwunden, die Neuzeit brach an, als die
Seefahrt sich von der Küste weg über die Meere wagte. Den See-
weg nach dem reichen Indien zu finden, war Lebensfrage, zwingende
Notwendigkeit für die aufblühenden Städte Europas. Die heimische Pro-
duktion reichte nicht aus. Der Landweg über Persien wurde unsicher, je
mehr die Türken sich festsetzten und den Handel bedrohten. Und von den
verteuernden Zwischenhändlern in Venedig und Genua unabhängig zu
werden, gebot die Selbsterhaltung.
Christoph Kolumbus war gewitz nicht der makellose Idealist, der fromme,
selbstlose Bahnbrecher für christliche Kultur, wie ihn ausschmückende legen-
däre Lebensbeschreibungen geschildert haben, seine Denkschrift vermuten lätzt.
Dennoch brachte seine Grotztat die entscheidende Wendung. Seiner zähen,
unbeugsamen Energie gelang es, durchzusetzen, was die Verhältnisse da-
mals erforderten. Wohl hatte der kühne Portugiese, Heinrich der See-
fahrer, Trotzes geleistet in der Vorbereitung, Vasco da Gama hatte längst
die Umschiffung Südafrikas zur Erreichung des ersehnten Indien gewagt,
— aber Kolumbus hielt mit unerschütterlichem Glauben daran fest, datz
eine mutige Durchquerung des westwärts von Spanien sich ausdehnenden
Meeres — so sehr man sich davor scheute — Land finden würde und,
da ihm die Kugelgestalt der Erde wie den Gelehrten jener Zeit längst
Gewitzheit war, meinte er, es müsse Indien sein. Von dem großen da-
zwischenliegenden Erdteil ahnte er nichts. Da die Portugiesen von seinem
Plan nichts wissen wollten, wandte sich der Genuese an den König Fer-
dinand und seine Gemahlin Isabella, die schon mit dem Sieg über die
Mauren Spaniens Ansehen in aller Welt machtvoll gehoben hatten. Das
kluge Herrscherpaar zeigte wohl Verständnis für die Möglichkeiten neuen
Ruhms, die Kolumbus verlockend schilderte. Aber noch wurde ihr Ent-
schluß, Karavellen für die Entdeckungsfahrt auszurüsten, durch kriegerische
Aufgaben gehemmt. Zunächst sollte Kolumbus vor einem Rat, aus Ge-
lehrten und geistlichen Würdenträgern gebildet, seine kühnen Hypothesen
und Pläne entwickeln, seine Behauptung wissenschaftlich begründen. Ihm
waren Paolo Toscanellis Seekarte und die Schriften des gelehrten Kar-
dinals Alliacus, die er bei seinen geographischen oder, wie man damals
sagte, „kosmo graphisch en" Studien kennengelernt hatte, Autorität. In
der Seele des Eenuesers brannte das Verlangen, die große Zeitaufgabe
der Seefahrt zu lösen, und dieser Glaube gab ihm Gewißheit, unerschrockenen
Mut, eisernen Willen. Noch einmal erhebt sich dagegen der Widerstand
der mittelalterlichen Auffassung, das Beharren und Versteifen auf bisher
gültige Ansichten. Den Italiener halten die spanischen Herren für einen
Phantasten, einen Laien, dem allzu kühne Spekulationen den Kopf ver-
wirrt haben. Mit spöttischem Lächeln über den verwegenen Narren ent-
fernen sich die Gelehrten der alten Schule, der alten Zeit und brechen die
Erörterung ab. Tief betroffen von der höhnischen Abweisung, in seinen
Hoffnungen aufs schwerste enttäuscht, sieht der Mann der Tat, der Mann
der Neuzeit, den ewiggestrigen Buchstabendienern nach. „Und wir fahren
doch," sagt der unbeugsame Wille in ihm. Dem Unerschütterlichen ist es
doch gelungen, die königliche Unterstützung zur Ausrüstung der Seefahrten
zu erhalten, er hat die Durchführung des lange gefürchteten Wagnisses
westlicher Seefahrt erzwungen, damit eine weltgeschichtliche Epoche herauf-
geführt und — ohne dast er es ahnte — Amerika entdeckt. H. R.