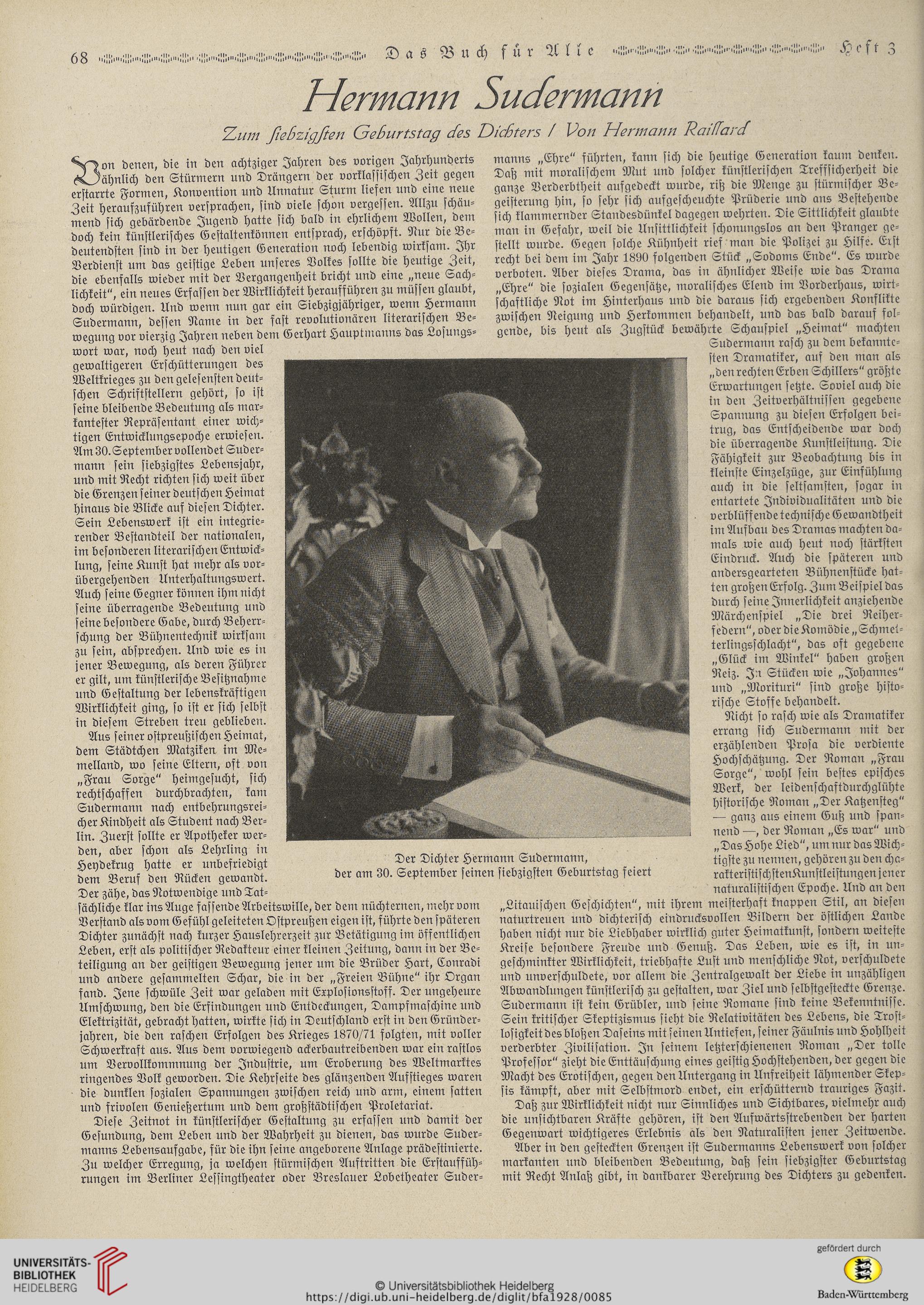68
Das Buch für Alle
^7/777 ^^27^7/^77 (5^5//-/^/^ <2^L / ^L>77 //^7V77777777 ^7/^77'-/
on denen, die in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
ähnlich den Stürmern und Drängern der vorklassischen Zeit gegen
erstarrte Formen, Konvention und Unnatur Sturm liefen und eine neue
Zeit heraufzuführen versprachen, sind viele schon vergessen. Allzu schäu-
mend sich gebärdende Jugend hatte sich bald in ehrlichem Wollen, dem
doch kein künstlerisches Gestaltenkönnen entsprach, erschöpft. Nur die Be-
deutendsten sind in der heutigen Generation noch lebendig wirksam. Ihr
Verdienst um das geistige Leben unseres Volkes sollte die heutige Zeit,
die ebenfalls wieder mit der Vergangenheit bricht und eine „neue Sach-
lichkeit", ein neues Erfassen der Wirklichkeit heraufführen zu müssen glaubt,
doch würdigen. Und wenn nun gar ein Siebzigjähriger, wenn Hermann
Sudermann, dessen Name in der fast revolutionären literarischen Be-
wegung vor vierzig Jahren neben dem Gerhart Hauptmanns das Losungs-
wort war, noch heut nach den viel
gewaltigeren Erschütterungen des
Weltkrieges zu den gelesenstendeut¬
schen Schriftstellern gehört, so ist
seine bleibende Bedeutung als mar¬
kantester Repräsentant einer wich¬
tigen Entwicklungsepoche erwiesen.
Am 30. S eptemb er vollend et Sud er¬
mann sein siebzigstes Lebensjahr,
und mit Recht richten sich weit über
die Grenzen seiner deutschen Heimat
hinaus die Blicke auf diesen Dichter.
Sein Lebenswerk ist ein integrie¬
render Bestandteil der nationalen,
im besonderen literarischen Entwick¬
lung, seine Kunst hat mehr als vor¬
übergehenden Unterhaltungswert.
Auch seine Gegner können ihm nicht
seine überragende Bedeutung und
seine besondere Gabe, durch Beherr¬
schung der Bühnentechnik wirksam
zu sein, absprechen. Und wie es in
jener Bewegung, als deren Führer
er gilt, um künstlerische Besitznahme
und Gestaltung der lebenskräftigen
Wirklichkeit ging, so ist er sich selbst
in diesem Streben treu geblieben.
Aus seiner ostpreußischen Heimat,
dem Städtchen Matziken im Me¬
melland, wo seine Eltern, oft von
„Frau Sorge" heimgesucht, sich
rechtschaffen durchbrachten, kam
Sudermann nach entbehrungsrei¬
cher Kindheit als Student nach Ber¬
lin. Zuerst sollte er Apotheker wer¬
den, aber schon als Lehrling in
Heydekrug hatte er unbefriedigt
dem Beruf den Rücken gewandt.
Der zähe, das Notwendige und Tat-
sächliche klar ins Auge fassende Arbeitswille, der dem nüchternen, mehr vom
Verstand als vom Gefühl geleiteten Ostpreußen eigen ist, führte den späteren
Dichter zunächst nach kurzer Hauslehrerzeit zur Betätigung im öffentlichen
Leben, erst als politischer Redakteur einer kleinen Zeitung, dann in der Be-
teiligung an der geistigen Bewegung jener um die Brüder Hart, Conradi
und andere gesammelten Schar, die in der „Freien Bühne" ihr Organ
fand. Jene schwüle Zeit war geladen mit Erplosionsstoff. Der ungeheure
Umschwung, den die Erfindungen und Entdeckungen, Dampfmaschine und
Elektrizität, gebracht hatten, wirkte sich in Deutschland erst in den Gründer-
jahren, die den raschen Erfolgen des Krieges 1870/71 folgten, mit voller
Schwerkraft aus. Aus dem vorwiegend ackerbautreibenden war ein rastlos
um Vervollkommnung der Industrie, um Eroberung des Weltmarktes
ringendes Volk geworden. Die Kehrseite des glänzenden Aufstieges waren
die dunklen sozialen Spannungen zwischen reich und arm, einem satten
und frivolen Genießertum und dem großstädtischen Proletariat.
Diese Zeitnot in künstlerischer Gestaltung zu erfassen und damit der
Gesundung, dem Leben und der Wahrheit zu dienen, das wurde Suder-
manns Lebensaufgabe, für die ihn seine angeborene Anlage prädestinierte.
Zu welcher Erregung, ja welchen stürmischen Auftritten die Erstauffüh-
rungen im Berliner Lessingtheater oder Breslauer Lobetheater Suder-
manns „Ehre" führten, kann sich die heutige Generation kaum denken.
Daß mit moralischem Mut und solcher künstlerischen Treffsicherheit die
ganze Verderbtheit aufgedeckt wurde, riß die Menge zu stürmischer Be-
geisterung hin, so sehr sich aufgescheuchte Prüderie und ans Bestehende
sich klammernder Standesdünkel dagegen wehrten. Die Sittlichkeit glaubte
man in Gefahr, weil die Unsittlichkeit schonungslos an den Pranger ge-
stellt wurde. Gegen solche Kühnheit rief man die Polizei zu Hilfe. Erst
recht bei dem im Jahr 1890 folgenden Stück „Sodoms Ende". Es wurde
verboten. Aber dieses Drama, das in ähnlicher Weise wie das Drama
„Ehre" die sozialen Gegensätze, moralisches Elend im Vorderhaus, wirt-
schaftliche Not im Hinterhaus und die daraus sich ergebenden Konflikte
zwischen Neigung und Herkommen behandelt, und das bald darauf fol-
gende, bis heut als Zugstück bewährte Schauspiel „Heimat" machten
Sudermann rasch zu dem bekannte-
sten Dramatiker, auf den man als
„den rechten Erben Schillers" größte
Erwartungen setzte. Soviel auch die
in den Zeitverhältnissen gegebene
Spannung zu diesen Erfolgen bei-
trug, das Entscheidende war doch
die überragende Kunstleistung. Die
Fähigkeit zur Beobachtung bis in
kleinste Einzelzüge, zur Einfühlung
auch in die seltsamsten, sogar in
entartete Individualitäten und die
verblüffende technische Gewandtheit
im Aufbau des Dramas machten da-
mals wie auch heut noch stärksten
Eindruck. Auch die späteren und
andersgearteten Bühnenstücke hat-
ten großer: Erfolg. Zum Beispiel das
durch seine Innerlichkeit anziehende
Märchenspiel „Die drei Reiher-
federn", oder die Komödie „Schmet-
terlingsschlacht", das oft gegebene
„Glück im Winkel" haben großen
Reiz. In Stücken wie „Johannes"
und „Morituri" sind große histo-
rische Stoffe behandelt.
Nicht so rasch wie als Dramatiker
errang sich Sudermann nut der
erzählenden Prosa die verdiente
Hochschätzung. Der Roman „Frau
Sorge", wohl sein bestes episches
Werk, der leidenschaftdurchglühte
historische Roman „Der Katzensteg"
— ganz aus einem Guß und span-
nend —, der Roman „Es war" und
„Das Hohe Lied", um nur das Wich-
tigste zu nennen, gehören zu den cha-
rakteristisch st enKunstl ei stung enjen er
naturalistischen Epoche. Und an den
„Litauischen Geschichten", mit ihrem meisterhaft knappen Stil, an diesen
naturtreuen und dichterisch eindrucksvollen Bildern der östlichen Lande
haben nicht nur die Liebhaber wirklich guter Heimatkunst, sondern weiteste
Kreise besondere Freude und Genuß. Das Leben, wie es ist, in un-
geschminkter Wirklichkeit, triebhafte Lust und menschliche Not, verschuldete
und unverschuldete, vor allem die Zentralgewalt der Liebe in unzähligen
Abwandlungen künstlerisch zu gestalten, war Ziel und selbstgesteckte Grenze.
Sudermann ist kein Grübler, und seine Romane sind keine Bekenntnisse.
Sein kritischer Skeptizismus sieht die Relativitäten des Lebens, die Trost-
losigkeit des bloßen Daseins mit seinen Untiefen, seiner Fäulnis und Hohlheit
verderbter Zivilisation. In seinen: letzterschienenen Roman „Der tolle
Professor" zieht die Enttäuschung eines geistig Hochstehenden, der gegen die
Macht des Erotischen, gegen den Untergang in Unfreiheit lähmender Skep-
sis kämpft, aber mit Selbstmord endet, ein erschütternd trauriges Fazit.
Daß zur Wirklichkeit nicht nur Sinnliches und Sichtbares, vielmehr auch
die unsichtbaren Kräfte gehören, ist den Aufwärtsstrebenden der harten
Gegenwart wichtigeres Erlebnis als den Naturalisten jener Zeitwende.
Aber in den gesteckten Grenzen ist Sudermanns Lebenswerk von solcher
markanten und bleibenden Bedeutung, daß sein siebzigster Geburtstag
mit Recht Anlaß gibt, in dankbarer Verehrung des Dichters zu gedenken.
Der Dichter Hermann Sudermann,
der am 30. September seinen siebzigsten Geburtstag feiert
Das Buch für Alle
^7/777 ^^27^7/^77 (5^5//-/^/^ <2^L / ^L>77 //^7V77777777 ^7/^77'-/
on denen, die in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
ähnlich den Stürmern und Drängern der vorklassischen Zeit gegen
erstarrte Formen, Konvention und Unnatur Sturm liefen und eine neue
Zeit heraufzuführen versprachen, sind viele schon vergessen. Allzu schäu-
mend sich gebärdende Jugend hatte sich bald in ehrlichem Wollen, dem
doch kein künstlerisches Gestaltenkönnen entsprach, erschöpft. Nur die Be-
deutendsten sind in der heutigen Generation noch lebendig wirksam. Ihr
Verdienst um das geistige Leben unseres Volkes sollte die heutige Zeit,
die ebenfalls wieder mit der Vergangenheit bricht und eine „neue Sach-
lichkeit", ein neues Erfassen der Wirklichkeit heraufführen zu müssen glaubt,
doch würdigen. Und wenn nun gar ein Siebzigjähriger, wenn Hermann
Sudermann, dessen Name in der fast revolutionären literarischen Be-
wegung vor vierzig Jahren neben dem Gerhart Hauptmanns das Losungs-
wort war, noch heut nach den viel
gewaltigeren Erschütterungen des
Weltkrieges zu den gelesenstendeut¬
schen Schriftstellern gehört, so ist
seine bleibende Bedeutung als mar¬
kantester Repräsentant einer wich¬
tigen Entwicklungsepoche erwiesen.
Am 30. S eptemb er vollend et Sud er¬
mann sein siebzigstes Lebensjahr,
und mit Recht richten sich weit über
die Grenzen seiner deutschen Heimat
hinaus die Blicke auf diesen Dichter.
Sein Lebenswerk ist ein integrie¬
render Bestandteil der nationalen,
im besonderen literarischen Entwick¬
lung, seine Kunst hat mehr als vor¬
übergehenden Unterhaltungswert.
Auch seine Gegner können ihm nicht
seine überragende Bedeutung und
seine besondere Gabe, durch Beherr¬
schung der Bühnentechnik wirksam
zu sein, absprechen. Und wie es in
jener Bewegung, als deren Führer
er gilt, um künstlerische Besitznahme
und Gestaltung der lebenskräftigen
Wirklichkeit ging, so ist er sich selbst
in diesem Streben treu geblieben.
Aus seiner ostpreußischen Heimat,
dem Städtchen Matziken im Me¬
melland, wo seine Eltern, oft von
„Frau Sorge" heimgesucht, sich
rechtschaffen durchbrachten, kam
Sudermann nach entbehrungsrei¬
cher Kindheit als Student nach Ber¬
lin. Zuerst sollte er Apotheker wer¬
den, aber schon als Lehrling in
Heydekrug hatte er unbefriedigt
dem Beruf den Rücken gewandt.
Der zähe, das Notwendige und Tat-
sächliche klar ins Auge fassende Arbeitswille, der dem nüchternen, mehr vom
Verstand als vom Gefühl geleiteten Ostpreußen eigen ist, führte den späteren
Dichter zunächst nach kurzer Hauslehrerzeit zur Betätigung im öffentlichen
Leben, erst als politischer Redakteur einer kleinen Zeitung, dann in der Be-
teiligung an der geistigen Bewegung jener um die Brüder Hart, Conradi
und andere gesammelten Schar, die in der „Freien Bühne" ihr Organ
fand. Jene schwüle Zeit war geladen mit Erplosionsstoff. Der ungeheure
Umschwung, den die Erfindungen und Entdeckungen, Dampfmaschine und
Elektrizität, gebracht hatten, wirkte sich in Deutschland erst in den Gründer-
jahren, die den raschen Erfolgen des Krieges 1870/71 folgten, mit voller
Schwerkraft aus. Aus dem vorwiegend ackerbautreibenden war ein rastlos
um Vervollkommnung der Industrie, um Eroberung des Weltmarktes
ringendes Volk geworden. Die Kehrseite des glänzenden Aufstieges waren
die dunklen sozialen Spannungen zwischen reich und arm, einem satten
und frivolen Genießertum und dem großstädtischen Proletariat.
Diese Zeitnot in künstlerischer Gestaltung zu erfassen und damit der
Gesundung, dem Leben und der Wahrheit zu dienen, das wurde Suder-
manns Lebensaufgabe, für die ihn seine angeborene Anlage prädestinierte.
Zu welcher Erregung, ja welchen stürmischen Auftritten die Erstauffüh-
rungen im Berliner Lessingtheater oder Breslauer Lobetheater Suder-
manns „Ehre" führten, kann sich die heutige Generation kaum denken.
Daß mit moralischem Mut und solcher künstlerischen Treffsicherheit die
ganze Verderbtheit aufgedeckt wurde, riß die Menge zu stürmischer Be-
geisterung hin, so sehr sich aufgescheuchte Prüderie und ans Bestehende
sich klammernder Standesdünkel dagegen wehrten. Die Sittlichkeit glaubte
man in Gefahr, weil die Unsittlichkeit schonungslos an den Pranger ge-
stellt wurde. Gegen solche Kühnheit rief man die Polizei zu Hilfe. Erst
recht bei dem im Jahr 1890 folgenden Stück „Sodoms Ende". Es wurde
verboten. Aber dieses Drama, das in ähnlicher Weise wie das Drama
„Ehre" die sozialen Gegensätze, moralisches Elend im Vorderhaus, wirt-
schaftliche Not im Hinterhaus und die daraus sich ergebenden Konflikte
zwischen Neigung und Herkommen behandelt, und das bald darauf fol-
gende, bis heut als Zugstück bewährte Schauspiel „Heimat" machten
Sudermann rasch zu dem bekannte-
sten Dramatiker, auf den man als
„den rechten Erben Schillers" größte
Erwartungen setzte. Soviel auch die
in den Zeitverhältnissen gegebene
Spannung zu diesen Erfolgen bei-
trug, das Entscheidende war doch
die überragende Kunstleistung. Die
Fähigkeit zur Beobachtung bis in
kleinste Einzelzüge, zur Einfühlung
auch in die seltsamsten, sogar in
entartete Individualitäten und die
verblüffende technische Gewandtheit
im Aufbau des Dramas machten da-
mals wie auch heut noch stärksten
Eindruck. Auch die späteren und
andersgearteten Bühnenstücke hat-
ten großer: Erfolg. Zum Beispiel das
durch seine Innerlichkeit anziehende
Märchenspiel „Die drei Reiher-
federn", oder die Komödie „Schmet-
terlingsschlacht", das oft gegebene
„Glück im Winkel" haben großen
Reiz. In Stücken wie „Johannes"
und „Morituri" sind große histo-
rische Stoffe behandelt.
Nicht so rasch wie als Dramatiker
errang sich Sudermann nut der
erzählenden Prosa die verdiente
Hochschätzung. Der Roman „Frau
Sorge", wohl sein bestes episches
Werk, der leidenschaftdurchglühte
historische Roman „Der Katzensteg"
— ganz aus einem Guß und span-
nend —, der Roman „Es war" und
„Das Hohe Lied", um nur das Wich-
tigste zu nennen, gehören zu den cha-
rakteristisch st enKunstl ei stung enjen er
naturalistischen Epoche. Und an den
„Litauischen Geschichten", mit ihrem meisterhaft knappen Stil, an diesen
naturtreuen und dichterisch eindrucksvollen Bildern der östlichen Lande
haben nicht nur die Liebhaber wirklich guter Heimatkunst, sondern weiteste
Kreise besondere Freude und Genuß. Das Leben, wie es ist, in un-
geschminkter Wirklichkeit, triebhafte Lust und menschliche Not, verschuldete
und unverschuldete, vor allem die Zentralgewalt der Liebe in unzähligen
Abwandlungen künstlerisch zu gestalten, war Ziel und selbstgesteckte Grenze.
Sudermann ist kein Grübler, und seine Romane sind keine Bekenntnisse.
Sein kritischer Skeptizismus sieht die Relativitäten des Lebens, die Trost-
losigkeit des bloßen Daseins mit seinen Untiefen, seiner Fäulnis und Hohlheit
verderbter Zivilisation. In seinen: letzterschienenen Roman „Der tolle
Professor" zieht die Enttäuschung eines geistig Hochstehenden, der gegen die
Macht des Erotischen, gegen den Untergang in Unfreiheit lähmender Skep-
sis kämpft, aber mit Selbstmord endet, ein erschütternd trauriges Fazit.
Daß zur Wirklichkeit nicht nur Sinnliches und Sichtbares, vielmehr auch
die unsichtbaren Kräfte gehören, ist den Aufwärtsstrebenden der harten
Gegenwart wichtigeres Erlebnis als den Naturalisten jener Zeitwende.
Aber in den gesteckten Grenzen ist Sudermanns Lebenswerk von solcher
markanten und bleibenden Bedeutung, daß sein siebzigster Geburtstag
mit Recht Anlaß gibt, in dankbarer Verehrung des Dichters zu gedenken.
Der Dichter Hermann Sudermann,
der am 30. September seinen siebzigsten Geburtstag feiert