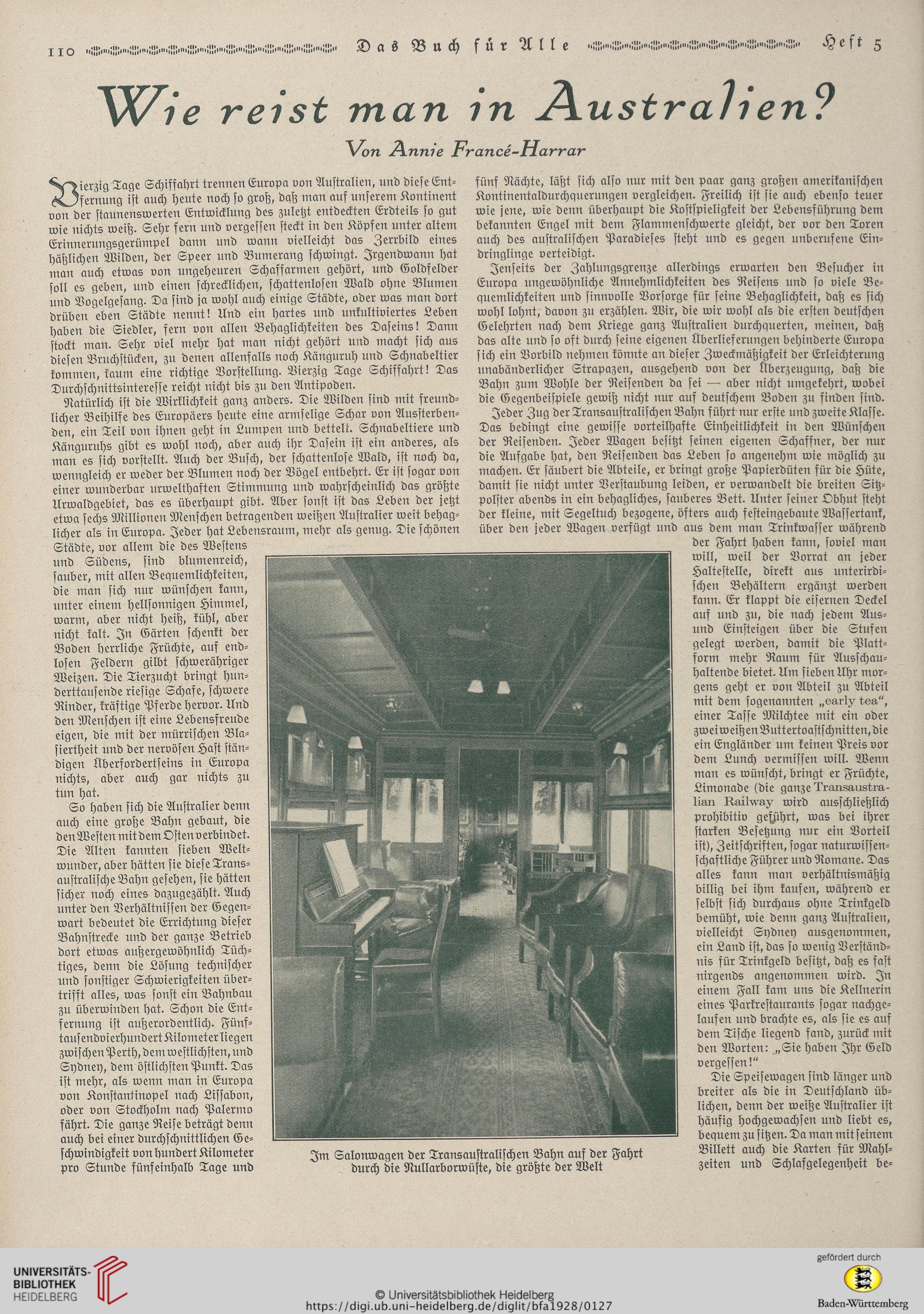Das Buch für Alle
Heft 5
--rcr-r --r
^o-r ^.Tr-r/e /^-aTree-^/cr^cr^
ierzig Tage Schiffahrt trennen Europa von Australien, und diese Ent¬
fernung ist auch heute noch so groß, daß inan auf unserem Kontinent
von der staunenswerten Entwicklung des zuletzt entdeckten Erdteils so gut
wie nichts weiß. Sehr fern und vergessen steckt in den Köpfen unter altem
Erinnerungsgerümpel dann und wann vielleicht das Zerrbild eines
häßlichen Wilden, der Speer und Bumerang schwingt. Irgendwann hat
man auch etwas von ungeheuren Schaffarmen gehört, und Goldfelder
soll es geben, und einen schrecklichen, schattenlosen Wald ohne Blumen
und Vogelgesang. Da sind ja wohl auch einige Städte, oder was man dort
drüben eben Städte nennt! Und ein hartes und unkultiviertes Leben
haben die Siedler, fern von allen Behaglichkeiten des Daseins! Dann
stockt man. Sehr viel mehr hat man nicht gehört und macht sich aus
diesen Bruchstücken, zu denen allenfalls noch Känguruh und Schnabeltier
kommen, kaum eine richtige Vorstellung. Vierzig Tage Schiffahrt! Das
Durchschnittsinteresse reicht nicht bis zu den Antipoden.
Natürlich ist die Wirklichkeit ganz anders. Die Wilden sind mit freund-
licher Beihilfe des Europäers heute eine armselige Schar von Aussterben-
den, ein Teil von ihnen geht in Lumpen und bettelt. Schnabeltiere und
Känguruhs gibt es wohl noch, aber auch ihr Dasein ist ein anderes, als
man es sich vorstellt. Auch der Busch, der schattenlose Wald, ist noch da,
wenngleich er weder der Blumen noch der Vögel entbehrt. Er ist sogar von
einer wunderbar urwelthaften Stimmung und wahrscheinlich das größte
Urwaldgebiet, das es überhaupt gibt. Aber sonst ist das Leben der jetzt
etwa sechs Millionen Menschen betragenden weißen Australier weit behag-
licher als in Europa. Jeder hat Lebensraum, mehr als genug. Die schönen
Städte, vor allem die des Westens
und Südens, sind blumenreich,
sauber, mit allen Bequemlichkeiten,
die man sich nur wünschen kann,
unter einem hellsonnigen Himmel,
warm, aber nicht heiß, kühl, aber
nicht kalt. In Gärten schenkt der
Boden herrliche Früchte, auf end¬
losen Feldern gilbt schwerähriger
Weizen. Die Tierzucht bringt hun¬
derttausende riesige Schafe, schwere
Rinder, kräftige Pferde hervor. Und
den Menschen ist eine Lebensfreude
eigen, die mit der mürrischen Bla¬
siertheit und der nervösen Hast stän¬
digen Uberfordertseins in Europa
nichts, aber auch gar nichts zu
tun hat.
So haben sich die Australier denn
auch eine große Bahn gebaut, die
d en W e st en mit d em O st en v erbind et.
Die Alten kannten sieben Welt¬
wunder, aber hätten sie diese Trans¬
australische Bahn gesehen, sie hätten
sicher noch eines dazugezählt. Auch
unter den Verhältnissen der Gegen¬
wart bedeutet die Errichtung dieser
Bahnstrecke und der ganze Betrieb
dort etwas außergewöhnlich Tüch¬
tiges, denn die Lösung technischer
und sonstiger Schwierigkeiten über¬
trifft alles, was sonst ein Bahnbau
zu überwinden hat. Schon die Ent¬
fernung ist außerordentlich. Fünf¬
tausendvierhundert Kilometer liegen
zwischenPerth, dem westlichsten, und
Sydney, dem östlichsten Punkt. Das
ist mehr, als wenn man in Europa
von Konstantinopel nach Lissabon,
oder von Stockholm nach Palermo
fährt. Die ganze Reise beträgt denn
auch bei einer durchschnittlichen Ge¬
schwindigkeit von hundert Kilometer
pro Stunde fünfeinhalb Tage und
fünf Nächte, läßt sich also nur mit den paar ganz großen amerikanischen
Kontinentaldurchquerungen vergleichen. Freilich ist sie auch ebenso teuer
wie jene, wie denn überhaupt die Kostspieligkeit der Lebensführung dem
bekannten Engel mit dem Flammenschwerte gleicht, der vor den Toren
auch des australischen Paradieses steht und es gegen unberufene Ein-
dringlinge verteidigt.
Jenseits der Zahlungsgrenze allerdings erwarten den Besucher in
Europa ungewöhnliche Annehmlichkeiten des Reisens und so viele Be-
quemlichkeiten und sinnvolle Vorsorge für seine Behaglichkeit, daß es sich
wohl lohnt, davon zu erzählen. Wir, die wir wohl als die ersten deutschen
Gelehrten nach dem Kriege ganz Australien durchquerten, meinen, daß
das alte und so oft durch seine eigenen Überlieferungen behinderte Europa
sich ein Vorbild nehmen könnte an dieser Zweckmäßigkeit der Erleichterung
unabänderlicher Strapazen, ausgehend von der Überzeugung, daß die
Bahn zum Wohle der Reisenden da sei — aber nicht umgekehrt, wobei
die Gegenbeispiele gewiß nicht nur auf deutschem Boden zu finden sind.
Jeder Zug der Transaustralischen Bahn führt nur erste und zweite Klasse.
Das bedingt eine gewisse vorteilhafte Einheitlichkeit in den Wünschen
der Reisenden. Jeder Wagen besitzt seinen eigenen Schaffner, der nur
die Aufgabe hat, den Reisenden das Leben so angenehm wie möglich zu
machen. Er säubert die Abteile, er bringt große Papierdüten für die Hüte,
damit sie nicht unter Verstaubung leiden, er verwandelt die breiten Sitz-
polster abends in ein behagliches, sauberes Bett. Unter seiner Obhut steht
der kleine, mit Segeltuch bezogene, öfters auch festeingebaute Wassertank,
über den jeder Wagen verfügt und aus dem man Trinkwasser während
der Fahrt haben kann, soviel man
will, weil der Vorrat an jeder
Haltestelle, direkt aus unterirdi-
schen Behältern ergänzt werden
kann. Er klappt die eisernen Deckel
auf und zu, die nach jedem Aus-
und Einsteigen über die Stufen
gelegt werden, damit die Platt-
form mehr Raum für Ausschau-
haltende bietet. Um sieben Uhr mor-
gens geht er von Abteil zu Abteil
mit dem sogenannten „surl^ tsu",
einer Tasse Milchtee mit ein oder
zw eiw eiß en Buttertoastschnitten, die
ein Engländer um keinen Preis vor
dem Lunch vermissen will. Wenn
man es wünscht, bringt er Früchte,
Limonade (die ganze Drnnsuustru-
linn Kuilnm^ wird ausschließlich
prohibitiv geführt, was bei ihrer
starken Besetzung nur ein Vorteil
ist), Zeitschriften, sogar naturwissen-
schaftliche Führer und Romane. Das
alles kann man verhältnismäßig
billig bei ihm kaufen, während er
selbst sich durchaus ohne Trinkgeld
bemüht, wie denn ganz Australien,
vielleicht Sydney ausgenommen,
ein Land ist, das so wenig Verständ-
nis für Trinkgeld besitzt, daß es fast
nirgends angenommen wird. In
einen: Fall kam uns die Kellnerin
eines Parkrestaurants sogar nachge-
laufen und brachte es, als sie es auf
dem Tische liegend fand, zurück mit
den Worten: „Sie haben Ihr Geld
vergessen!"
Die Speisewagen sind länger und
breiter als die in Deutschland üb-
lichen, denn der weiße Australier ist
häufig hochgewachsen und liebt es,
bequem zu sitzen. Da man mit seinem
Billett auch die Karten für Mahl-
zeiten und Schlafgelegenheit be-
Jm Salonwagen der Transauftralischen Bahn auf der Fahrt
durch die Nullarborwüste, die größte der Welt