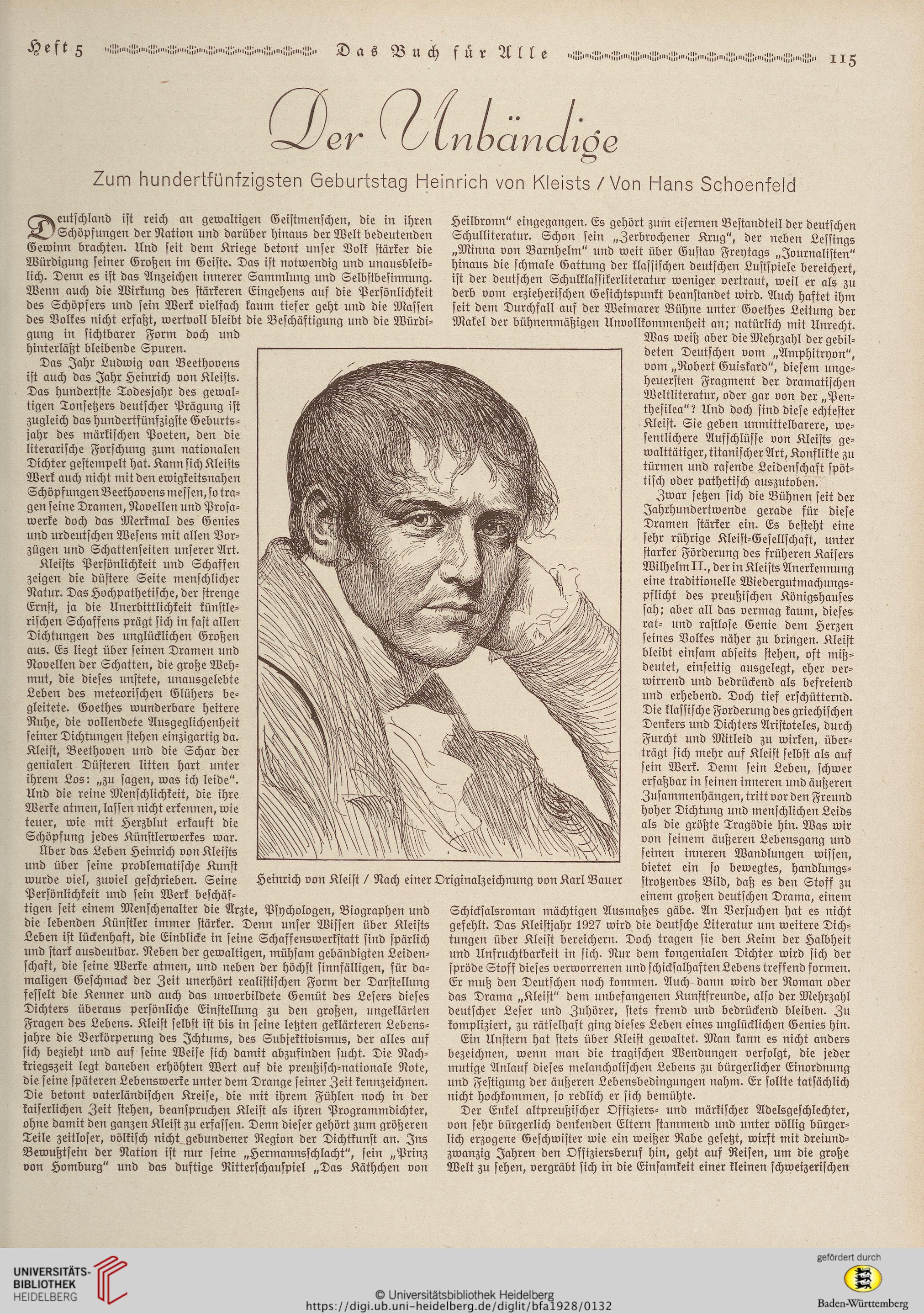Heft 5
Ium Lsbul-tztÄg ^smiuc^ VO2 Kl6i5t5/Vo2 ^2^13 Zc^os^fs!^
eutschland ist reich an gewaltigen Geistmenschen, die in ihren
Schöpfungen der Nation und darüber hinaus der Welt bedeutenden
Gewinn brachten. Und seit dem Kriege betont unser Volt stärker die
Würdigung seiner Großen im Geiste. Das ist notwendig und unausbleib-
lich. Denn es ist das Anzeichen innerer Sammlung und Selbstbesinnung.
Wenn auch die Wirkung des stärkeren Eingehens auf die Persönlichkeit
des Schöpfers und sein Werk vielfach kaum tiefer geht und die Massen
des Volkes nicht erfaßt, wertvoll bleibt die Beschäftigung und die Würdi-
gung in sichtbarer Form doch und
hinterläßt bleibende Spuren.
Das Jahr Ludwig van Beethovens
ist auch das Jahr Heinrich von Kleists.
Das hundertste Todesjahr des gewal¬
tigen Tonsetzers deutscher Prägung ist
zugleich das hundertfünfzigste Geburts¬
jahr des märkischen Poeten, den die
literarische Forschung zum nationalen
Dichter gestempelt hat. Kann sich Kleists
Werk auch nicht mit den ewigkeitsnahen
Schöpfungen Beethovensmessen, so tra¬
gen seine Dramen, Novellen und Prosa¬
werke doch das Merkmal des Genies
und urdeutschen Wesens mit allen Vor¬
zügen und Schattenseiten unserer Art.
Kleists Persönlichkeit und Schaffen
zeigen die düstere Seite menschlicher
Natur. Das Hochpathetische, der strenge
Ernst, ja die Unerbittlichkeit künstle¬
rischen Schaffens prägt sich in fast allen
Dichtungen des unglücklichen Großen
aus. Es liegt über seinen Dramen und
Novellen der Schatten, die große Weh¬
mut, die dieses unstete, unausgelebte
Leben des meteorischen Glühers be¬
gleitete. Goethes wunderbare heitere
Ruhe, die vollendete Ausgeglichenheit
seiner Dichtungen stehen einzigartig da.
Kleist, Beethoven und die Schar der
genialen Düsteren litten hart unter
ihrem Los: „zu sagen, was ich leide".
Und die reine Menschlichkeit, die ihre
Werke atmen, lassen nicht erkennen, wie
teuer, wie mit Herzblut erkauft die
Schöpfung jedes Künstlerwerkes war.
Uber das Leben Heinrich von Kleists
und über seine problematische Kunst
wurde viel, zuviel geschrieben. Seine
Persönlichkeit und sein Werk beschäf-
tigen seit einem Menschenalter die Arzte, Psychologen, Biographen und
die lebenden Künstler immer stärker. Denn unser Wissen über Kleists
Leben ist lückenhaft, die Einblicke in seine Schaffenswerkstatt sind spärlich
und stark ausdeutbar. Neben der gewaltigen, mühsam gebändigten Leiden-
schaft, die seine Werke atmen, und neben der höchst sinnfälligen, für da-
maligen Geschmack der Zeit unerhört realistischen Form der Darstellung
fesselt die Kenner und auch das unverbildete Gemüt des Lesers dieses
Dichters überaus persönliche Einstellung zu den großen, ungeklärten
Fragen des Lebens. Kleist selbst ist bis in seine letzten geklärteren Lebens-
jahre die Verkörperung des Jchtums, des Subjektivismus, der alles auf
sich bezieht und auf seine Weise sich damit abzufinden sucht. Die Nach-
kriegszeit legt daneben erhöhten Wert auf die preußisch-nationale Note,
die seine späteren Lebenswerke unter dem Drange seiner Zeit kennzeichnen.
Die betont vaterländischen Kreise, die mit ihrem Fühlen noch in der
kaiserlichen Zeit stehen, beanspruchen Kleist als ihren Programmdichter,
ohne damit den ganzen Kleist zu erfassen. Denn dieser gehört zum größeren
Teile zeitloser, völkisch nicht gebundener Region der Dichtkunst an. Ins
Bewußtsein der Nation ist nur seine „Hermannsschlacht", sein „Prinz
von Homburg" und das duftige Ritterschauspiel „Das Käthchen von
Heilbronn" eingegangen. Es gehört zum eisernen Bestandteil der deutschen
Schulliteratur. Schon sein „Zerbrochener Krug", der neben Lessings
„Minna von Barnhelm" und weit über Gustav Freytags „Journalisten"
hinaus die schmale Gattung der klassischen deutschen Lustspiele bereichert,
ist der deutschen Schulklassikerliteratur weniger vertraut, weil er als zu
derb vom erzieherischen Gesichtspunkt beanstandet wird. Auch haftet ihm
seit dem Durchfall auf der Weimarer Bühne unter Goethes Leitung der
Makel der bühnenmäßigen Unvollkommenheit an; natürlich mit Unrecht.
Was weiß aber die Mehrzahl der gebil-
deten Deutschen vom „Amphitryon",
vom „Robert Guiskard", diesem unge-
heuersten Fragment der dramatischen
Weltliteratur, oder gar von der „Pen-
thesilea"? Und doch sind diese echtester
Kleist. Sie geben unmittelbarere, we-
sentlichere Aufschlüsse von Kleists ge-
walttätiger, titanischer Art, Konflikte zu
türmen und rasende Leidenschaft spöt-
tisch oder pathetisch auszutoben.
Zwar setzen sich die Bühnen seit der
Jahrhundertwende gerade für diese
Dramen stärker ein. Es besteht eine
sehr rührige Kleist-Gesellschaft, unter
starker Förderung des früheren Kaisers
WilhelmII., der in Kleists Anerkennung
eine traditionelle Wiedergutmachungs-
pflicht des preußischen Königshauses
sah; aber all das vermag kaum, dieses
rat- und rastlose Genie dem Herzen
seines Volkes näher zu bringen. Kleist
bleibt einsam abseits stehen, oft miß-
deutet, einseitig ausgelegt, eher ver-
wirrend und bedrückend als befreiend
und erhebend. Doch tief erschütternd.
Die klassische Forderung des griechischen
Denkers und Dichters Aristoteles, durch
Furcht und Mitleid zu wirken, über-
trägt sich mehr auf Kleist selbst als auf
sein Werk. Denn sein Leben, schwer
erfaßbar in seinen inneren und äußeren
Zusammenhängen, tritt vor den Freund
hoher Dichtung und menschlichen Leids
als die größte Tragödie hin. Was wir
von seinem äußeren Lebensgang und
seinen inneren Wandlungen wissen,
bietet ein so bewegtes, handlungs-
strotzendes Bild, daß es den Stoff zu
einem großen deutschen Drama, einem
Schicksalsroman mächtigen Ausmaßes gäbe. An Versuchen hat es nicht
gefehlt. Das Kleistjahr 1927 wird die deutsche Literatur um weitere Dich-
tungen über Kleist bereichern. Doch tragen sie den Keim der Halbheit
und Unfruchtbarkeit in sich. Nur dem kongenialen Dichter wird sich der
spröde Stoff dieses verworrenen und schicksalhaften Lebens treffend formen.
Er muß den Deutschen noch kommen. Auch dann wird der Roman oder
das Drama „Kleist" dem unbefangenen Kunstfreunde, also der Mehrzahl
deutscher Leser und Zuhörer, stets fremd und bedrückend bleiben. Zu
kompliziert, zu rätselhaft ging dieses Leben eines unglücklichen Genies hin.
Ein Unstern hat stets über Kleist gewaltet. Man kann es nicht anders
bezeichnen, wenn man die tragischen Wendungen verfolgt, die jeder
mutige Anlauf dieses melancholischen Lebens zu bürgerlicher Einordnung
und Festigung der äußeren Lebensbedingungen nahm. Er sollte tatsächlich
nicht hochkommen, so redlich er sich bemühte.
Der Enkel altpreußischer Offiziers- und märkischer Adelsgeschlechter,
von sehr bürgerlich denkenden Eltern stammend und unter völlig bürger-
lich erzogene Geschwister wie ein weißer Rabe gesetzt, wirft mit dreiund-
zwanzig Jahren den Offiziersberuf hin, geht auf Reisen, um die große
Welt zu sehen, vergräbt sich in die Einsamkeit einer kleinen schweizerischen
Heinrich von Kleist / Nach einer Originalzeichnung von Karl Bauer
Ium Lsbul-tztÄg ^smiuc^ VO2 Kl6i5t5/Vo2 ^2^13 Zc^os^fs!^
eutschland ist reich an gewaltigen Geistmenschen, die in ihren
Schöpfungen der Nation und darüber hinaus der Welt bedeutenden
Gewinn brachten. Und seit dem Kriege betont unser Volt stärker die
Würdigung seiner Großen im Geiste. Das ist notwendig und unausbleib-
lich. Denn es ist das Anzeichen innerer Sammlung und Selbstbesinnung.
Wenn auch die Wirkung des stärkeren Eingehens auf die Persönlichkeit
des Schöpfers und sein Werk vielfach kaum tiefer geht und die Massen
des Volkes nicht erfaßt, wertvoll bleibt die Beschäftigung und die Würdi-
gung in sichtbarer Form doch und
hinterläßt bleibende Spuren.
Das Jahr Ludwig van Beethovens
ist auch das Jahr Heinrich von Kleists.
Das hundertste Todesjahr des gewal¬
tigen Tonsetzers deutscher Prägung ist
zugleich das hundertfünfzigste Geburts¬
jahr des märkischen Poeten, den die
literarische Forschung zum nationalen
Dichter gestempelt hat. Kann sich Kleists
Werk auch nicht mit den ewigkeitsnahen
Schöpfungen Beethovensmessen, so tra¬
gen seine Dramen, Novellen und Prosa¬
werke doch das Merkmal des Genies
und urdeutschen Wesens mit allen Vor¬
zügen und Schattenseiten unserer Art.
Kleists Persönlichkeit und Schaffen
zeigen die düstere Seite menschlicher
Natur. Das Hochpathetische, der strenge
Ernst, ja die Unerbittlichkeit künstle¬
rischen Schaffens prägt sich in fast allen
Dichtungen des unglücklichen Großen
aus. Es liegt über seinen Dramen und
Novellen der Schatten, die große Weh¬
mut, die dieses unstete, unausgelebte
Leben des meteorischen Glühers be¬
gleitete. Goethes wunderbare heitere
Ruhe, die vollendete Ausgeglichenheit
seiner Dichtungen stehen einzigartig da.
Kleist, Beethoven und die Schar der
genialen Düsteren litten hart unter
ihrem Los: „zu sagen, was ich leide".
Und die reine Menschlichkeit, die ihre
Werke atmen, lassen nicht erkennen, wie
teuer, wie mit Herzblut erkauft die
Schöpfung jedes Künstlerwerkes war.
Uber das Leben Heinrich von Kleists
und über seine problematische Kunst
wurde viel, zuviel geschrieben. Seine
Persönlichkeit und sein Werk beschäf-
tigen seit einem Menschenalter die Arzte, Psychologen, Biographen und
die lebenden Künstler immer stärker. Denn unser Wissen über Kleists
Leben ist lückenhaft, die Einblicke in seine Schaffenswerkstatt sind spärlich
und stark ausdeutbar. Neben der gewaltigen, mühsam gebändigten Leiden-
schaft, die seine Werke atmen, und neben der höchst sinnfälligen, für da-
maligen Geschmack der Zeit unerhört realistischen Form der Darstellung
fesselt die Kenner und auch das unverbildete Gemüt des Lesers dieses
Dichters überaus persönliche Einstellung zu den großen, ungeklärten
Fragen des Lebens. Kleist selbst ist bis in seine letzten geklärteren Lebens-
jahre die Verkörperung des Jchtums, des Subjektivismus, der alles auf
sich bezieht und auf seine Weise sich damit abzufinden sucht. Die Nach-
kriegszeit legt daneben erhöhten Wert auf die preußisch-nationale Note,
die seine späteren Lebenswerke unter dem Drange seiner Zeit kennzeichnen.
Die betont vaterländischen Kreise, die mit ihrem Fühlen noch in der
kaiserlichen Zeit stehen, beanspruchen Kleist als ihren Programmdichter,
ohne damit den ganzen Kleist zu erfassen. Denn dieser gehört zum größeren
Teile zeitloser, völkisch nicht gebundener Region der Dichtkunst an. Ins
Bewußtsein der Nation ist nur seine „Hermannsschlacht", sein „Prinz
von Homburg" und das duftige Ritterschauspiel „Das Käthchen von
Heilbronn" eingegangen. Es gehört zum eisernen Bestandteil der deutschen
Schulliteratur. Schon sein „Zerbrochener Krug", der neben Lessings
„Minna von Barnhelm" und weit über Gustav Freytags „Journalisten"
hinaus die schmale Gattung der klassischen deutschen Lustspiele bereichert,
ist der deutschen Schulklassikerliteratur weniger vertraut, weil er als zu
derb vom erzieherischen Gesichtspunkt beanstandet wird. Auch haftet ihm
seit dem Durchfall auf der Weimarer Bühne unter Goethes Leitung der
Makel der bühnenmäßigen Unvollkommenheit an; natürlich mit Unrecht.
Was weiß aber die Mehrzahl der gebil-
deten Deutschen vom „Amphitryon",
vom „Robert Guiskard", diesem unge-
heuersten Fragment der dramatischen
Weltliteratur, oder gar von der „Pen-
thesilea"? Und doch sind diese echtester
Kleist. Sie geben unmittelbarere, we-
sentlichere Aufschlüsse von Kleists ge-
walttätiger, titanischer Art, Konflikte zu
türmen und rasende Leidenschaft spöt-
tisch oder pathetisch auszutoben.
Zwar setzen sich die Bühnen seit der
Jahrhundertwende gerade für diese
Dramen stärker ein. Es besteht eine
sehr rührige Kleist-Gesellschaft, unter
starker Förderung des früheren Kaisers
WilhelmII., der in Kleists Anerkennung
eine traditionelle Wiedergutmachungs-
pflicht des preußischen Königshauses
sah; aber all das vermag kaum, dieses
rat- und rastlose Genie dem Herzen
seines Volkes näher zu bringen. Kleist
bleibt einsam abseits stehen, oft miß-
deutet, einseitig ausgelegt, eher ver-
wirrend und bedrückend als befreiend
und erhebend. Doch tief erschütternd.
Die klassische Forderung des griechischen
Denkers und Dichters Aristoteles, durch
Furcht und Mitleid zu wirken, über-
trägt sich mehr auf Kleist selbst als auf
sein Werk. Denn sein Leben, schwer
erfaßbar in seinen inneren und äußeren
Zusammenhängen, tritt vor den Freund
hoher Dichtung und menschlichen Leids
als die größte Tragödie hin. Was wir
von seinem äußeren Lebensgang und
seinen inneren Wandlungen wissen,
bietet ein so bewegtes, handlungs-
strotzendes Bild, daß es den Stoff zu
einem großen deutschen Drama, einem
Schicksalsroman mächtigen Ausmaßes gäbe. An Versuchen hat es nicht
gefehlt. Das Kleistjahr 1927 wird die deutsche Literatur um weitere Dich-
tungen über Kleist bereichern. Doch tragen sie den Keim der Halbheit
und Unfruchtbarkeit in sich. Nur dem kongenialen Dichter wird sich der
spröde Stoff dieses verworrenen und schicksalhaften Lebens treffend formen.
Er muß den Deutschen noch kommen. Auch dann wird der Roman oder
das Drama „Kleist" dem unbefangenen Kunstfreunde, also der Mehrzahl
deutscher Leser und Zuhörer, stets fremd und bedrückend bleiben. Zu
kompliziert, zu rätselhaft ging dieses Leben eines unglücklichen Genies hin.
Ein Unstern hat stets über Kleist gewaltet. Man kann es nicht anders
bezeichnen, wenn man die tragischen Wendungen verfolgt, die jeder
mutige Anlauf dieses melancholischen Lebens zu bürgerlicher Einordnung
und Festigung der äußeren Lebensbedingungen nahm. Er sollte tatsächlich
nicht hochkommen, so redlich er sich bemühte.
Der Enkel altpreußischer Offiziers- und märkischer Adelsgeschlechter,
von sehr bürgerlich denkenden Eltern stammend und unter völlig bürger-
lich erzogene Geschwister wie ein weißer Rabe gesetzt, wirft mit dreiund-
zwanzig Jahren den Offiziersberuf hin, geht auf Reisen, um die große
Welt zu sehen, vergräbt sich in die Einsamkeit einer kleinen schweizerischen
Heinrich von Kleist / Nach einer Originalzeichnung von Karl Bauer