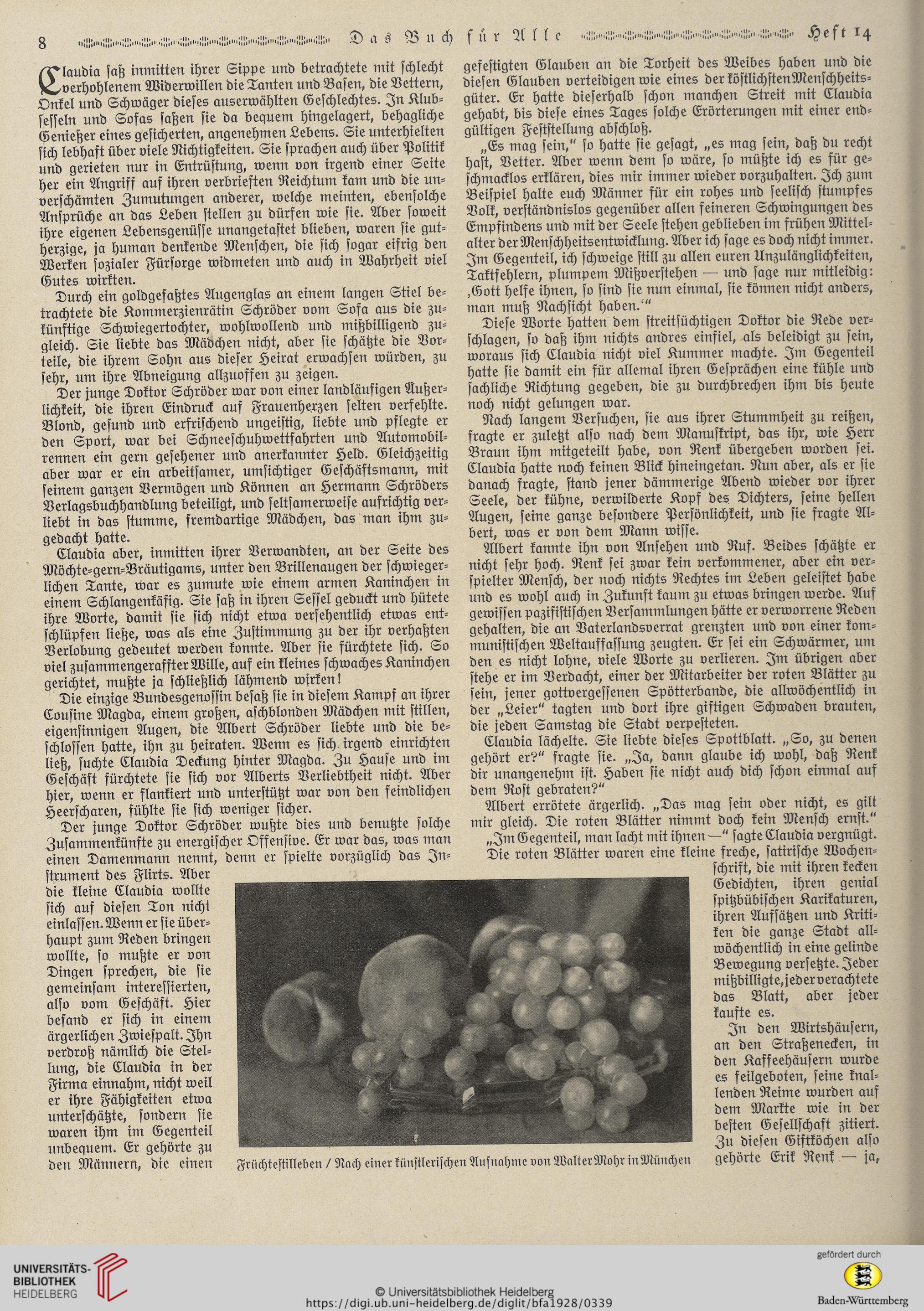laudia saß inmitten ihrer Sippe und betrachtete mit schlecht
verhohlenem Widerwillen die Tanten und Basen, die Vettern,
Onkel und Schwäger dieses auserwählten Geschlechtes. In Klub-
sesseln und Sofas saßen sie da bequem hingelagert, behagliche
Genießer eines gesicherten, angenehmen Lebens. Sie unterhielten
sich lebhaft über viele Nichtigkeiten. Sie sprachen auch über Politik
und gerieten nur in Entrüstung, wenn von irgend einer Seite
her ein Angriff auf ihren verbrieften Reichtum kam und die un-
verschämten Zumutungen anderer, welche meinten, ebensolche
Ansprüche an das Leben stellen zu dürfen wie sie. Aber soweit
ihre eigenen Lebensgenüsse unangetastet blieben, waren sie gut-
herzige, ja human denkende Menschen, die sich sogar eifrig den
Werken sozialer Fürsorge widmeten und auch in Wahrheit viel
Gutes wirkten.
Durch ein goldgefaßtes Augenglas an einem langen Stiel be-
trachtete die Kommerzienrätin Schröder vom Sofa aus die zu-
künftige Schwiegertochter, wohlwollend und mißbilligend zu-
gleich. Sie liebte das Mädchen nicht, aber sie schätzte die Vor-
teile, die ihrem Sohn aus dieser Heirat erwachsen würden, zu
sehr, um ihre Abneigung allzuoffen zu zeigen.
Der junge Doktor Schröder war von einer landläufigen Äußer-
lichkeit, die ihren Eindruck auf Frauenherzen selten verfehlte.
Blond, gesund und erfrischend ungeistig, liebte und pflegte er
den Sport, war bei Schneeschuhwettfahrten und Automobil-
rennen ein gern gesehener und anerkannter Held. Gleichzeitig
aber war er ein arbeitsamer, umsichtiger Geschäftsmann, mit
seinem ganzen Vermögen und Können an Hermann Schröders
Verlagsbuchhandlung beteiligt, und seltsamerweise aufrichtig ver-
liebt in das stumme, fremdartige Mädchen, das man ihm zu-
gedacht hatte.
Claudia aber, inmitten ihrer Verwandten, an der Seite des
Möchte-gern-Bräutigams, unter den Brillenaugen der schwieger-
lichen Tante, war es zumute wie einem armen Kaninchen in
einem Schlangenkäfig. Sie saß in ihren Sessel geduckt und hütete
ihre Worte, damit sie sich nicht etwa versehentlich etwas ent-
schlüpfen ließe, was als eine Zustimmung zu der ihr verhaßten
Verlobung gedeutet werden konnte. Aber sie fürchtete sich. So
viel zusammengeraffter Wille, auf ein kleines schwaches Kaninchen
gerichtet, mußte ja schließlich lähmend wirken!
Die einzige Bundesgenossin besaß sie in diesem Kampf an ihrer
Cousine Magda, einem großen, aschblonden Mädchen mit stillen,
eigensinnigen Augen, die Albert Schröder liebte und die be-
schlossen hatte, ihn zu heiraten. Wenn es sich irgend einrichten
ließ, suchte Claudia Deckung hinter Magda. Zu Hause und im
Geschäft fürchtete sie sich vor Alberts Verliebtheit nicht. Aber
hier, wenn er flankiert und unterstützt war von den feindlichen
Heerscharen, fühlte sie sich weniger sicher.
Der junge Doktor Schröder wußte dies und benutzte solche
Zusammenkünfte zu energischer Offensive. Er war das, was man
einen Damenmann nennt, denn er spielte vorzüglich das In-
strument des Flirts. Aber
die kleine Claudia wollte
sich auf diesen Ton nicht
einlassen. Wenn er sie über-
haupt zum Reden bringen
wollte, so mußte er von
Dingen sprechen, die sie
gemeinsam interessierten,
also vom Geschäft. Hier
befand er sich in einem
ärgerlichen Zwiespalt. Ihn
verdroß nämlich die Stel¬
lung, die Claudia in der
Firma einnahm, nicht weil
er ihre Fähigkeiten etwa
unterschätzte, sondern sie
waren ihm im Gegenteil
unbequem. Er gehörte zu
den Männern, die einen
Heft 14
gefestigten Glauben an die Torheit des Weibes haben und die
diesen Glauben verteidigen wie eines derköstlichstenMenschheits-
güter. Er hatte dieserhalb schon manchen Streit mit Claudia
gehabt, bis diese eines Tages solche Erörterungen mit einer end-
gültigen Feststellung abschloß.
„Es mag sein," so hatte sie gesagt, „es mag sein, daß du recht
hast, Vetter. Aber wenn dem so wäre, so müßte ich es für ge-
schmacklos erklären, dies mir immer wieder vorzuhalten. Ich zum
Beispiel halte euch Männer für ein rohes und seelisch stumpfes
Volk, verständnislos gegenüber allen feineren Schwingungen des
Empfindens und mit der Seele stehen geblieben im frühen Mittel-
alter der Menschheitsentwicklung. Aber ich sage es doch nicht immer.
Im Gegenteil, ich schweige still zu allen euren Unzulänglichkeiten,
Taktsehlern, plumpem Mißverstehen — und sage nur mitleidig:
,Gott helfe ihnen, so sind sie nun einmal, sie können nicht anders,
man muß Nachsicht haben/"
Diese Worte hatten dem streitsüchtigen Doktor die Rede ver-
schlagen, so daß ihm nichts andres einfiel, als beleidigt zu sein,
woraus sich Claudia nicht viel Kummer machte. Im Gegenteil
hatte sie damit ein für allemal ihren Gesprächen eine kühle und
sachliche Richtung gegeben, die zu durchbrechen ihm bis heute
noch nicht gelungen war.
Nach langem Versuchen, sie aus ihrer Stummheit zu reißen,
fragte er zuletzt also nach dem Manuskript, das ihr, wie Herr
Braun ihm mitgeteilt habe, von Renk übergeben worden sei.
Claudia hatte noch keinen Blick hineingetan. Nun aber, als er sie
danach fragte, stand jener dämmerige Abend wieder vor ihrer
Seele, der kühne, verwilderte Kopf des Dichters, seine Hellen
Augen, seine ganze besondere Persönlichkeit, und sie fragte Al-
bert, was er von dem Mann wisse.
Albert kannte ihn von Ansehen und Ruf. Beides schätzte er
nicht sehr hoch. Renk sei zwar kein verkommener, aber ein ver-
spielter Mensch, der noch nichts Rechtes im Leben geleistet habe
und es wohl auch in Zukunft kaum zu etwas bringen werde. Auf
gewissen pazifistischen Versammlungen hätte er verworrene Reden
gehalten, die an Vaterlandsverrat grenzten und von einer kom-
munistischen Weltauffassung zeugten. Er sei ein Schwärmer, um
den es nicht lohne, viele Worte zu verlieren. Im übrigen aber
stehe er im Verdacht, einer der Mitarbeiter der roten Blätter zu
sein, jener gottvergessenen Spötterbande, die allwöchentlich in
der „Leier" tagten und dort ihre giftigen Schwaden brauten,
die jeden Samstag die Stadt verpesteten.
Claudia lächelte. Sie liebte dieses Spottblatt. „So, zu denen
gehört er?" fragte sie. „Ja, dann glaube ich wohl, daß Renk
dir unangenehm ist. Haben sie nicht auch dich schon einmal auf
dem Rost gebraten?"
Albert errötete ärgerlich. „Das mag sein oder nicht, es gilt
mir gleich. Die roten Blätter nimmt doch kein Mensch ernst."
„Im Gegenteil, man lacht mit ihnen—" sagte Claudia vergnügt.
Die roten Blätter waren eine kleine freche, satirische Wochen-
schrift, die mit ihren kecken
Gedichten, ihren genial
spitzbübischen Karikaturen,
ihren Aufsätzen und Kriti-
ken die ganze Stadt all-
wöchentlich in eine gelinde
Bewegung versetzte. Jeder
mißbilligte,jederverachtete
das Blatt, aber jeder
kaufte es.
In den Wirtshäusern,
an den Straßenecken, in
den Kaffeehäusern wurde
es feilgeboten, seine knal-
lenden Reime wurden auf
dem Markte wie in der
besten Gesellschaft zitiert.
Zu diesen Giftköchen also
gehörte Erik Renk — ja,
Frnchtestilleben / Nach einer künstlerischen Aufnahme von WalterMohr inMnnchen
verhohlenem Widerwillen die Tanten und Basen, die Vettern,
Onkel und Schwäger dieses auserwählten Geschlechtes. In Klub-
sesseln und Sofas saßen sie da bequem hingelagert, behagliche
Genießer eines gesicherten, angenehmen Lebens. Sie unterhielten
sich lebhaft über viele Nichtigkeiten. Sie sprachen auch über Politik
und gerieten nur in Entrüstung, wenn von irgend einer Seite
her ein Angriff auf ihren verbrieften Reichtum kam und die un-
verschämten Zumutungen anderer, welche meinten, ebensolche
Ansprüche an das Leben stellen zu dürfen wie sie. Aber soweit
ihre eigenen Lebensgenüsse unangetastet blieben, waren sie gut-
herzige, ja human denkende Menschen, die sich sogar eifrig den
Werken sozialer Fürsorge widmeten und auch in Wahrheit viel
Gutes wirkten.
Durch ein goldgefaßtes Augenglas an einem langen Stiel be-
trachtete die Kommerzienrätin Schröder vom Sofa aus die zu-
künftige Schwiegertochter, wohlwollend und mißbilligend zu-
gleich. Sie liebte das Mädchen nicht, aber sie schätzte die Vor-
teile, die ihrem Sohn aus dieser Heirat erwachsen würden, zu
sehr, um ihre Abneigung allzuoffen zu zeigen.
Der junge Doktor Schröder war von einer landläufigen Äußer-
lichkeit, die ihren Eindruck auf Frauenherzen selten verfehlte.
Blond, gesund und erfrischend ungeistig, liebte und pflegte er
den Sport, war bei Schneeschuhwettfahrten und Automobil-
rennen ein gern gesehener und anerkannter Held. Gleichzeitig
aber war er ein arbeitsamer, umsichtiger Geschäftsmann, mit
seinem ganzen Vermögen und Können an Hermann Schröders
Verlagsbuchhandlung beteiligt, und seltsamerweise aufrichtig ver-
liebt in das stumme, fremdartige Mädchen, das man ihm zu-
gedacht hatte.
Claudia aber, inmitten ihrer Verwandten, an der Seite des
Möchte-gern-Bräutigams, unter den Brillenaugen der schwieger-
lichen Tante, war es zumute wie einem armen Kaninchen in
einem Schlangenkäfig. Sie saß in ihren Sessel geduckt und hütete
ihre Worte, damit sie sich nicht etwa versehentlich etwas ent-
schlüpfen ließe, was als eine Zustimmung zu der ihr verhaßten
Verlobung gedeutet werden konnte. Aber sie fürchtete sich. So
viel zusammengeraffter Wille, auf ein kleines schwaches Kaninchen
gerichtet, mußte ja schließlich lähmend wirken!
Die einzige Bundesgenossin besaß sie in diesem Kampf an ihrer
Cousine Magda, einem großen, aschblonden Mädchen mit stillen,
eigensinnigen Augen, die Albert Schröder liebte und die be-
schlossen hatte, ihn zu heiraten. Wenn es sich irgend einrichten
ließ, suchte Claudia Deckung hinter Magda. Zu Hause und im
Geschäft fürchtete sie sich vor Alberts Verliebtheit nicht. Aber
hier, wenn er flankiert und unterstützt war von den feindlichen
Heerscharen, fühlte sie sich weniger sicher.
Der junge Doktor Schröder wußte dies und benutzte solche
Zusammenkünfte zu energischer Offensive. Er war das, was man
einen Damenmann nennt, denn er spielte vorzüglich das In-
strument des Flirts. Aber
die kleine Claudia wollte
sich auf diesen Ton nicht
einlassen. Wenn er sie über-
haupt zum Reden bringen
wollte, so mußte er von
Dingen sprechen, die sie
gemeinsam interessierten,
also vom Geschäft. Hier
befand er sich in einem
ärgerlichen Zwiespalt. Ihn
verdroß nämlich die Stel¬
lung, die Claudia in der
Firma einnahm, nicht weil
er ihre Fähigkeiten etwa
unterschätzte, sondern sie
waren ihm im Gegenteil
unbequem. Er gehörte zu
den Männern, die einen
Heft 14
gefestigten Glauben an die Torheit des Weibes haben und die
diesen Glauben verteidigen wie eines derköstlichstenMenschheits-
güter. Er hatte dieserhalb schon manchen Streit mit Claudia
gehabt, bis diese eines Tages solche Erörterungen mit einer end-
gültigen Feststellung abschloß.
„Es mag sein," so hatte sie gesagt, „es mag sein, daß du recht
hast, Vetter. Aber wenn dem so wäre, so müßte ich es für ge-
schmacklos erklären, dies mir immer wieder vorzuhalten. Ich zum
Beispiel halte euch Männer für ein rohes und seelisch stumpfes
Volk, verständnislos gegenüber allen feineren Schwingungen des
Empfindens und mit der Seele stehen geblieben im frühen Mittel-
alter der Menschheitsentwicklung. Aber ich sage es doch nicht immer.
Im Gegenteil, ich schweige still zu allen euren Unzulänglichkeiten,
Taktsehlern, plumpem Mißverstehen — und sage nur mitleidig:
,Gott helfe ihnen, so sind sie nun einmal, sie können nicht anders,
man muß Nachsicht haben/"
Diese Worte hatten dem streitsüchtigen Doktor die Rede ver-
schlagen, so daß ihm nichts andres einfiel, als beleidigt zu sein,
woraus sich Claudia nicht viel Kummer machte. Im Gegenteil
hatte sie damit ein für allemal ihren Gesprächen eine kühle und
sachliche Richtung gegeben, die zu durchbrechen ihm bis heute
noch nicht gelungen war.
Nach langem Versuchen, sie aus ihrer Stummheit zu reißen,
fragte er zuletzt also nach dem Manuskript, das ihr, wie Herr
Braun ihm mitgeteilt habe, von Renk übergeben worden sei.
Claudia hatte noch keinen Blick hineingetan. Nun aber, als er sie
danach fragte, stand jener dämmerige Abend wieder vor ihrer
Seele, der kühne, verwilderte Kopf des Dichters, seine Hellen
Augen, seine ganze besondere Persönlichkeit, und sie fragte Al-
bert, was er von dem Mann wisse.
Albert kannte ihn von Ansehen und Ruf. Beides schätzte er
nicht sehr hoch. Renk sei zwar kein verkommener, aber ein ver-
spielter Mensch, der noch nichts Rechtes im Leben geleistet habe
und es wohl auch in Zukunft kaum zu etwas bringen werde. Auf
gewissen pazifistischen Versammlungen hätte er verworrene Reden
gehalten, die an Vaterlandsverrat grenzten und von einer kom-
munistischen Weltauffassung zeugten. Er sei ein Schwärmer, um
den es nicht lohne, viele Worte zu verlieren. Im übrigen aber
stehe er im Verdacht, einer der Mitarbeiter der roten Blätter zu
sein, jener gottvergessenen Spötterbande, die allwöchentlich in
der „Leier" tagten und dort ihre giftigen Schwaden brauten,
die jeden Samstag die Stadt verpesteten.
Claudia lächelte. Sie liebte dieses Spottblatt. „So, zu denen
gehört er?" fragte sie. „Ja, dann glaube ich wohl, daß Renk
dir unangenehm ist. Haben sie nicht auch dich schon einmal auf
dem Rost gebraten?"
Albert errötete ärgerlich. „Das mag sein oder nicht, es gilt
mir gleich. Die roten Blätter nimmt doch kein Mensch ernst."
„Im Gegenteil, man lacht mit ihnen—" sagte Claudia vergnügt.
Die roten Blätter waren eine kleine freche, satirische Wochen-
schrift, die mit ihren kecken
Gedichten, ihren genial
spitzbübischen Karikaturen,
ihren Aufsätzen und Kriti-
ken die ganze Stadt all-
wöchentlich in eine gelinde
Bewegung versetzte. Jeder
mißbilligte,jederverachtete
das Blatt, aber jeder
kaufte es.
In den Wirtshäusern,
an den Straßenecken, in
den Kaffeehäusern wurde
es feilgeboten, seine knal-
lenden Reime wurden auf
dem Markte wie in der
besten Gesellschaft zitiert.
Zu diesen Giftköchen also
gehörte Erik Renk — ja,
Frnchtestilleben / Nach einer künstlerischen Aufnahme von WalterMohr inMnnchen