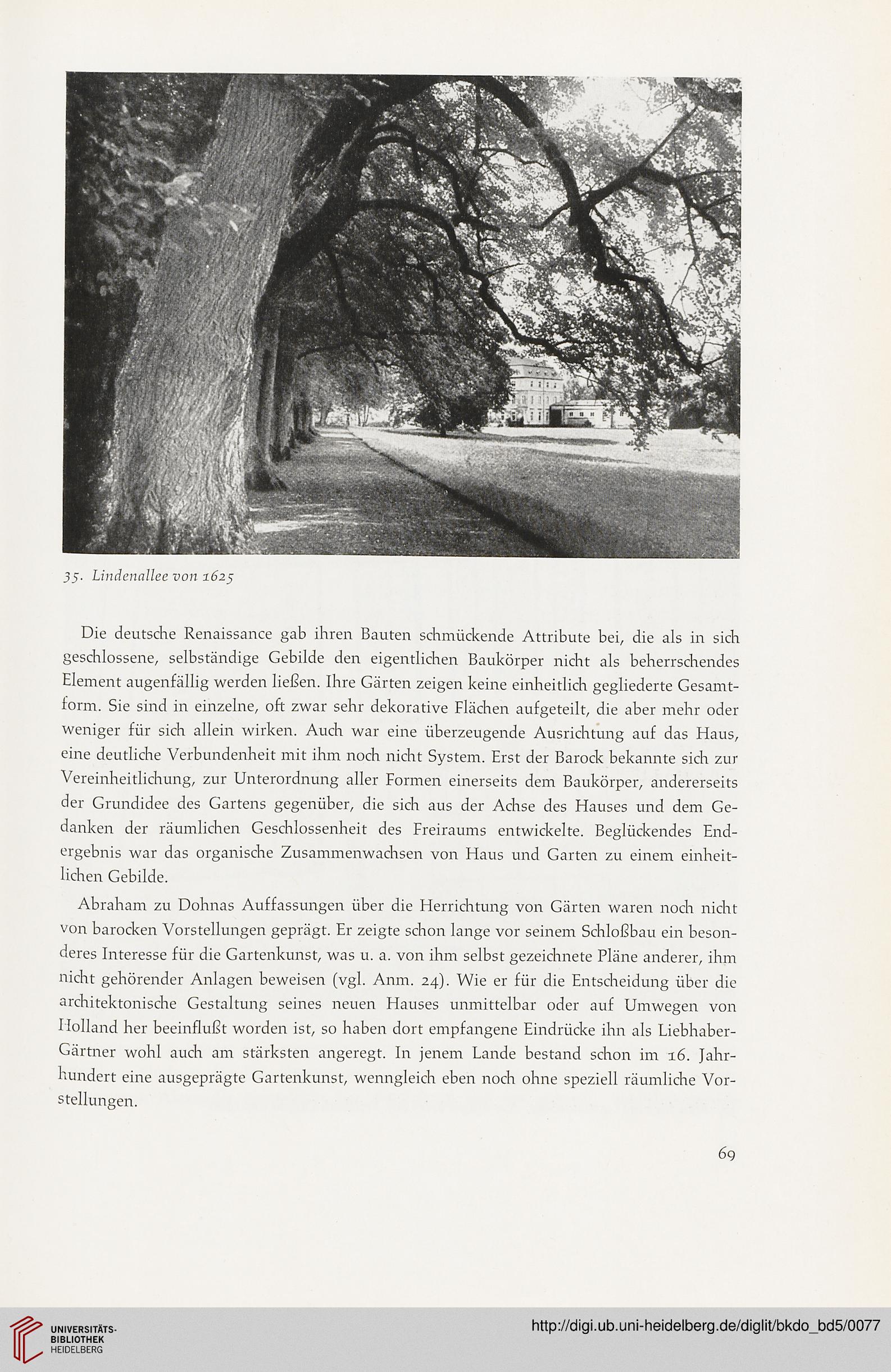35- Lindenallee von 1625
Die deutsche Renaissance gab ihren Bauten schmückende Attribute bei, die als in sich
geschlossene, selbständige Gebilde den eigentlichen Baukörper nicht als beherrschendes
Element augenfällig werden ließen. Ihre Gärten zeigen keine einheitlich gegliederte Gesamt-
form. Sie sind in einzelne, oft zwar sehr dekorative Flächen aufgeteilt, die aber mehr oder
weniger für sich allein wirken. Auch war eine überzeugende Ausrichtung auf das Haus,
eine deutliche Verbundenheit mit ihm noch nicht System. Erst der Barock bekannte sich zur
Vereinheitlichung, zur Unterordnung aller Formen einerseits dem Baukörper, andererseits
der Grundidee des Gartens gegenüber, die sich aus der Achse des Hauses und dem Ge-
danken der räumlichen Geschlossenheit des Freiraums entwickelte. Beglückendes End-
ergebnis war das organische Zusammenwachsen von Haus und Garten zu einem einheit-
lichen Gebilde.
Abraham zu Dohnas Auffassungen über die Herrichtung von Gärten waren noch nicht
von barocken Vorstellungen geprägt. Er zeigte schon lange vor seinem Schloßbau ein beson-
deres Interesse für die Gartenkunst, was u. a. von ihm selbst gezeichnete Pläne anderer, ihm
nicht gehörender Anlagen beweisen (vgl. Anm. 24). Wie er für die Entscheidung über die
architektonische Gestaltung seines neuen Hauses unmittelbar oder auf Umwegen von
Holland her beeinflußt worden ist, so haben dort empfangene Eindrücke ihn als Liebhaber-
Gärtner wohl auch am stärksten angeregt. In jenem Lande bestand schon im 16. Jahr-
hundert eine ausgeprägte Gartenkunst, wenngleich eben noch ohne speziell räumliche Vor-
stellungen.
69
Die deutsche Renaissance gab ihren Bauten schmückende Attribute bei, die als in sich
geschlossene, selbständige Gebilde den eigentlichen Baukörper nicht als beherrschendes
Element augenfällig werden ließen. Ihre Gärten zeigen keine einheitlich gegliederte Gesamt-
form. Sie sind in einzelne, oft zwar sehr dekorative Flächen aufgeteilt, die aber mehr oder
weniger für sich allein wirken. Auch war eine überzeugende Ausrichtung auf das Haus,
eine deutliche Verbundenheit mit ihm noch nicht System. Erst der Barock bekannte sich zur
Vereinheitlichung, zur Unterordnung aller Formen einerseits dem Baukörper, andererseits
der Grundidee des Gartens gegenüber, die sich aus der Achse des Hauses und dem Ge-
danken der räumlichen Geschlossenheit des Freiraums entwickelte. Beglückendes End-
ergebnis war das organische Zusammenwachsen von Haus und Garten zu einem einheit-
lichen Gebilde.
Abraham zu Dohnas Auffassungen über die Herrichtung von Gärten waren noch nicht
von barocken Vorstellungen geprägt. Er zeigte schon lange vor seinem Schloßbau ein beson-
deres Interesse für die Gartenkunst, was u. a. von ihm selbst gezeichnete Pläne anderer, ihm
nicht gehörender Anlagen beweisen (vgl. Anm. 24). Wie er für die Entscheidung über die
architektonische Gestaltung seines neuen Hauses unmittelbar oder auf Umwegen von
Holland her beeinflußt worden ist, so haben dort empfangene Eindrücke ihn als Liebhaber-
Gärtner wohl auch am stärksten angeregt. In jenem Lande bestand schon im 16. Jahr-
hundert eine ausgeprägte Gartenkunst, wenngleich eben noch ohne speziell räumliche Vor-
stellungen.
69