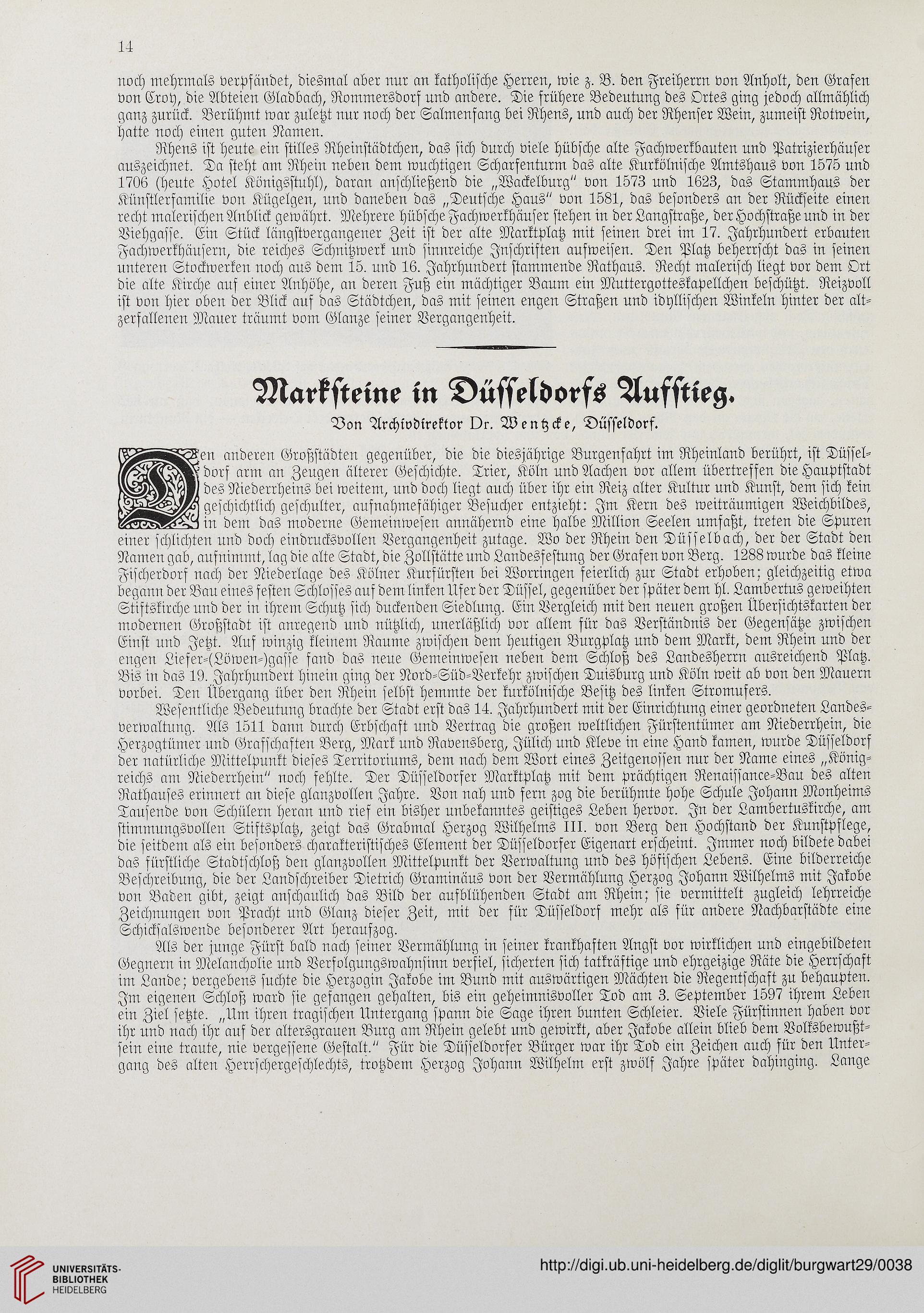14
noch mehrmals verpfändet, diesmal aber nur an katholische Herren, wie z. B. den Freiherrn von Anholt, den Grafen
von Croy, die Abteien Gladbach, Rommersdorf und andere. Die frühere Bedeutung des Ortes ging jedoch allmählich
ganz zurück. Berühmt war zuletzt nur noch der Salmenfang bei Rhens, und auch der Rhenser Wein, zumeist Rotwein,
hatte noch einen guten Namen.
Rhens ist heute ein stilles Rheinstädtchen, das sich durch viele hübsche alte Fachwerkbauten und Patrizierhänser
auszeichnet. Da steht am Rhein neben dem wuchtigen Scharfenturm das alte Kurkölnische Amtshaus von 1575 und
1706 (heute Hotel Königsstuhl), daran anschließend die „Wackelburg" von 1573 und 1623, das Stammhaus der
Künstlerfamilie von Kügelgen, und daneben das „Deutsche Haus" von 1581, das besonders an der Rückseite einen
recht malerischen Anblick gewährt. Mehrere hübsche Fachwerkhäuser stehen in der Langstraße, der Hochstraße und in der
Viehgasse. Ein Stück lüngstvergangener Zeit ist der alte Marktplatz mit seinen drei im 17. Jahrhundert erbauten
Fachwerkhäusern, die reiches Schnitzwerk und sinnreiche Inschriften aufweisen. Den Platz beherrscht das in seinen
unteren Stockwerken noch aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammende Rathaus. Recht malerisch liegt vor dem Ort
die alte Kirche auf einer Anhöhe, an deren Fuß ein mächtiger Baum ein Muttergotteskapellchen beschützt. Reizvoll
ist von hier oben der Blick auf das Städtchen, das mit seinen engen Straßen und idyllischen Winkeln hinter der alt-
zerfallenen Mauer träumt vom Glanze seiner Vergangenheit.
Marksteine in Düsseldorfs Ausstieg.
Von Archivdirektor Or. Wenhcke, Düsseldorf.
en anderen Großstädten gegenüber, die die diesjährige Burgenfahrt im Rheinland berührt, ist Düssel-
dorf arm an Zeugen älterer Geschichte. Trier, Köln und Aachen vor allem übertreffen die Hauptstadt
des Niederrheins bei weitem, und doch liegt auch über ihr ein Reiz alter Kultur und Kunst, dem sich kein
geschichtlich geschulter, aufnahmefähiger Besucher entzieht: Im Kern des weiträumigen Weichbildes,
in dem das moderne Gemeinwesen annähernd eine halbe Million Seelen umfaßt, treten die Spuren
einer schlichten und doch eindrucksvollen Vergangenheit zutage. Wo der Rhein den Düsselbach, der der Stadt den
Namen gab, aufnimmt, lag die alte Stadt, die Zollstätte und Landesfestung der Grafen von Berg. 1288 wurde das kleine
Fischerdorf nach der Niederlage des Kölner Kurfürsten bei Worringen feierlich zur Stadt erhoben; gleichzeitig etwa
begann der Bau eines festen Schlosses auf dem linken Ufer der Dussel, gegenüber der später dem hl. Lambertus geweihten
Stiftskirche und der in ihrem Schutz sich duckenden Siedlung. Ein Vergleich mit den neuen großen Übersichtskarten der
modernen Großstadt ist anregend und nützlich, unerläßlich vor allem für das Verständnis der Gegensätze zwischen
Einst und Jetzt. Auf winzig kleinem Raume zwischen dem heutigen Burgplatz und dem Markt, dem Rhein und der
engen Liefer-(Löwen-)gasse fand das neue Gemeinwesen neben dem Schloß des Landesherrn ausreichend Platz.
Bis in das 19. Jahrhundert hinein ging der Nord-Süd-Verkehr zwischen Duisburg und Köln weit ab von den Mauern
vorbei. Den Übergang über den Rhein selbst hemmte der kurkölnische Besitz des linken Stromufers.
Wesentliche Bedeutung brachte der Stadt erst das 14. Jahrhundert mit der Einrichtung einer geordneten Landes-
verwaltung. Als 1511 dann durch Erbschaft und Vertrag die großen weltlichen Fürstentümer am Niederrhein, die
Herzogtümer und Grafschaften Berg, Mark und Ravensberg, Jülich und Kleve in eine Hand kamen, wurde Düsseldorf
der natürliche Mittelpunkt dieses Territoriums, dem nach dem Wort eines Zeitgenossen nur der Name eines „König-
reichs am Niederrhein" noch fehlte. Der Düsseldorfer Marktplatz mit dem prächtigen Renaissance-Bau des alten
Rathauses erinnert an diese glanzvollen Jahre. Von nah und fern zog die berühmte hohe Schule Johann Monheims
Tausende von Schülern heran und rief ein bisher unbekanntes geistiges Leben hervor. In der Lambertuskirche, am
stimmungsvollen Stiftsplatz, zeigt das Grabmal Herzog Wilhelms III. von Berg den Hochstand der Kunstpflege,
die seitdem als ein besonders charakteristisches Element der Düsseldorfer Eigenart erscheint. Immer noch bildete dabei
das fürstliche Stadtschloß den glanzvollen Mittelpunkt der Verwaltung und des höfischen Lebens. Eine bilderreiche
Beschreibung, die der Landschreiber Dietrich Graminäus von der Vermählung Herzog Johann Wilhelms mit Jakobe
von Baden gibt, zeigt anschaulich das Bild der aufblühenden Stadt am Rhein; sie vermittelt zugleich lehrreiche
Zeichnungen von Pracht und Glanz dieser Zeit, mit der für Düsseldorf mehr als für andere Nachbarstädte eine
Schicksalswende besonderer Art heraufzog.
Als der junge Fürst bald nach seiner Vermählung in seiner krankhaften Angst vor wirklichen und eingebildeten
Gegnern in Melancholie und Verfolgungswahnsinn verfiel, sicherten sich tatkräftige und ehrgeizige Räte die Herrschaft
im Lande; vergebens suchte die Herzogin Jakobe im Bund mit auswärtigen Mächten die Regentschaft zu behaupten.
Im eigenen Schloß ward sie gefangen gehalten, bis ein geheimnisvoller Tod am 3. September 1597 ihrem Leben
ein Ziel setzte. „Um ihren tragischen Untergang spann die Sage ihren bunten Schleier. Viele Fürstinnen haben vor
ihr und nach ihr auf der altersgrauen Burg am Rhein gelebt und gewirkt, aber Jakobe allein blieb dem Volksbewußt-
sein eine traute, nie vergessene Gestalt." Für die Düsseldorfer Bürger war ihr Tod ein Zeichen auch für den Unter-
gang des alten Herrschergeschlechts, trotzdem Herzog Johann Wilhelm erst zwölf Jahre später dahinging. Lange
noch mehrmals verpfändet, diesmal aber nur an katholische Herren, wie z. B. den Freiherrn von Anholt, den Grafen
von Croy, die Abteien Gladbach, Rommersdorf und andere. Die frühere Bedeutung des Ortes ging jedoch allmählich
ganz zurück. Berühmt war zuletzt nur noch der Salmenfang bei Rhens, und auch der Rhenser Wein, zumeist Rotwein,
hatte noch einen guten Namen.
Rhens ist heute ein stilles Rheinstädtchen, das sich durch viele hübsche alte Fachwerkbauten und Patrizierhänser
auszeichnet. Da steht am Rhein neben dem wuchtigen Scharfenturm das alte Kurkölnische Amtshaus von 1575 und
1706 (heute Hotel Königsstuhl), daran anschließend die „Wackelburg" von 1573 und 1623, das Stammhaus der
Künstlerfamilie von Kügelgen, und daneben das „Deutsche Haus" von 1581, das besonders an der Rückseite einen
recht malerischen Anblick gewährt. Mehrere hübsche Fachwerkhäuser stehen in der Langstraße, der Hochstraße und in der
Viehgasse. Ein Stück lüngstvergangener Zeit ist der alte Marktplatz mit seinen drei im 17. Jahrhundert erbauten
Fachwerkhäusern, die reiches Schnitzwerk und sinnreiche Inschriften aufweisen. Den Platz beherrscht das in seinen
unteren Stockwerken noch aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammende Rathaus. Recht malerisch liegt vor dem Ort
die alte Kirche auf einer Anhöhe, an deren Fuß ein mächtiger Baum ein Muttergotteskapellchen beschützt. Reizvoll
ist von hier oben der Blick auf das Städtchen, das mit seinen engen Straßen und idyllischen Winkeln hinter der alt-
zerfallenen Mauer träumt vom Glanze seiner Vergangenheit.
Marksteine in Düsseldorfs Ausstieg.
Von Archivdirektor Or. Wenhcke, Düsseldorf.
en anderen Großstädten gegenüber, die die diesjährige Burgenfahrt im Rheinland berührt, ist Düssel-
dorf arm an Zeugen älterer Geschichte. Trier, Köln und Aachen vor allem übertreffen die Hauptstadt
des Niederrheins bei weitem, und doch liegt auch über ihr ein Reiz alter Kultur und Kunst, dem sich kein
geschichtlich geschulter, aufnahmefähiger Besucher entzieht: Im Kern des weiträumigen Weichbildes,
in dem das moderne Gemeinwesen annähernd eine halbe Million Seelen umfaßt, treten die Spuren
einer schlichten und doch eindrucksvollen Vergangenheit zutage. Wo der Rhein den Düsselbach, der der Stadt den
Namen gab, aufnimmt, lag die alte Stadt, die Zollstätte und Landesfestung der Grafen von Berg. 1288 wurde das kleine
Fischerdorf nach der Niederlage des Kölner Kurfürsten bei Worringen feierlich zur Stadt erhoben; gleichzeitig etwa
begann der Bau eines festen Schlosses auf dem linken Ufer der Dussel, gegenüber der später dem hl. Lambertus geweihten
Stiftskirche und der in ihrem Schutz sich duckenden Siedlung. Ein Vergleich mit den neuen großen Übersichtskarten der
modernen Großstadt ist anregend und nützlich, unerläßlich vor allem für das Verständnis der Gegensätze zwischen
Einst und Jetzt. Auf winzig kleinem Raume zwischen dem heutigen Burgplatz und dem Markt, dem Rhein und der
engen Liefer-(Löwen-)gasse fand das neue Gemeinwesen neben dem Schloß des Landesherrn ausreichend Platz.
Bis in das 19. Jahrhundert hinein ging der Nord-Süd-Verkehr zwischen Duisburg und Köln weit ab von den Mauern
vorbei. Den Übergang über den Rhein selbst hemmte der kurkölnische Besitz des linken Stromufers.
Wesentliche Bedeutung brachte der Stadt erst das 14. Jahrhundert mit der Einrichtung einer geordneten Landes-
verwaltung. Als 1511 dann durch Erbschaft und Vertrag die großen weltlichen Fürstentümer am Niederrhein, die
Herzogtümer und Grafschaften Berg, Mark und Ravensberg, Jülich und Kleve in eine Hand kamen, wurde Düsseldorf
der natürliche Mittelpunkt dieses Territoriums, dem nach dem Wort eines Zeitgenossen nur der Name eines „König-
reichs am Niederrhein" noch fehlte. Der Düsseldorfer Marktplatz mit dem prächtigen Renaissance-Bau des alten
Rathauses erinnert an diese glanzvollen Jahre. Von nah und fern zog die berühmte hohe Schule Johann Monheims
Tausende von Schülern heran und rief ein bisher unbekanntes geistiges Leben hervor. In der Lambertuskirche, am
stimmungsvollen Stiftsplatz, zeigt das Grabmal Herzog Wilhelms III. von Berg den Hochstand der Kunstpflege,
die seitdem als ein besonders charakteristisches Element der Düsseldorfer Eigenart erscheint. Immer noch bildete dabei
das fürstliche Stadtschloß den glanzvollen Mittelpunkt der Verwaltung und des höfischen Lebens. Eine bilderreiche
Beschreibung, die der Landschreiber Dietrich Graminäus von der Vermählung Herzog Johann Wilhelms mit Jakobe
von Baden gibt, zeigt anschaulich das Bild der aufblühenden Stadt am Rhein; sie vermittelt zugleich lehrreiche
Zeichnungen von Pracht und Glanz dieser Zeit, mit der für Düsseldorf mehr als für andere Nachbarstädte eine
Schicksalswende besonderer Art heraufzog.
Als der junge Fürst bald nach seiner Vermählung in seiner krankhaften Angst vor wirklichen und eingebildeten
Gegnern in Melancholie und Verfolgungswahnsinn verfiel, sicherten sich tatkräftige und ehrgeizige Räte die Herrschaft
im Lande; vergebens suchte die Herzogin Jakobe im Bund mit auswärtigen Mächten die Regentschaft zu behaupten.
Im eigenen Schloß ward sie gefangen gehalten, bis ein geheimnisvoller Tod am 3. September 1597 ihrem Leben
ein Ziel setzte. „Um ihren tragischen Untergang spann die Sage ihren bunten Schleier. Viele Fürstinnen haben vor
ihr und nach ihr auf der altersgrauen Burg am Rhein gelebt und gewirkt, aber Jakobe allein blieb dem Volksbewußt-
sein eine traute, nie vergessene Gestalt." Für die Düsseldorfer Bürger war ihr Tod ein Zeichen auch für den Unter-
gang des alten Herrschergeschlechts, trotzdem Herzog Johann Wilhelm erst zwölf Jahre später dahinging. Lange