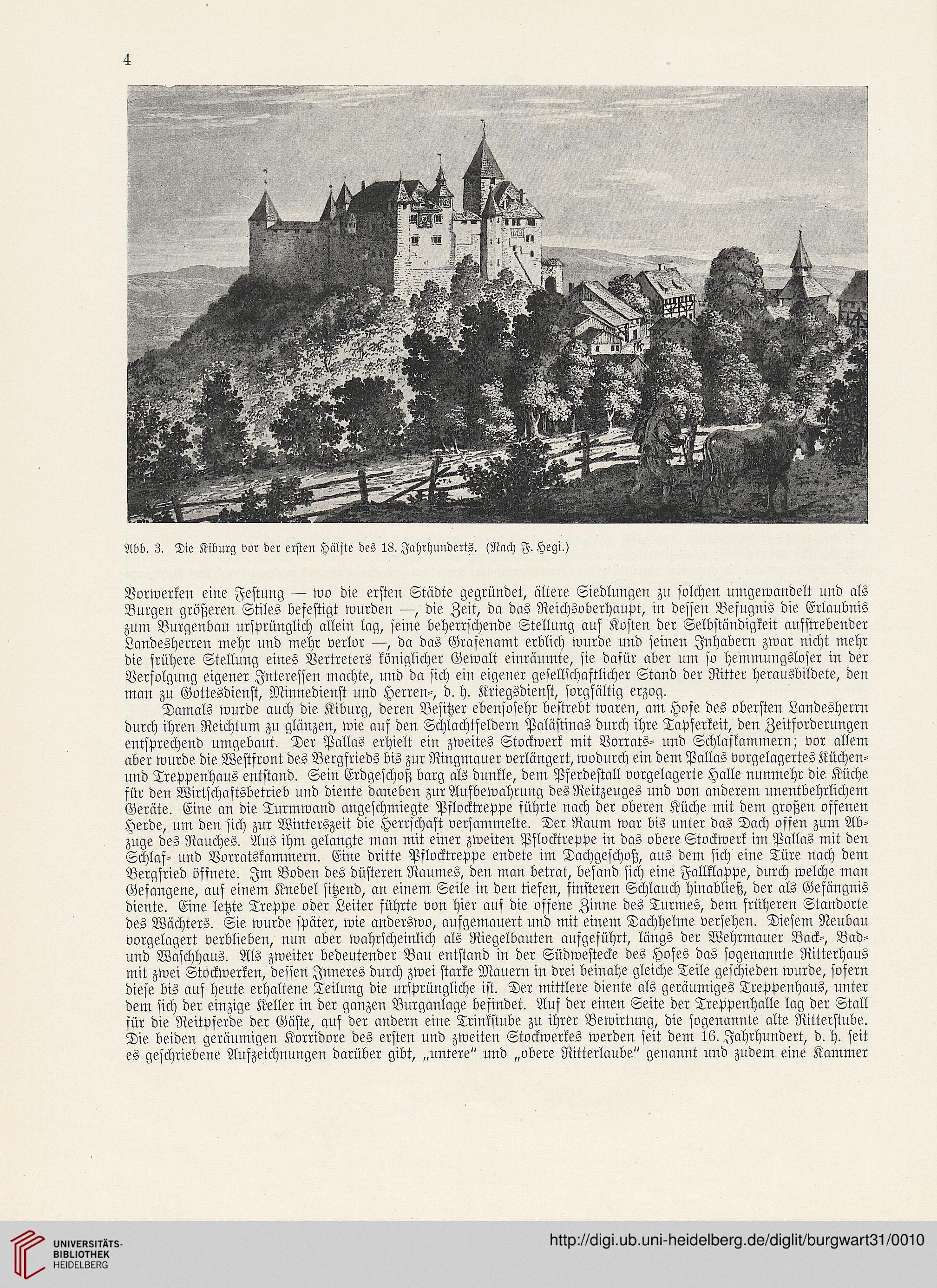4
Abb. 3. Die Kiburg vor der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (Nach F. Hegt.)
Vorwerken eine Festung — wo die ersten Städte gegründet, ältere Siedlungen zu solchen umgewandelt und als
Burgen größeren Stiles befestigt wurden —, die Zeit, da das Reichsoberhaupt, in dessen Befugnis die Erlaubnis
zum Burgenbau ursprünglich allein lag, seine beherrschende Stellung auf Kosten der Selbständigkeit aufstrebender
Landesherren mehr und mehr verlor —, da das Grafenamt erblich wurde und seinen Inhabern zwar nicht mehr
die frühere Stellung eines Vertreters königlicher Gewalt einräumte, sie dafür aber um so hemmungsloser in der
Verfolgung eigener Interessen machte, und da sich ein eigener gesellschaftlicher Stand der Ritter herausbildete, den
man zu Gottesdienst, Minnedienst und Herren-, d. h. Kriegsdienst, sorgfältig erzog.
Damals wurde auch die Kiburg, deren Besitzer ebensosehr bestrebt waren, am Hofe des obersten Landesherrn
durch ihren Reichtum zu glänzen, wie auf den Schlachtfeldern Palästinas durch ihre Tapferkeit, den Zeitforderungen
entsprechend umgebaut. Der Pallas erhielt ein zweites Stockwerk mit Vorrats- und Schlafkammern; vor allem
aber wurde die Westfront des Bergfrieds bis zur Ringmauer verlängert, wodurch ein dem Pallas vorgelagertes Küchen-
und Treppenhaus entstand. Sein Erdgeschoß barg als dunkle, dem Pferdestall vorgelagerte Halle nunmehr die Küche
für den Wirtschaftsbetrieb und diente daneben zur Aufbewahrung des Reitzeuges und von anderem unentbehrlichem
Geräte. Eine an die Turmwand angeschmiegte Pflocktreppe führte nach der oberen Küche mit dem großen offenen
Herde, um den sich zur Winterszeit die Herrschaft versammelte. Der Raum war bis unter das Dach offen zum Ab-
züge des Rauches. Aus ihm gelangte man mit einer zweiten Pflocktreppe in das obere Stockwerk im Pallas mit den
Schlaf- und Vorratskammern. Eine dritte Pflocktreppe endete im Dachgeschoß, aus dem sich eine Türe nach dem
Bergfried öffnete. Im Boden des düsteren Raumes, den man betrat, befand sich eine Fallklappe, durch welche man
Gefangene, auf einem Knebel sitzend, an einem Seile in den tiefen, finsteren Schlauch hinabließ, der als Gefängnis
diente. Eine letzte Treppe oder Leiter führte von hier auf die offene Zinne des Turmes, dem früheren Standorte
des Wächters. Sie wurde später, wie anderswo, aufgemauert und mit einem Dachhelme versehen. Diesem Neubau
vorgelagert verblieben, nun aber wahrscheinlich als Riegelbauten aufgeführt, längs der Wehrmauer Back-, Bad-
und Waschhaus. Als zweiter bedeutender Bau entstand in der Südwestecke des Hofes das sogenannte Ritterhaus
mit zwei Stockwerken, dessen Inneres durch zwei starke Mauern in drei beinahe gleiche Teile geschieden wurde, sofern
diese bis auf heute erhaltene Teilung die ursprüngliche ist. Der mittlere diente als geräumiges Treppenhaus, unter
dem sich der einzige Keller in der ganzen Burganlage befindet. Auf der einen Seite der Treppenhalle lag der Stall
für die Reitpferde der Gäste, auf der andern eine Trinkstube zu ihrer Bewirtung, die sogenannte alte Ritterstube.
Die beiden geräumigen Korridore des ersten und zweiten Stockwerkes werden seit dem 16. Jahrhundert, d. h. seit
es geschriebene Aufzeichnungen darüber gibt, „untere" und „obere Ritterlaube" genannt und zudem eine Kammer
Abb. 3. Die Kiburg vor der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. (Nach F. Hegt.)
Vorwerken eine Festung — wo die ersten Städte gegründet, ältere Siedlungen zu solchen umgewandelt und als
Burgen größeren Stiles befestigt wurden —, die Zeit, da das Reichsoberhaupt, in dessen Befugnis die Erlaubnis
zum Burgenbau ursprünglich allein lag, seine beherrschende Stellung auf Kosten der Selbständigkeit aufstrebender
Landesherren mehr und mehr verlor —, da das Grafenamt erblich wurde und seinen Inhabern zwar nicht mehr
die frühere Stellung eines Vertreters königlicher Gewalt einräumte, sie dafür aber um so hemmungsloser in der
Verfolgung eigener Interessen machte, und da sich ein eigener gesellschaftlicher Stand der Ritter herausbildete, den
man zu Gottesdienst, Minnedienst und Herren-, d. h. Kriegsdienst, sorgfältig erzog.
Damals wurde auch die Kiburg, deren Besitzer ebensosehr bestrebt waren, am Hofe des obersten Landesherrn
durch ihren Reichtum zu glänzen, wie auf den Schlachtfeldern Palästinas durch ihre Tapferkeit, den Zeitforderungen
entsprechend umgebaut. Der Pallas erhielt ein zweites Stockwerk mit Vorrats- und Schlafkammern; vor allem
aber wurde die Westfront des Bergfrieds bis zur Ringmauer verlängert, wodurch ein dem Pallas vorgelagertes Küchen-
und Treppenhaus entstand. Sein Erdgeschoß barg als dunkle, dem Pferdestall vorgelagerte Halle nunmehr die Küche
für den Wirtschaftsbetrieb und diente daneben zur Aufbewahrung des Reitzeuges und von anderem unentbehrlichem
Geräte. Eine an die Turmwand angeschmiegte Pflocktreppe führte nach der oberen Küche mit dem großen offenen
Herde, um den sich zur Winterszeit die Herrschaft versammelte. Der Raum war bis unter das Dach offen zum Ab-
züge des Rauches. Aus ihm gelangte man mit einer zweiten Pflocktreppe in das obere Stockwerk im Pallas mit den
Schlaf- und Vorratskammern. Eine dritte Pflocktreppe endete im Dachgeschoß, aus dem sich eine Türe nach dem
Bergfried öffnete. Im Boden des düsteren Raumes, den man betrat, befand sich eine Fallklappe, durch welche man
Gefangene, auf einem Knebel sitzend, an einem Seile in den tiefen, finsteren Schlauch hinabließ, der als Gefängnis
diente. Eine letzte Treppe oder Leiter führte von hier auf die offene Zinne des Turmes, dem früheren Standorte
des Wächters. Sie wurde später, wie anderswo, aufgemauert und mit einem Dachhelme versehen. Diesem Neubau
vorgelagert verblieben, nun aber wahrscheinlich als Riegelbauten aufgeführt, längs der Wehrmauer Back-, Bad-
und Waschhaus. Als zweiter bedeutender Bau entstand in der Südwestecke des Hofes das sogenannte Ritterhaus
mit zwei Stockwerken, dessen Inneres durch zwei starke Mauern in drei beinahe gleiche Teile geschieden wurde, sofern
diese bis auf heute erhaltene Teilung die ursprüngliche ist. Der mittlere diente als geräumiges Treppenhaus, unter
dem sich der einzige Keller in der ganzen Burganlage befindet. Auf der einen Seite der Treppenhalle lag der Stall
für die Reitpferde der Gäste, auf der andern eine Trinkstube zu ihrer Bewirtung, die sogenannte alte Ritterstube.
Die beiden geräumigen Korridore des ersten und zweiten Stockwerkes werden seit dem 16. Jahrhundert, d. h. seit
es geschriebene Aufzeichnungen darüber gibt, „untere" und „obere Ritterlaube" genannt und zudem eine Kammer